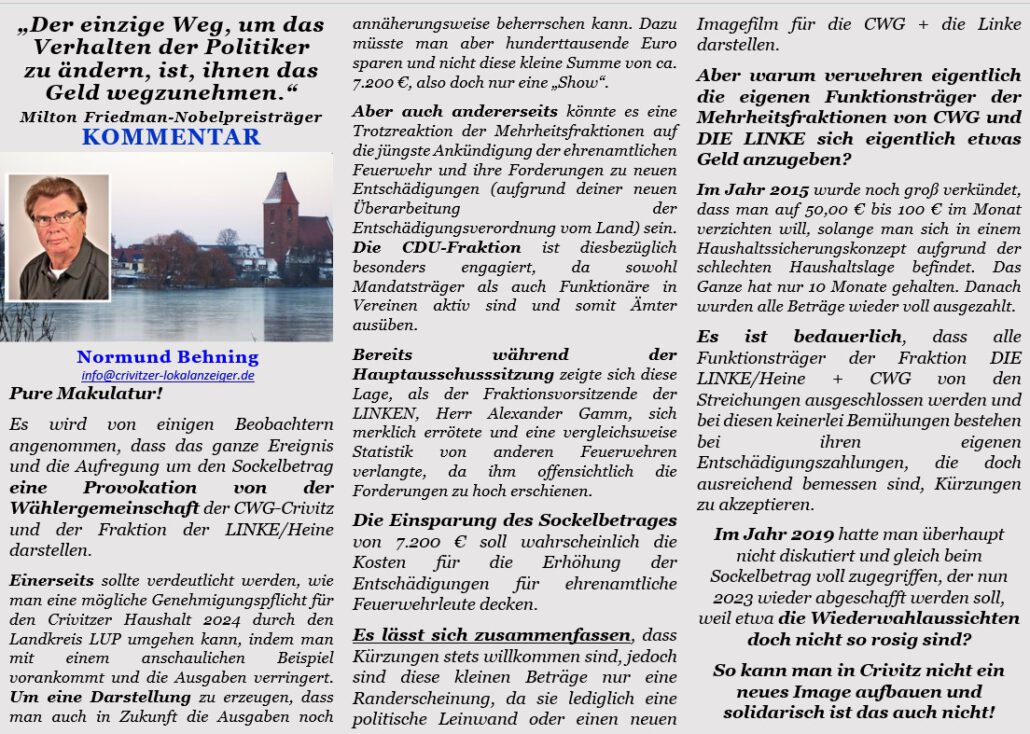01. Jan.-2026 /P-headli.-cont.-red./476[163(38-22)]/CLA-312/01-2026

Aktuelle Nachrichten aus Crivitz & Umgebung
01. Jan.-2026 /P-headli.-cont.-red./476[163(38-22)]/CLA-312/01-2026

24.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./475[163(38-22)]/CLA-311/50-2025
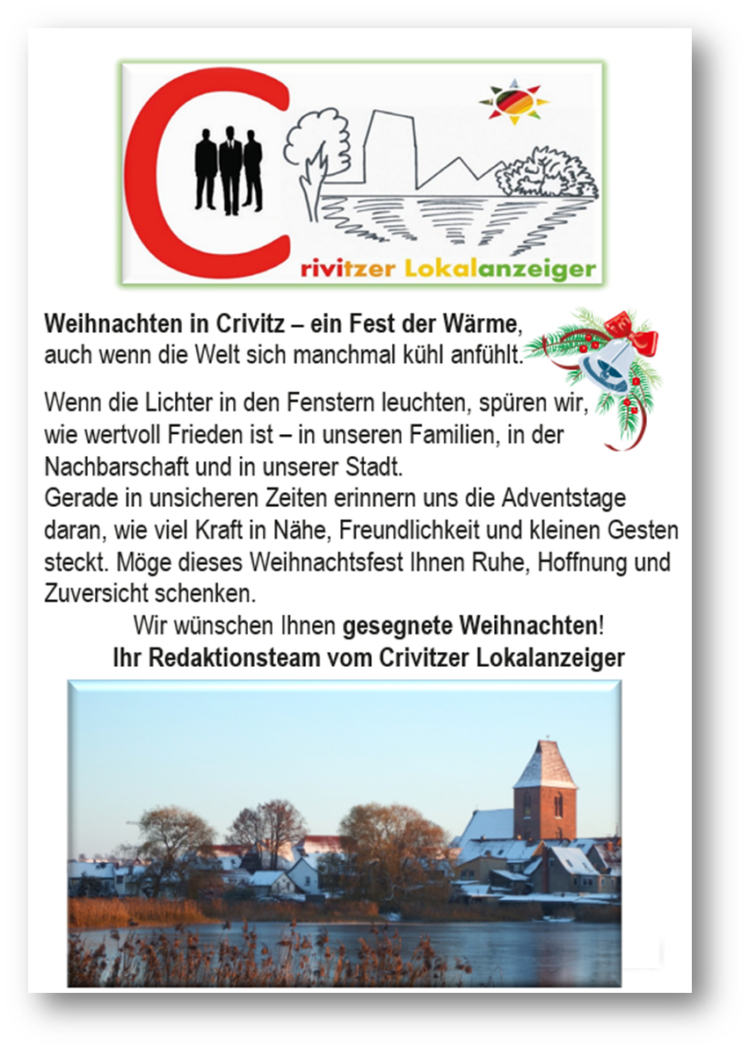
19.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./474[163(38-22)]/CLA-310/49-2025

Windräder in Krudopp: Entscheidung fällt im Schatten der Adventszeit!
Adventsabend im Rathaus: Ein politisches Beben kündigt sich an
Es war eine dieser Dezembernächte, in denen Crivitz nicht zur Ruhe kam. Während in den Häusern Plätzchen dufteten und die Stadt im Lichterglanz der Adventszeit lag, spielte sich im Sitzungssaal der Stadtvertretung ein politisches Schauspiel ab, das viele Bürger noch lange beschäftigen sollte. Schon beim Betreten des Raumes spürte man, dass dieser Abend anders werden würde. Die Reihen waren ungewöhnlich voll, nicht nur mit Stadtvertretern, sondern auch mit Mitgliedern des CWG‑Vorstandes, die sich demonstrativ in die erste Zuschauerreihe gesetzt hatten. Es wirkte, als wolle die CWG – Crivitz an diesem Abend geschlossen Stärke demonstrieren – und Macht.
Eine geschwächte Opposition – und eine CWG, die geschlossen antritt
Die Spannung stieg, als die Anwesenheit festgestellt wurde. Zwei Stadtvertreter der Opposition waren krank, ein weiterer fehlte. Die CWG (Crivitzer Wählergemeinschaft) dagegen war vollständig erschienen, acht Stimmen stark, entschlossen und mit einer Geschlossenheit, die an diesem Abend noch eine zentrale Rolle spielen sollte. Die Opposition – CDU, AfD und BfC – war geschwächt, und jeder im Raum wusste es. Noch bevor die Sitzung richtig begonnen hatte, war klar, dass die Mehrheitsverhältnisse wie ein unsichtbarer Hebel wirken würden.
Warnungen, offene Fragen und fehlende Unterlagen: Der Versuch, den Beschluss zu stoppen
Als die Opposition beantragte, den Tagesordnungspunkt Nr. 10 zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Teilflächennutzungsplans für Windenergie in Krudopp abzusetzen, begann das Drama. Sie trug sachlich vor, dass die Unterlagen bereits am 6. Mai eingereicht worden waren, aber erst sieben Tage vor der Sitzung zugestellt wurden. Wie solle man in so kurzer Zeit über ein Millionenprojekt für drei zu errichtende Windkraftanlagen entscheiden? Wo sei die versprochene Kostennutzungsrechnung der WEMAG? Wo die Machbarkeitsstudie? Wie könne man über drei stadteigene Windkraftanlagen abstimmen, deren Errichtung mindestens 15 Millionen Euro kosten würde für eine Betreibergesellschaft, ohne zu wissen, wer am Ende für die Risiken bürgt? Und warum wurde der Antrag im Bauausschuss nichtöffentlich behandelt – ohne Bürgerbeteiligung, ohne Naturschutzprüfung, ohne Beteiligung anderer Ausschüsse?
Die „Auszeit“: Ein Manöver, das den Abend kippen ließ
Doch statt Antworten kam ein Manöver, das viele Zuschauer fassungslos machte. Der CWG‑Fraktionsvorsitzende Andreas Rüß rief eine „Auszeit“ aus – ein Begriff, der eher an Volleyball erinnerte als an eine Stadtvertretersitzung. Die Geschäftsordnung sah so etwas nicht vor, aber das schien niemanden zu stören. Es war ein Stilmittel, das Alexander Gamm in früheren Wahlperioden etabliert hatte und das sich nun wie ein Schatten über die kommunale Kultur legte. Nach der „Auszeit“ kehrten alle zurück, und ohne weitere Diskussion wurde der Antrag der Opposition abgeschmettert.
Der Stinkefinger-Moment: Als die politische Kultur sichtbar wurde
In diesem Moment geschah etwas, das den Abend endgültig in die politische Folklore von Crivitz einbrennen sollte. Alexander Gamm – Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie bis zum 8. Dezember, Fraktionsmann der CWG‑Crivitz, Bauausschussmitglied, Ehemann der Bürgermeisterin und auf Facebook unter dem Namen „Paul Hermann“ aktiv – richtete sich sitzend förmlich vor Euphorie auf und zeigte in Richtung der Opposition einen deutlich erkennbaren Stinkefinger. Ein Moment, der die Zuschauer erst erstarren ließ und dann mit Kopfschütteln und ungläubigem Murmeln erfüllte. Es war ein Ausbruch, der mehr über die politische Kultur dieses Abends sagte als jede Rede.
Der Mann im Zentrum: Die vielen Rollen des Alexander Gamm
Dabei war Alexander Gamm nicht irgendeine Randfigur. Er war der Mann, der die vertraulichen Termine mit der WEMAG vorbereitete, der die Gespräche führte, der die Unterlagen mit zusammenstellte, der die Arbeitsgruppe leitete, die angeblich das Thema „Crivitz West“ behandelt hatte – obwohl die Opposition klarstellte, dass dieses Thema dort nie diskutiert worden war. Und nun, ausgerechnet an diesem Abend, kündigte die Bürgermeisterin an, dass die Arbeitsgruppe aufgelöst werde. Einfach so. Ohne Beschluss. Ohne Begründung. Als hätte sie ihren Zweck erfüllt.
Die hitzige Debatte: Offene Fragen, keine Antworten
Als schließlich der entscheidende Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, entbrannte eine hitzige Debatte. Die Opposition appellierte an Vernunft und Verantwortung. Sie warnte davor, dass das Gebiet „Crivitz West“ im Regionalplan gar nicht als Windenergiegebiet vorgesehen sei und ein Zielabweichungsverfahren nötig werde. Sie wies darauf hin, dass die Stadt mit diesem Grundsatzbeschluss ein Tor öffne, das sich später nicht mehr schließen lasse. Sie fragte, warum dieser Beschluss unbedingt noch vor Weihnachten gefasst werden müsse. Ob es um Posten gehe. Um Macht. Um Absprachen im Hintergrund. Doch keine dieser Fragen wurde beantwortet.
„Wenn wir es nicht machen, machen es andere“ – Die Argumentation der Bürgermeisterin
Stattdessen wiederholte die Bürgermeisterin nur, dass alle Kommunen um Crivitz herum erneuerbare Energieprojekte planten und man sich nicht verweigern könne. „Wenn wir es nicht machen, machen es andere“, sagte sie – ein Satz, der wie eine Kapitulationserklärung klang, nicht wie eine Vision. Ihre Redebeiträge wurden immer länger, immer ausschweifender, bis man als Zuhörer kaum noch wusste, worum es eigentlich ging. Gleichzeitig unterbrach sie die Oppositionsredner immer wieder, was die Stimmung weiter aufheizte.
Die namentliche Abstimmung: Der Durchmarsch kurz vor Weihnachten
Am Ende kam es zur namentlichen Abstimmung. Mit „JA“ haben gestimmt: Britta Brusch-Gamm, Andreas Rüß, Markus Eichwitz, Doreen Westphal, Kurt Pekrul, Niclas Leon Fronk, Jens Raulin, Michael Renker. Acht CWG‑Stimmen für Ja. Sieben Stimmen der Opposition dagegen. Der Beschluss war gefasst. Das Tor für ein neues Sondergebiet für Windenergieanlagen wurde geöffnet.
Fassungslosigkeit im Saal: Ein Abend, der Vertrauen kostete
Die Stimmung im Saal war gereizt, bedrückt, voller Unverständnis. Viele Zuschauer verließen den Raum mit dem Gefühl, Zeugen eines politischen Vorgangs geworden zu sein, der das Vertrauen in die kommunale Demokratie erschüttert. Ein Beschluss, der ohne Bürgerbeteiligung, ohne Transparenz, ohne vollständige Unterlagen und ohne Rücksicht auf Bedenken durchgepeitscht wurde – und das ausgerechnet kurz vor Weihnachten.
Schlussbild: Ein Abend, der in Erinnerung bleibt
Es war ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird. Nicht wegen der Windräder. Sondern wegen der Art und Weise, wie Politik in Crivitz gemacht wurde – und wegen der Rolle eines Mannes, der an diesem Abend deutlicher denn je zeigte, wie viel Macht man haben kann, wenn man gleichzeitig Bauausschussmitglied, Fraktionsmann der CWG‑Crivitz, Ehemann der Bürgermeisterin und selbsternannter Experte für Wärme und Energie ist.
Fazit: Ein Beschluss im Eiltempo – und ein Vertrauensverlust
Am Ende dieses Abends bleibt ein Bild zurück, das weniger von Sachlichkeit als von Machtwillen geprägt war. Ein Beschluss von erheblicher Tragweite wurde im Eiltempo gefasst – ohne vollständige Unterlagen, ohne Bürgerbeteiligung, ohne die notwendige Transparenz. Die Art und Weise, wie dieser Beschluss zustande kam, erschüttert das Vertrauen vieler Bürger und zeigt, wie schnell demokratische Kultur ins Wanken gerät, wenn Eile und politischer Druck die Oberhand gewinnen.
Besonders bemerkenswert war der zeitliche Kontext: Zu Beginn der Sitzung gedachten die Stadtvertreter in einer Schweigeminute dem vor drei Monaten verstorbenen ehemaligen Stadtvertreter Dipl.- Ing. Klaus Gottschalk – ein Mann, der für seine ruhige, sachliche Art und seine mahnenden Worte bekannt war. Er hatte in seiner politischen Arbeit immer wieder betont, dass „Zeitdruck ein schlechter Ratgeber“ sei.
Nur wenige Minuten nach dieser stillen Geste der Erinnerung wurde jedoch genau das Gegenteil dessen praktiziert, wofür Gottschalk stand. Ein Millionenprojekt wurde durchgedrückt, als ginge es um eine Formalie. Die Diskrepanz zwischen der ehrenden Schweigeminute und dem anschließenden politischen Vorgehen hätte größer kaum sein können.
Dieser Abend wird nicht wegen der Windräder in Erinnerung bleiben, sondern wegen der Art, wie Politik gemacht wurde. Vertrauen entsteht durch Offenheit, Sorgfalt und Beteiligung – und genau das fehlte. Zurück bleibt ein Beschluss, der nicht nur Fragen aufwirft, sondern auch das Gefühl, dass die Bürger an diesem Abend nicht mitgenommen, sondern übergangen wurden.
12.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./473[163(38-22)]/CLA-309/48-2025

Crivitz steht an einem Punkt, an dem die finanziellen Probleme nicht länger verdrängt werden können. Über Jahre hinweg haben sich Defizite aufgebaut, die inzwischen die Handlungsfähigkeit der Stadt massiv einschränken. Rücklagen wurden aufgebraucht, Kosten sind explodiert, und die Spielräume für freiwillige Leistungen oder neue Projekte sind fast verschwunden. Die Bürgerinnen und Bürger sehen sich mit der Realität konfrontiert: Die Krise ist hausgemacht, sie hat sich über ein Jahrzehnt entwickelt – und jetzt entscheidet sich, ob die Stadt den Kurs korrigiert oder endgültig in die Handlungsunfähigkeit abrutscht.
Als die Stadtvertretung Crivitz am 8. 12. 2025 zusammenkam, lag eine seltsame Mischung aus Ernüchterung, Dringlichkeit und dem Bewusstsein über den eigenen Rückstand in der Luft. Der Anlass war der Jahresabschluss 2023, der –formal ein Jahr verspätet – erst jetzt vorgelegt wurde und die Rechtsaufsicht die Stadt verpflichtet hatte, diesen bis zum 31. Dezember 2025 festzustellen.
Ein Jahrzehnt im Minus – die Bilanz 2014 bis 2024
Die eigentliche Brisanz lag jedoch nicht in der verspäteten Vorlage, sondern in den nackten Zahlen, die eine strukturelle Schieflage sichtbar machen, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat und die Handlungsfähigkeit der Stadt inzwischen massiv einschränkt.
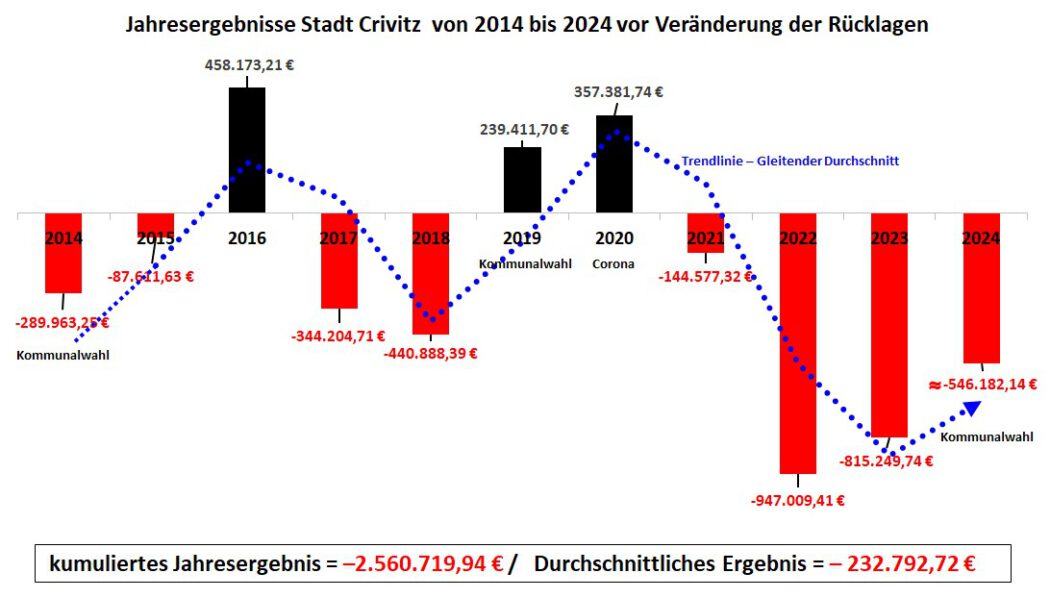
Der Jahresabschluss 2023 weist einen Fehlbetrag von –815.249,74 Euro aus, der nur durch Entnahmen aus Rücklagen und Reserven ausgeglichen werden konnte. Damit setzt sich die Serie negativer Ergebnisse fort, die bereits 2021 mit einem Minus von –144.577,32 Euro begann, sich 2022 mit einem Defizit von –947.009,41 Euro dramatisch verschärfte und 2023 ein weiteres Loch hinterlässt. Auch der Vorausblick auf 2024 ist kaum besser: Ein Fehlbetrag von rund –546.182,14 Euro wird erwartet. In der Gesamtschau der Jahre 2014 bis 2024 ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis von –2.560.719,94 Euro, was einem durchschnittlichen Defizit von –232.792,72 Euro pro Jahr entspricht – Zahlen, die nicht nur eine Momentaufnahme, sondern die Chronik einer strukturellen Fehlentwicklung über eine Dekade darstellen.
Warum der Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät
Trotz steigender Einnahmen gelingt der Stadt seit 2021 kein unterjähriger Haushaltsausgleich mehr ohne Entnahmen aus Rücklagen und Reserven. Die Ursachen liegen in einer Kostenstruktur, die den Handlungsspielraum nahezu auffrisst: Vor allem die Personalkosten und die externen Kosten wachsen in einer Dynamik, die die Planung immer wieder überholt.

Für 2023 wurden die Personalkosten deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt und erreichten 4,5 Mio. €, für 2024 setzt sich der Trend fort und es wird eine weitere Steigerung auf 4,8 Mio. € erwartet. Damit schlagen sie mit rund 35 Prozent der Gesamtaufwendungen zu Buche, während die externen Kosten weitere 40 Prozent ausmachen. Zusammengenommen sind damit 75 Prozent des Haushalts bereits fest gebunden – ein Spielraum, der freiwillige Leistungen, neue Projekte oder flexible Steuerung zunehmend unmöglich macht. Diese starre Bindung der Mittel ist das eigentliche Nadelöhr der kommunalen Finanzpolitik in Crivitz: Sie lässt der Stadt zwar wachsende Einnahmen verbuchen, aber noch schneller wachsende Ausgaben tragen, die sich der kurzfristigen Steuerung entziehen. Besonders deutlich wird im Bericht zum Jahresabschluss die Problematik in den kommunalen Einrichtungen, in denen die Kostenlinie sehr klar und zugleich schwer umkehrbar verläuft.
Gebäudereinigung: Qualität gewonnen, Kosten explodiert
Die kommunale Gebäudereinigung verursachte 2023 Aufwendungen in Höhe von 637.963€, davon allein 589.544 € Personalkosten. Der Personalbestand stieg auf 22 Kräfte – vier mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen basieren auf Eingliederungszuschüsse, Erstattungen durch die Krankenkasse für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot und die Erstattung der einmalig gezahlten Energiepreispauschale. Zwar konnte durch eine Kosten- und Leistungsrechnung und die interne Leistungsverrechnung ein rechnerisch neutrales Ergebnis im Produkt Reinigung erzielt werden, doch die tatsächliche Kostenentwicklung bleibt besorgniserregend und zeigt, wie eng die Spielräume sind, wenn die fixen Komponenten wachsen und die Einnahmen strukturell nicht mithalten.
Auf die Kritik der Rechnungsprüfung reagierte Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG) erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme die öffentlich zugänglich war, in der sie die Eigenreinigung verteidigt und als Qualitätsgewinn darstellt. Sie verweist auf überarbeitete Hygienepläne, Mengenrabatte bei Bestellungen und die Neustrukturierung der Zuständigkeiten seit Mai 2025. Die Entscheidung zur Eigenreinigung sei notwendig gewesen, da frühere Vergaben an externe Firmen zu mangelhaften Leistungen geführt hätten. Man habe „ganze Ordner voller Rechnungskürzungen“ und sogar städtische Mitarbeiter hätten die Reinigung übernehmen müssen – in Kindereinrichtungen.
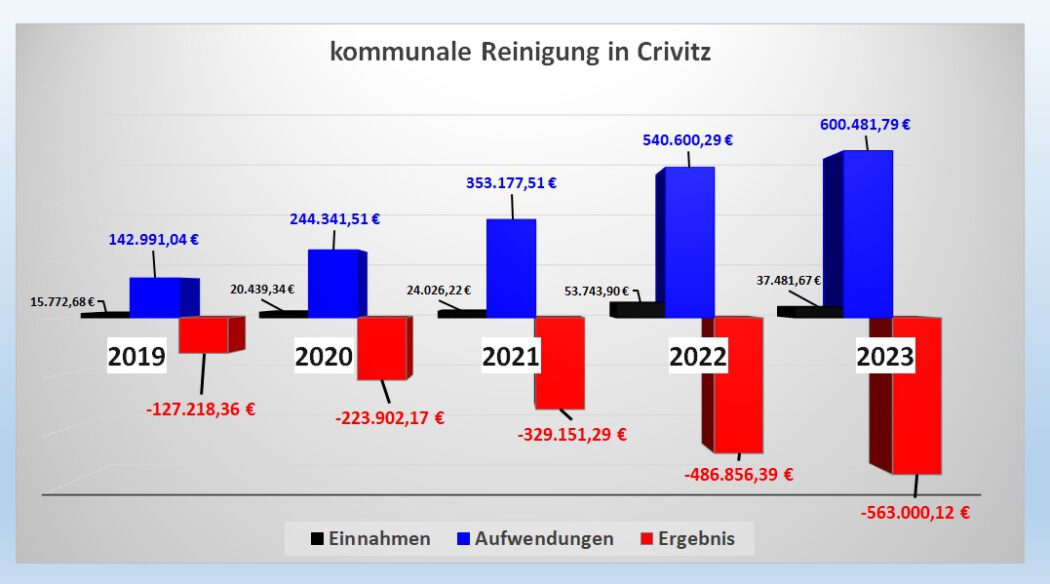
Doch diese Darstellung blendet zentrale haushaltspolitische und juristische Folgen aus. Denn die Eigenreinigung hat nicht zu einer Kostenentlastung geführt, sondern zu einem kontinuierlichen Anstieg der Aufwendungen: Von 142.991€ im Jahr 2019 auf über 600.000 € im Jahr 2023 – bei Einnahmen, die in keinem Jahr auch nur annähernd die Kosten deckten. Das Defizit 2023 beträgt über 563.000 €. Die behauptete „höhere Bindung an die Häuser“ mag organisatorisch sinnvoll erscheinen, doch haushaltstechnisch wurde das Gegenteil erreicht: Die Stadt zahlt mehr, spart nicht – und steht nun zusätzlich vor einem Gerichtsverfahren.
Denn wie der Rechnungsprüfer feststellte in seinem Bericht, hat die Stadt Crivitz bis 2019 eine externe Reinigungsfirma beauftragt, deren Leistungen als mangelhaft bewertet wurden. Rechnungen wurden gekürzt oder gar nicht beglichen. Eine außergerichtliche Einigung scheiterte – nun klagt das Unternehmen auf Zahlung. Der Streitwert beläuft sich auf 57.672,61€, zuzüglich 10.000 € für Zinsen, Gerichts- und Anwaltskosten. Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 67.700 € gebildet für 2024– eine Summe, die den Haushalt zusätzlich belastet und die Frage aufwirft, ob die damalige Vergabepraxis und die heutige Umstellung wirklich professionell begleitet wurden.
Die Stellungnahme der Bürgermeisterin enthält viele organisatorische Details, aber wenig haushaltspolitische Einsicht. Sie beschreibt Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe, aber kein klares Konzept zur Kostenbegrenzung. Die Bürgerinnen und Bürger sehen eine Kostenlinie, die Jahr für Jahr steigt – und eine politische Verteidigung, die diese Entwicklung nicht kritisch hinterfragt. Die Eigenreinigung mag in der Praxis besser funktionieren als frühere Vergaben, doch sie ist haushaltstechnisch nicht tragfähig. Und die juristischen Altlasten zeigen: Auch die Vergangenheit wurde nicht sauber abgeschlossen. Was als Qualitätsgewinn dargestellt wird, ist in Wahrheit ein Kostenproblem mit juristischem Anhang. Die Stadt zahlt mehr, steht vor Gericht – und die politische Kommunikation bleibt defensiv. Das ist keine Entlastung, sondern eine Belastung. Und sie verlangt endlich eine ehrliche Neubewertung: Was kostet uns Qualität wirklich? Und wie viel davon können wir uns noch leisten?
Bauhöfe ohne klare Kostenkontrolle

Noch gravierender ist die Situation bei den kommunalen Bauhöfen, deren Aufwendungen sich auf 648.285 € beliefen, davon 457.131€ Personalkosten – ein Anteil von 70,52 Prozent. Hier fehlt eine Kosten-Leistungs-Rechnung vollständig, sodass Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten nicht gegeben sind; die ausgewiesenen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Korrekturbuchungen früherer Personalkosten, einer Kostenerstattung für den Glasfaseranschluss und dem Verkauf eines Multicar, dessen Differenz zwischen Verkaufserlös und Restbuchwert einen Ertrag von 6.499 Euro ausmacht. Die fehlende interne Verrechnung wirkt als Hemmschuh, insbesondere dort, wo Bauhofleistungen für die Kitas, deren Gebäude und Anlagen systematisch abgegrenzt und in Leistungsverhandlungen abgebildet werden müssten.
Kindereinrichtungen in den vergangenen Jahren im Dauerdefizit
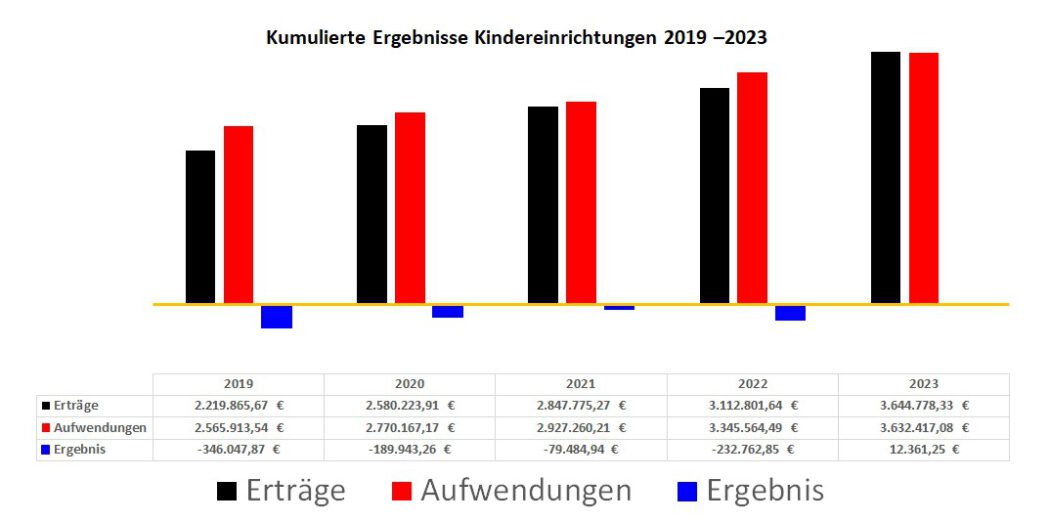
Hinzu kommen die Kindertagesstätten, die ebenfalls die durchschnittlichen Defizite von 2019 bis 2023 aufweisen: Der Hort Crivitz mit –45.554,63€, der Kindergarten „Uns Lütten“ mit –90.838,39€ und der Kindergarten „Marienkäfer“ in Wessin mit –30.838,39€. Jahrelang schleppend verlaufene Leistungsverhandlungen wurden erst seit zwei Jahren intensiviert; solange die interne Verrechnung – insbesondere mit Blick auf Bauhofleistungen – nicht belastbar hinterlegt ist, bleiben die Verhandlungsergebnisse jedoch unterdurchschnittlich und die Defizite bestehen.
Repräsentationskosten: Nett gemeint, teuer bezahlt
Auch die Gesamtkosten der Repräsentationen der Stadt Crivitz stiegen merklich: 10.484,88 € für die Bürgermeisterin und insgesamt 71.201,41€ für die Stadt im Jahr 2023. Diese Zahlen sind jedoch kein Einzelfall, sondern Teil einer kontinuierlichen Entwicklung, die sich über mehrere Jahre hinweg aufgebaut hat und inzwischen eine eigene haushaltspolitische Relevanz entfaltet. Die Gesamtkosten der Repräsentation stiegen von 20.986,75€ im Jahr 2020 – einem Jahr, das pandemiebedingt unter dem Zeichen von Corona stand – auf 39.218,52€ im Jahr 2021, weiter auf 59.648,28€ in 2022 und schließlich auf 71.201,41 € im Jahr 2023. Für 2024 sind bereits 68.700€ veranschlagt, und für 2025 sogar 77.600€. Die lineare Trendlinie zeigt eine klare Aufwärtsbewegung, die sich haushaltstechnisch nicht mehr ignorieren lässt.
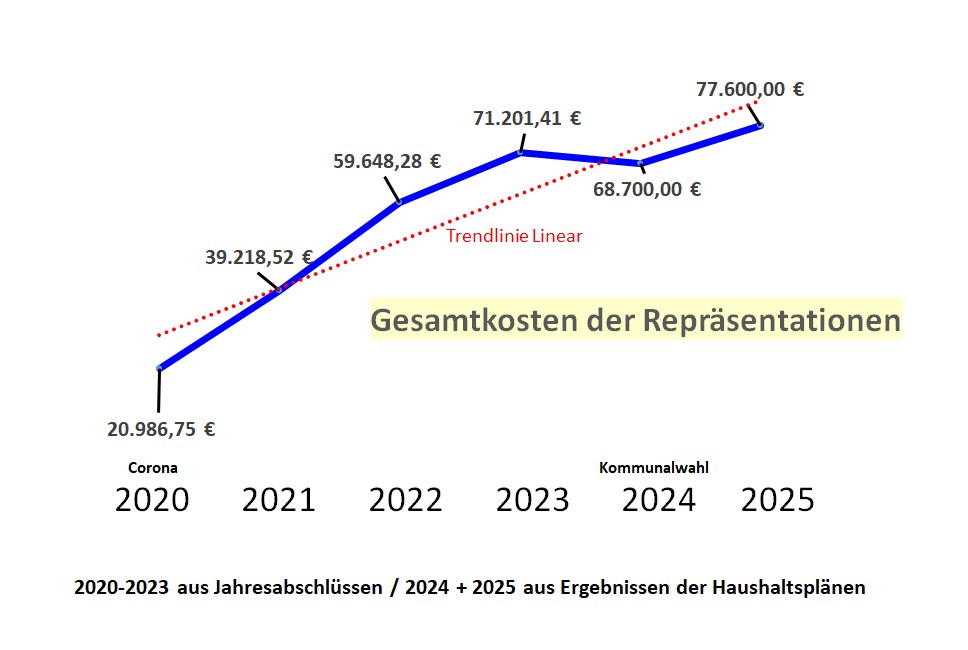
Auf die Kritik der Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss 2023 reagierte die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme, die öffentlich zugänglich gemacht wurde. Darin heißt es unter anderem: „Das Weihnachtsessen […] ist Dank und Anerkennung für die gute Zusammenarbeit, ist ein einander Kennenlernen und Netzwerken.“ Auch Betriebsfeste seien laut Stellungnahme dazu da, „das Miteinander und damit das Betriebsklima“ zu verbessern, um Versetzungen und Krankschreibungen zu vermeiden. Die Stadtfahrt wird als„Geste gegen Vereinsamung“und als „mobile Bürgermeistersprechstunde“ beschrieben. Und bei internen Beratungen sei es Ausdruck von „Wertschätzung und Anerkennung“, wenn „mal belegte Brötchen oder eine Bockwurst“ übernommen würden. Die stark gestiegenen Repräsentationskosten sind nicht nur Zahlen auf dem Papier, sondern ein politisches Ergebnis: Sie entstanden in der Zeit, in der die CWG – Crivitz (Crivitzer Wählergemeinschaft) von 2019 bis 2024 die absolute Mehrheit hatte und den Kurs der Stadt bestimmte. Damit zeigt sich klar, dass diese Ausgaben eine bewusste politische Entscheidung waren – und die Bürgerinnen und Bürger müssen sich fragen, ob solche Kosten in der jetzigen Zeit noch verhältnismäßig und verantwortbar sind.
Diese Argumentation der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm ( CWG – Crivitz) wirkt auf den ersten Blick empathisch, doch sie offenbart bei genauerer Betrachtung eine bemerkenswerte Abwehrhaltung gegenüber der haushaltspolitischen Kritik. Die Bürgermeisterin betont zwar, man werde die Repräsentationskosten „sehr genau prüfen und sich mit dem Amt abstimmen“, doch diese Formulierung bleibt vage und unverbindlich. Statt einer klaren Einsicht in die haushaltspolitische Tragweite der Ausgaben wird ein sozialer Nutzen behauptet, der sich weder in den Zahlen noch in der Wirkung gegenüber der Öffentlichkeit widerspiegelt. Die grafisch belegte Kostenentwicklung zeigt eine kontinuierliche Steigerung der Repräsentationsausgaben – sowohl in der Gesamtsumme als auch im Einzelbudget der Bürgermeisterin. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu der behaupteten Sparsamkeit („Dafür sparen wir bei all unseren Gremiensitzungen die Konferenzgetränke“) und lässt sich nicht durch Einzelfälle wie eine Stadtfahrt mit 300 Euro Überschuss relativieren. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass die Repräsentationspraxis sich verselbständigt hat – mit einer Ausweitung der Formate, einer Normalisierung der Ausgaben und einer politischen Verteidigung, die wenig Raum für Selbstkorrektur lässt.
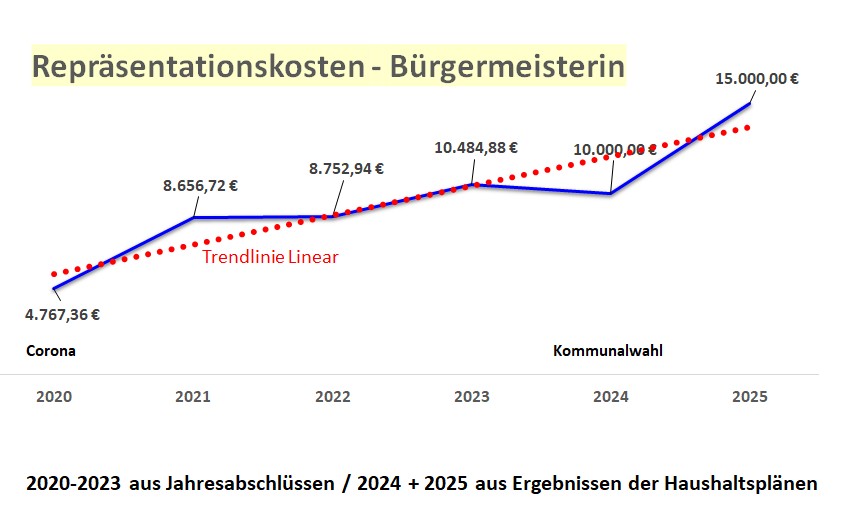
Sogar die Repräsentationskosten der Bürgermeisterin selbst folgen diesem Trend: Von 4.767,36€ im Jahr 2020 stiegen sie auf 8.656,72€ in 2021, auf 8.752,94€ in 2022 und auf 10.484,88€ in 2023. Für 2024 sind 10.000€ angesetzt, für 2025 bereits 15.000€. Die lineare Trendlinie zeigt auch hier eine kontinuierliche Steigerung, die sich nicht allein durch inflationäre Effekte oder Einmalanlässe erklären lässt. Vielmehr ist hier eine strukturelle Ausweitung der Repräsentationspraxis zu erkennen, die sich über mehrere Haushaltsjahre hinweg verfestigt hat.
Die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm ( CWG – Crivitz) beschreibt ihre Repräsentationsausgaben als Ausdruck von Nähe, Austausch und Wertschätzung – etwa durch Weihnachtsessen, Stadtfahrten oder kleine Gesten im Arbeitsalltag. Doch genau diese gut gemeinten Absichten stehen inzwischen im Widerspruch zur finanziellen Realität der Stadt. Denn während die Kosten für solche Veranstaltungen und Maßnahmen Jahr für Jahr steigen, schrumpft gleichzeitig der Spielraum für andere wichtige Aufgaben – etwa für Investitionen, freiwillige Leistungen oder die Absicherung der Grundversorgung. Die Kritik aus dem Rechnungsamt und aus der Bürgerschaft wächst, weil viele den Eindruck gewinnen: Hier wird Geld für Dinge ausgegeben, die zwar nett gemeint sind, aber nicht mehr im Verhältnis zu den Möglichkeiten der Stadt stehen.
Die Stellungnahme der Bürgermeisterin wirkt deshalb nicht entlastend, sondern verstärkt das Gefühl, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden. Repräsentationskosten sind kein Randthema – sie zeigen, wie eine Stadt mit ihrem Geld umgeht. Und genau deshalb müssen sie künftig strenger geprüft werden: Was ist wirklich notwendig? Was ist noch angemessen? Und was akzeptieren die Bürgerinnen und Bürger als sinnvoll?
Zwischen Investitionszwang und Haushaltsdisziplin
Crivitz kämpft mit wachsender Schuldenlast und drohender Zinsfalle: Die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt wie selten zuvor. Aufgezehrte Rücklagen und fehlende liquide Mittel haben bereits die staatliche Rechtsaufsicht auf den Plan gerufen. Ein Blick auf die Kreditstruktur zeigt, wie eng der Handlungsspielraum geworden ist – und wie lange die Belastung die Stadt noch begleiten wird.
Die drei Kredit-Komponenten im Überblick
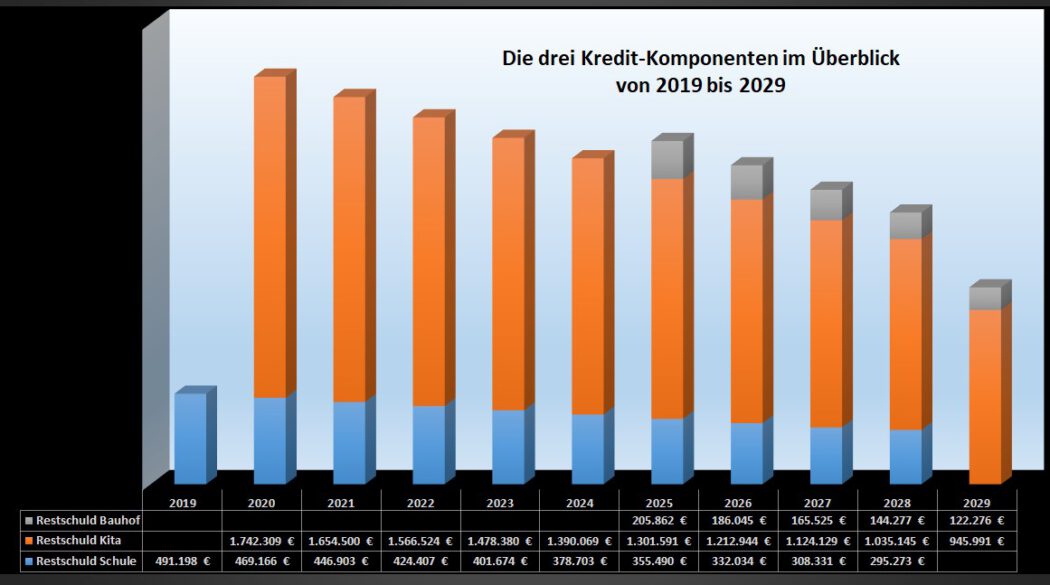
Die Erblast der Großprojekte: Seit 2019 wurden in Crivitz wichtige Investitionen in die soziale Infrastruktur gestemmt. Der Umbau der Grundschule und die Sanierung der Kita „Uns Lütten“ galten als unverzichtbar, doch sie wurden ohne ausreichendes finanzielles Polster umgesetzt. Das Ergebnis: eine Schuldenlast von über 1,7 Millionen Euro, die die Stadt bis ins Jahr 2040 begleiten wird – eine Bürde, die kommende Generationen spüren werden.
Der kritische Punkt: 2025: Besonders brisant wird die Lage im Jahr 2025. Trotz leerer Kassen zwingt die Notwendigkeit, den Bauhof zu sichern, zu einer weiteren Kreditaufnahme über 225.000 €. Damit steigt die jährliche Belastung für Zins und Tilgung auf rund 145.000 €. Monatlich müssen über 12.000 € allein für den Schuldendienst erwirtschaftet werden, bevor Mittel für freiwillige Leistungen, Vereinsförderung oder Straßenerhalt zur Verfügung stehen. Erst mit der Schlusszahlung für den Schulkredit Ende 2028 ist eine kleine Entlastung absehbar, doch bis 2034 bleibt die Stadt durch den Bauhof-Kredit zusätzlich gebunden.
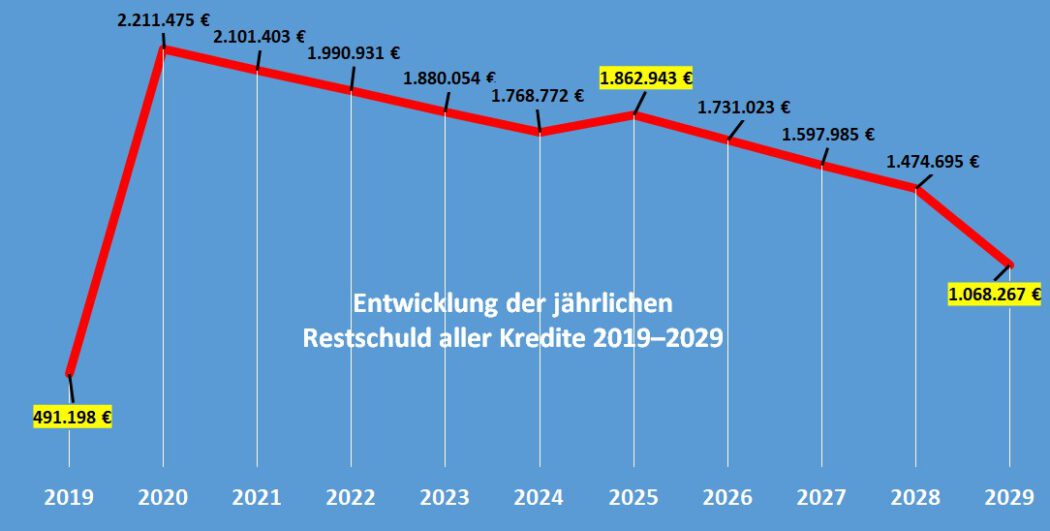
Die drohende Zinsfalle: Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsbindung des Kita-Darlehens. Der derzeitige Zinssatz von 0,19 % vermittelt trügerische Sicherheit. Läuft die Bindung im Sommer 2030 aus und steigen die Marktzinsen deutlich, könnte die Belastung erdrückend werden – bei einer Restschuld von fast einer Million Euro.
Konsequenzen und Ausblick: Die Stadt befindet sich in einer Phase extremer finanzieller Unfreiheit. Jeder neue Kredit schränkt den Handlungsspielraum für Jahrzehnte ein. Die Prioritäten werden zunehmend von Tilgungsplänen und Aufsichtsbehörden bestimmt, nicht mehr von den gewählten Vertretern.
Die Rolle der CWG – Crivitz Mehrheit 2019–2024
In diesem Zusammenhang darf die politische Verantwortung nicht unter den Tisch fallen. Die CWG‑Fraktion (Crivitzer Wählergemeinschaft) verfügte von 2019 bis 2024 über eine absolute Mehrheit in der Stadtvertretung und prägte in dieser Zeit den finanzpolitischen Kurs wesentlich – sowohl in der strategischen Ausrichtung als auch in der konkreten Haushaltsführung. Entscheidungen zur Personalentwicklung, zur Struktur der freiwilligen Leistungen, zur Investitionspolitik und zur Priorisierung einzelner Produkte wurden unter ihrer Führung getroffen. Das heute dokumentierte kumulierte Defizit von über 2,5 Millionen Euro ist daher nicht allein ein technischer Saldo, sondern auch das Ergebnis einer politischen Mehrheit, die über Jahre hinweg die Richtung vorgab.
Wo Verhandlungen vertagt wurden, wo Kosten-Leistungs-Rechnungen fehlten, wo Steuerungsinstrumente nicht konsequent eingeführt oder genutzt wurden, entstanden Lücken, die sich später als Defizite materialisierten. Insofern trägt die Wählergemeinschaft CWG – Crivitz eine zentrale Verantwortung für die finanzpolitische Entwicklung, die nun sichtbar in eine strukturelle Haushaltskrise münden wird.
Gefährdete Fördermittel und die vorläufige Haushaltsführung 2026
Der Jahresabschluss 2023 erhielt zudem einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk, verursacht durch eine zum Zeitpunkt der Erstellung nicht aktuelle Prüfsoftware. Das Zahlenwerk soll korrekt sein; gleichwohl ist die formale Einschränkung ein weiterer Baustein in einer Kette von Unschärfen, die in der Summe das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit belasten. Der Ausblick auf 2024 zeichnet ein ähnliches Bild: Ein Defizit von rund einer halben Million Euro, ein voraussichtlich besser strukturierter Finanzhaushalt, der jedoch die zentrale Schwäche – die sinkende Liquidität und abgeschmolzene Rücklagen – nicht kompensieren kann. In der Folge drohen auch 2026 Haushaltssperren in einzelnen Bereichen, sollten keine klaren Gegensteuerungen greifen.
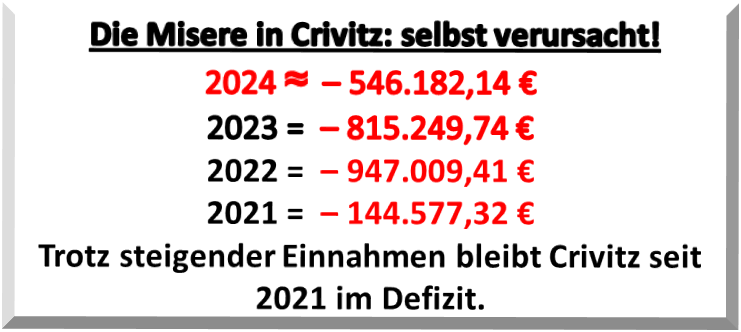
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Crivitz lebt von der Substanz, und die Uhr tickt. Der Weg zur vollständigen Entschuldung reicht bis ins Jahr 2040 und verlangt strikte Haushaltsdisziplin. Investitionen auf Pump dürfen keine Gewohnheit werden, sondern müssen die Ausnahme bleiben. Nur durch konsequentes Sparen und eine strenge Ausgabenkontrolle kann die Stadt mittelfristig wieder eigenständig über ihre Zukunft entscheiden – ohne dass die Rechtsaufsicht jeden Schritt vorgibt.
Die Zeitachse verschärft die Lage weiter: Der Orientierungsdatenerlass vom 27. November 2025 verlangt für Fördermittelanträge im Jahr 2026 die Vorlage eines aufgestellten Jahresabschlusses 2025 sowie aller festgestellten Vorjahresabschlüsse. Crivitz erfüllt diese Voraussetzung nicht; der Jahresabschluss 2024 hätte bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen sein müssen, der Jahresabschluss 2025 muss bis zum 31. Mai 2026 aufgestellt werden. Die Haushaltsplanung 2026 bleibt vage, die Zahlen sollen erst nach dem 31. Dezember verarbeitet werden, der Orientierungsdatenerlass ist im Amt noch nicht angekommen; realistisch ist ein Beschluss für einen Haushaltsatzung 2026 frühestens im April. Ab dem 1. Januar 2026 bedeutet das: vorläufige Haushaltsführung mit beschränkter Mittelausgabe, keine neuen Projekte, nur das zwingend Notwendige.
Was jetzt passieren muss – klare Prioritäten statt weiterem Stillstand
Die Sitzung am 8. Dezember 2025 machte unmissverständlich deutlich, dass die Stadt Crivitz vor einem Wendepunkt steht. Die Stadt ist in ein enges Korsett gewachsen: Einnahmen steigen, aber die gebundenen Ausgaben steigen schneller; Rücklagen wurden genutzt, um Löcher zu schließen, ohne die Ursachen zu beseitigen; die Liquidität schmilzt, während die formalen Anforderungen für Fördermittel die Zeitfenster enger ziehen.
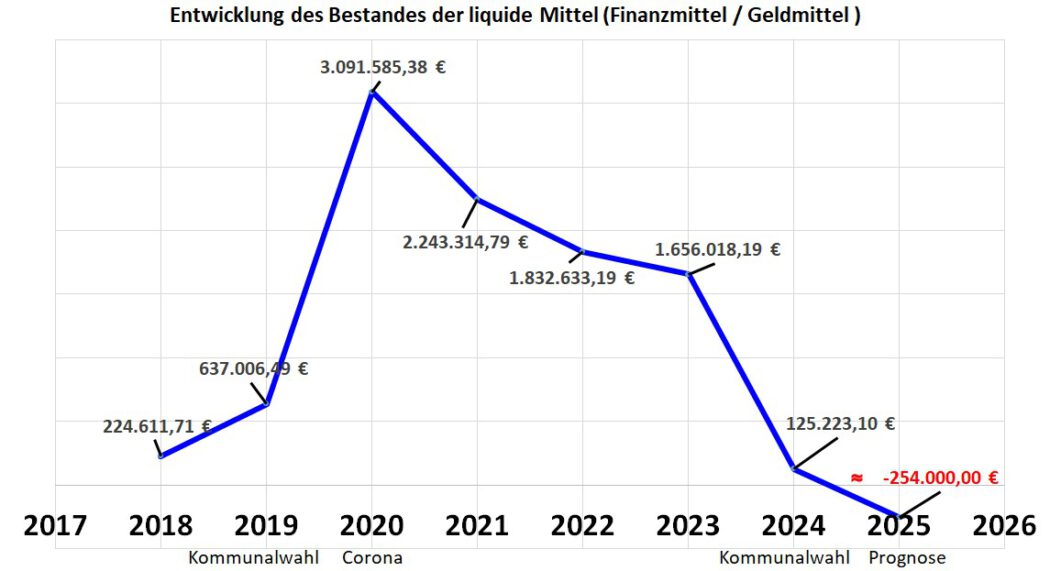
Der Weg aus dieser Lage ist anspruchsvoll, aber er ist möglich, wenn die Stadt sich konsequent auf Steuerung, Transparenz und Priorisierung ausrichtet:Kosten-Leistungs-Rechnungen müssen in allen relevanten Bereichen eingeführt und gelebt werden, insbesondere in den kommunalen Bauhof; Personalkosten sind auf Wirkung, Wirtschaftlichkeit und Priorität zu prüfen; externe Kosten müssen einer strengen Notwendigkeitskontrolle unterzogen und gegebenenfalls begrenzt werden; Repräsentationsausgaben sind transparent zu trennen und auf ein nachvollziehbares Maß zu reduzieren; das Fördermittelmanagement muss auf Fristenstabilität und Projektklarheit getrimmt werden, damit Chancen nicht an Formalien scheitern; freiwillige Leistungen können nur noch im Rahmen der tatsächlich verbleibenden Restmittel verantwortet werden.
Fazit:
Hausgemachte Krise verlangt entschlossenes Handeln
Ab 2026 wird die Stadt Crivitz auf Zuschüsse des Landes und des Kreises angewiesen sein; aus eigener Kraft bleibt die Handlungsfähigkeit nur über intensive Kürzungen zu sichern. Die Misere hat viele Ursachen – organisatorische, politische, strukturelle –, und sie ist in weiten Teilen hausgemacht. Gerade deshalb braucht es jetzt entschlossenes Handeln, nicht als Geste, sondern als durchgängiges Prinzip: klare Zahlen, klare Prioritäten, klare Verantwortlichkeiten und eine Haushaltsdisziplin, die den Spielraum der Kommune zurückerobert, Schritt für Schritt und mit Blick auf das, was die Stadt langfristig tragen kann.
07.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./472[163(38-22)]/CLA-308/47-2025
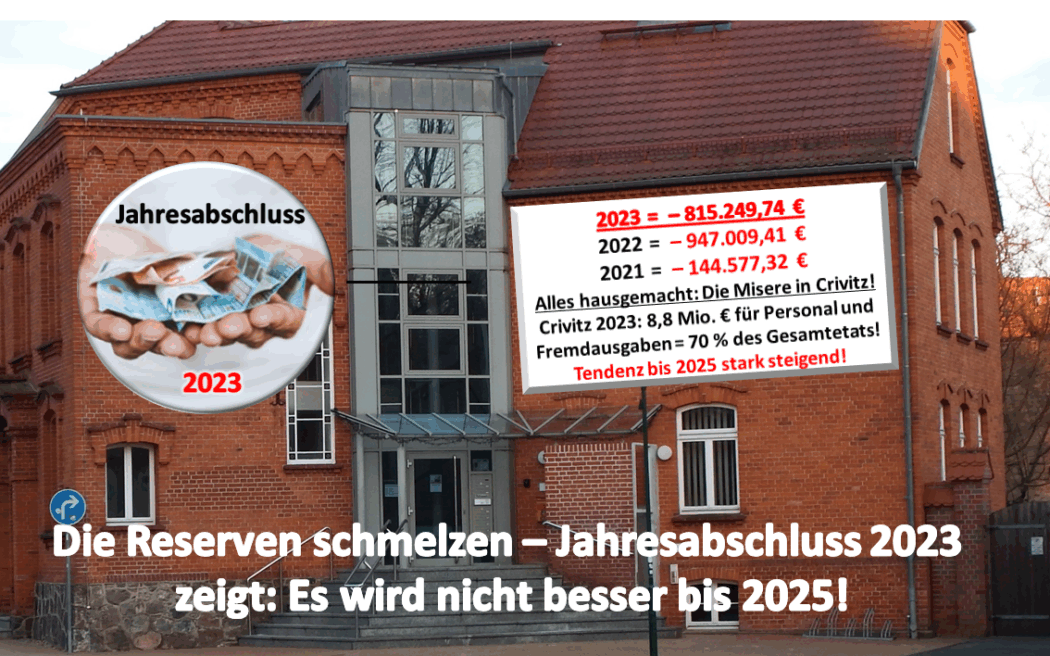
Es ist Dezember 2025. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 läuft, Fördermittel müssen beantragt, Investitionen geplant, Prioritäten gesetzt werden. Doch erst jetzt liegt der Jahresabschluss 2023 vor – ein Jahre im Rückstand, in einer Zeit, in der jede Kennziffer über die Handlungsfähigkeit der Stadt entscheidet. Wir reden über gestern, während das Heute im Dunkeln bleibt. Und das Morgen droht, uns einzuholen.
Der Jahresabschluss 2023 ist ein Dokument der Ernüchterung: Die Erträge betragen 11.957.899 €, die Aufwendungen 12.773.149 €. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von –815.249 €, der nur durch Entnahmen aus Rücklagen ausgeglichen werden konnte. Die Liquidität sank Ende 2023 auf 1.698.000 €, ein Rückgang um fast 200.000 € gegenüber dem Vorjahr. Von den einst soliden Rücklagen sind nur noch rund 500.000 € übrig. Die Stadt fährt faktisch auf der letzten Reserve.
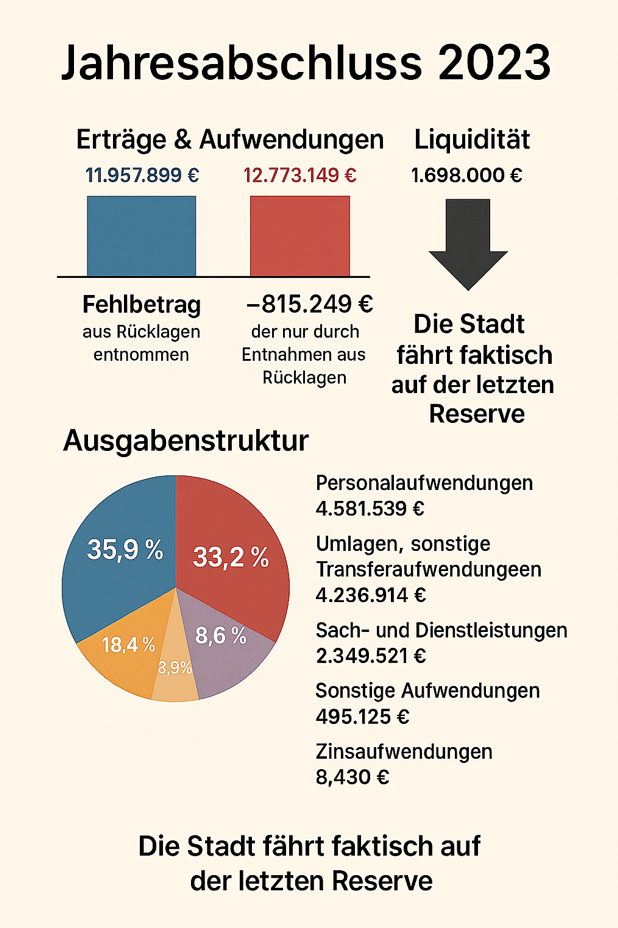
Die Ausgabenstruktur bindet den Haushalt eng: Personalaufwendungen liegen bei 4.581.539 € (35,9 %), Umlagen und sonstige Transferaufwendungen bei 4.236.914 € (33,2 %), Sach- und Dienstleistungen bei 2.349.521 € (18,4 %). Hinzu kommen Abschreibungen von 1.101.617 € (8,6 %), sonstige Aufwendungen von 495.125,04 € (3,9 %) und Zinsaufwendungen von 8.430 € (0,07 %).
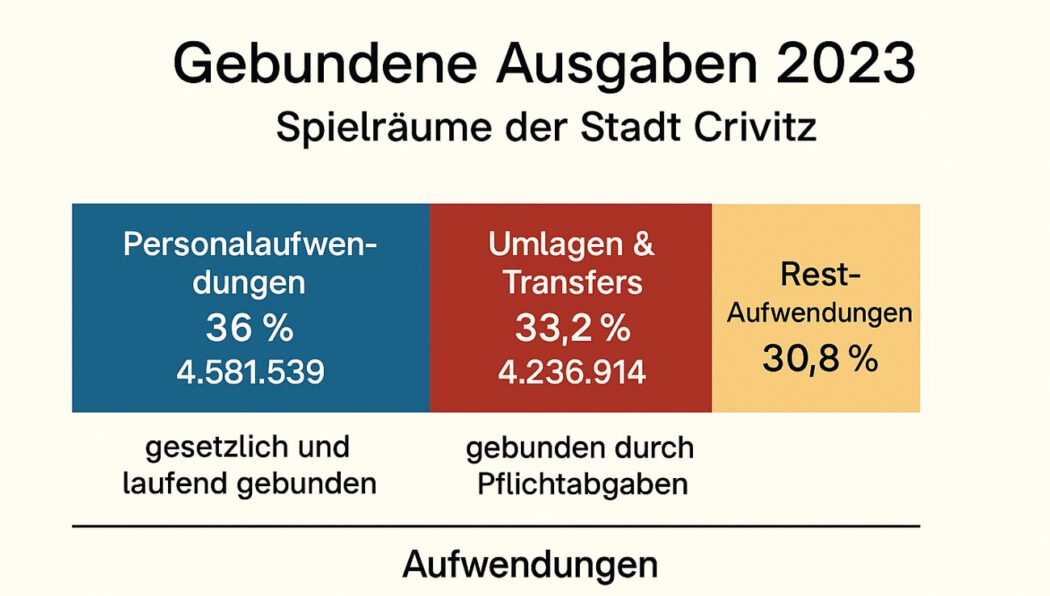
Damit verschlingen Personal und Umlagen zusammen fast 70 % des Haushalts – die Spielräume für gestaltende Aufgaben sind minimal. Besonders deutlich wird die Kostensteigerung in der Grundversorgung: Die kommunale Gebäudereinigung verursachte 2023 rund 637.963€ an Aufwendungen, der kommunale Bauhof über 648.285 €. Diese laufenden Betriebskosten sind notwendig, wachsen aber sichtbar bis 2025 und schmälern die Flexibilität der Stadt zusätzlich.
Noch dramatischer ist der Zeitpunkt. Wir sind im Dezember 2025, und eigentlich müsste längst der Jahresabschluss 2024 vorliegen und verabschiedet werden, damit die Stadt auf einer soliden Grundlage planen kann. Doch Crivitz hängt zwei Jahre hinterher. Der Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025 verlangt bereits für Fördermittelanträge im Jahr 2026 den aufgestellten Jahresabschluss 2025 sowie alle festgestellten Abschlüsse der Vorjahre. Crivitz erfüllt diese Voraussetzung nicht. Die Folge: Die Stadt riskiert, dringend benötigte Fördermittel nicht beantragen zu können. Investitionen in Schulen, Straßen oder soziale Projekte könnten blockiert werden – nicht, weil das Geld fehlt, sondern weil die Verwaltung ihre Hausaufgaben nicht rechtzeitig gemacht hat.
Auf den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2023 reagierte die Bürgermeisterin erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme, die öffentlich zugänglich gemacht wurde:
„Gestatten Sie mir einige Ausführungen zu dem Prüfbericht: Es gibt aus meiner Sicht Informationslücken. Vielleicht ist es auch der knappen Zeit geschuldet, dass bei mir nach Studium ein Eindruck zurückbleibt, unsere Arbeitsweise kostet dem Amt zu viel Zeit und wir werfen das Geld mit vollen Händen raus. Das ist zumindest mein Eindruck. Grundlage der Rechnungsprüfung war das Zahlenwerk, die Dokumente und Aussagen im Amt. Es gibt aber auch die ehrenamtliche Ebene, die nicht befragt wurde. Deshalb werbe ich um Ihr Verständnis, auch meine Sicht auf die Auswertung wiedergeben zu dürfen. Die kritisch angemerkten Dinge von Amtswegen sind für uns als Hinweise wichtig, um besser zu werden. Mir ist auch bewusst, dass meine Ausführungen unser Haushaltsergebnis unterm Strich nicht verbessern werden, aber vielleicht das Verständnis. Wir stehen im Ehrenamt einerseits für die Öffentlichkeit in Mithaftung – die Berichte lesen sich wie eine Gesamtverantwortung des Ehren-amtes – und andererseits dürfen wir unsere Leistung nicht einbringen. Sie wird keiner Bewertung unterzogen, was wir durch ehrenamtliches Engagement auch an Ersparnissen für die Kommunen erreichen. Die Zeit der Mitarbeitenden ist berechenbar und offensichtlich, die des Ehrenamtes nicht. Ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass unsere ehrenamtliche Perspektive in unserem Amt zu wenig gesehen wird. Der Tenor darf nicht sein, dass das Ehrenamt zu wenig den Blick aufs große Ganze hat, diszipliniert werden muss und demo-kratische Wege wertvolle Zeit kosten. Ich wünsche mir wieder ein stärkeres und vor allem lösungsorientierteres Miteinander.“………..„Wir können im Ehrenamt nur so gut sein wie unser Amt uns dabei unterstützt.„

Diese Einlassung verdient eine nüchterne, faktenbezogene Einordnung. Ja, die Prüfung fokussiert auf das Zahlenwerk, Dokumente und Aussagen der Verwaltung – denn genau dort werden Haushaltsansätze gebildet, Mittel bewirtschaftet und Abschlüsse erstellt. Das Ehrenamt leistet wertvolle Beiträge, doch es kann weder die Pflicht zur fristgerechten Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse ersetzen noch strukturelle Defizite überdecken. Der Fehlbetrag von –815.249 € ist keine Frage des Eindrucks, sondern rechnerische Tatsache; die Liquidität von 1.698.000 € und Rücklagen von rund 500.000 € sind klar bezifferte Größen; die Kostenblöcke von Personal (4,58 Mio. €) und Umlagen (4,24 Mio. €) binden den Haushalt; die Betriebskosten in Gebäudereinigung (ca. 637.963€) und Bauhof (über 648.285 €. ) wachsen seit Jahren weiter an. Diese Punkte erfordern Management, Priorisierung und Disziplin – unabhängig von der berechtigten Wertschätzung für das Ehrenamt. Wer das Prüfverfahren auf „Informationslücken“ und „knappe Zeit“ reduziert, greift zu kurz, denn die Kernbotschaft bleibt: Ohne zeitnahe Abschlüsse, belastbare Kalkulationen und klare Steuerung verliert die Stadt Handlungsfähigkeit und Förderzugänge.
Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt nicht im Ehrenamt, sondern bei der politischen Führung. Seit 2014 steht die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm an der Spitze der Stadt Crivitz, zwischen 2019 und 2024 verfügte sie mit Ihrer CWG-Fraktion ( Crivitzer Wählergemeinschaft) über eine absolute Mehrheit und bestimmte den finanzpolitischen Kurs der Stadt. Wer über Jahre die Finanzpolitik bestimmt, trägt auch die Verantwortung für ihre Folgen. Das Ehrenamt ist wertvoll, aber es kann keine verspäteten Abschlüsse, keine verbrannten Rücklagen und keine fehlende Liquidität und Haushaltsdisziplin erklären.
Die Lage ist eindeutig: Liquidität sinkt, Rücklagen werden aufgebraucht, Ausgaben steigen, Fördermittel sind in Gefahr. Das bedeutet: Gebühren steigen, Leistungen werden gekürzt, Investitionen bleiben aus. Die Bürger zahlen mehr – und bekommen weniger. Die Haushaltsplanung 2025 wurde nur mit einer Verbesserungsanordnung seitens der Rechtsaufsicht von über 800.000 € genehmigt, die Personalkosten steigen Richtung über 5,2 Mio. € 2025, die Rücklagen sind im Prinzip fast vollständig jetzt aktuell nahezu erschöpft. Ohne Kurswechsel verschärft sich der Trend.
Crivitz braucht jetzt einen klaren Kurswechsel: zeitnahe Jahresabschlüsse, strikte Haushaltsdisziplin, Verzicht auf den Verbrauch von Rücklagen, Priorisierung der Pflichtaufgaben, belastbare Kalkulationen in kostenintensiven Bereichen (u. a. Bauhof und Gebäudereinigung) und Transparenz gegenüber den Bürgern. Das Ehrenamt sollte konstruktiv eingebunden und wertgeschätzt werden – jedoch als Ergänzung, nicht als Ersatz für professionelle, fristgerechte und regelkonforme Haushaltsführung.
Der Jahresabschluss 2023 ist mehr als eine Bilanz – er ist ein Warnsignal. Das Defizit, die sinkende Liquidität und die nahezu aufgebrauchten Rücklagen machen deutlich, dass die finanzielle Lage der Stadt Crivitz ernst ist. Die Ausgaben bis 2025 steigen weiter, während verspätete Abschlüsse sogar den Zugang zu Fördermitteln gefährden. Ohne eine klare Kurskorrektur droht die Stadt ihre Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren einzubüßen. Jetzt braucht es transparente Zahlen, verantwortungsbewusste Entscheidungen und eine konsequente Haushaltsdisziplin. Nur so kann Crivitz die notwendige Stabilität zurückgewinnen und eine verlässliche Grundlage für die Zukunft schaffen.
Fazit:
Das eigentliche Problem liegt nicht allein in den roten Zahlen, sondern in der politischen Verantwortung: Seit Jahren werden Haushaltsabschlüsse verschleppt, Rücklagen fast aufgebraucht und steigende Kosten hingenommen. Statt klarer Steuerung und Transparenz erleben die Bürger beschwichtigende Erklärungen, die das Ehrenamt als Schutzschild vorschieben. Doch die Verantwortung liegt bei der Verwaltung und der politischen Führung, die den Kurs gesetzt hat.
Das Fazit lautet daher: Crivitz braucht keine neuen Eindrücke, sondern endlich klare Entscheidungen. Haushaltsdisziplin, zeitnahe Abschlüsse und ehrliche Kommunikation sind unverzichtbar, wenn die Stadt ihre Zukunft sichern will. Ohne diesen Kurswechsel bleibt Crivitz im Rückwärtsgang – mit steigenden Gebühren, schrumpfenden Leistungen und verlorenen Chancen.
05.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./471[163(38-22)]/CLA-307/46-2025

Bürgerbeteiligung statt Schubladenpläne: Zeit für Transparenz!
Die unendliche Geschichte des Verkehrskonzepts
Crivitz – eine Stadt und Grundzentrum der Entwicklung, die seit Jahren über ihr Verkehrskonzept spricht, ohne jemals eines zu besitzen. Was für andere Kommunen selbstverständlich ist – eine klare Planung für Mobilität, Parken, Sicherheit und Lebensqualität – bleibt hier ein Phantom. Statt eines durchdachten Konzeptes gibt es Ankündigungen, Umdeutungen, Versprechen und Streit. Die Bürger erleben eine Endlosschleife, in der Ideen auftauchen, verschwinden und wieder neu verpackt werden.
Was ist ein Verkehrskonzept – und warum braucht Crivitz endlich eins?
Ein Verkehrskonzept ist kein einzelnes Schild, keine spontane Tempo-30-Zone und auch keine Einbahnstraße, die plötzlich auftaucht. Es ist ein durchdachter Plan, mit dem eine Stadt wie Crivitz ihre Mobilität langfristig gestalten kann – für alle, die sich hier bewegen: Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Menschen mit Rollatoren, Kinder auf dem Schulweg und Pendler im Bus.
Ein gutes Verkehrskonzept beginnt mit einer gründlichen Analyse: Wie viele Fahrzeuge sind unterwegs? Wo entstehen Staus? Wo fehlen sichere Übergänge? Wie laut ist es in den Wohngebieten? Wo gibt es zu wenig Parkplätze – und wo zu viele? Fachleute zählen, messen, beobachten und sprechen mit den Menschen vor Ort. Denn nur wer weiß, wie der Verkehr wirklich funktioniert, kann ihn sinnvoll verändern.
Dann geht es um die Planung: Wo sollen Autos fahren – und wo besser nicht? Welche Straßen brauchen Tempo 30, welche sichere Radwege? Wie können Fußgänger sicher über die Straße kommen, auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen? Wo fehlen Parkplätze für Anwohner, Kunden oder Pendler – und wie kann man sie schaffen, ohne andere zu verdrängen? Ein Verkehrskonzept denkt auch an die Zukunft: Wie entwickelt sich Crivitz in den nächsten Jahren? Wo entstehen neue Wohngebiete, wo neue Gewerbeflächen? Wie kann der öffentliche Nahverkehr besser angebunden werden? Wie lassen sich Lärm und Abgase reduzieren, damit die Stadt lebenswerter wird?
Und vor allem: Ein Verkehrskonzept entsteht nicht im stillen Kämmerlein. Es braucht die Menschen, die hier leben. Bürgerinnen und Bürger müssen gefragt, gehört und ernst genommen werden. In Workshops, Umfragen oder öffentlichen Versammlungen können sie sagen, was sie brauchen – und was nicht funktioniert. Denn wer täglich durch Crivitz läuft, fährt oder radelt, weiß oft besser, wo es hakt, als jeder Ausschuss. Vor allem aber: Es ist ein Werkzeug, das Bürgerbeteiligung und Fachwissen zusammenführt, um eine Stadt lebenswerter und sicherer zu machen.
Doch in Crivitz fehlt genau das. Stattdessen erleben die Bürger seit Jahren eine Abfolge von Versprechen und Vertagungen.
Chronologie der Versprechen und Vertagungen
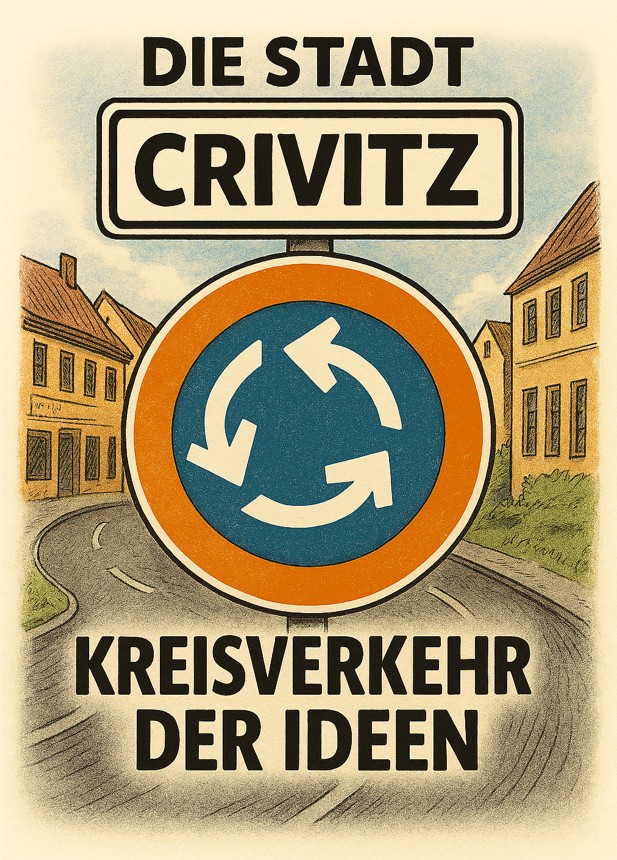
Die Sitzung des Bauausschusses am im September 2025
An diesem Tag sollte endlich über das Verkehrskonzept beraten werden. Doch die Sitzung wurde zum Sinnbild der Misere. Herr Andreas Rüß ( CWG- Crivitz), der 2021 den entscheidenden Änderungsantrag stellte, war diesmal nicht Teil der Sitzung. Seine Rolle bleibt dennoch zentral: Er war es, der das Parkraumkonzept in ein Verkehrskonzept integrierte und verwandelte – ein Schritt, der großspurig wirkte, aber bis heute ohne Substanz blieb. Herr Alexander Gamm ( CWG – Crivitz), Bauausschußmitglied, Ehemann der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, fiel weniger durch Fachbeiträge als durch verbale Ausfälle auf. Zeugenaussagen berichten von Beschimpfungen gegenüber Ausschussmitgliedern und Bürgern. Statt Sachlichkeit dominierten persönliche Angriffe.
Herr Michael Renker, Vorsitzender des Bauausschusses, war der einzige, der überhaupt konkrete Vorstellungen vortrug. Er sprach von Tempo-30-Zonen, von Einbahnstraßenregelungen, von Parktaschen in der Eichholzstraße. Er präsentierte eine Flurkarte – notdürftig, aber immerhin es ist ein Ansatz. Doch auch seine Vorschläge blieben Stückwerk: Ersatzparkplätze auf dem alten SPAR-Markt, sollten halb vermietet, halb zeitlich begrenzt werden, sollten die wegfallenden Stellplätze am Marktplatz kompensieren. Eine Rechnung, die nicht aufgeht.
Welche Vorstellungen existieren?
Die Bürger müssen wissen, was überhaupt diskutiert wird:
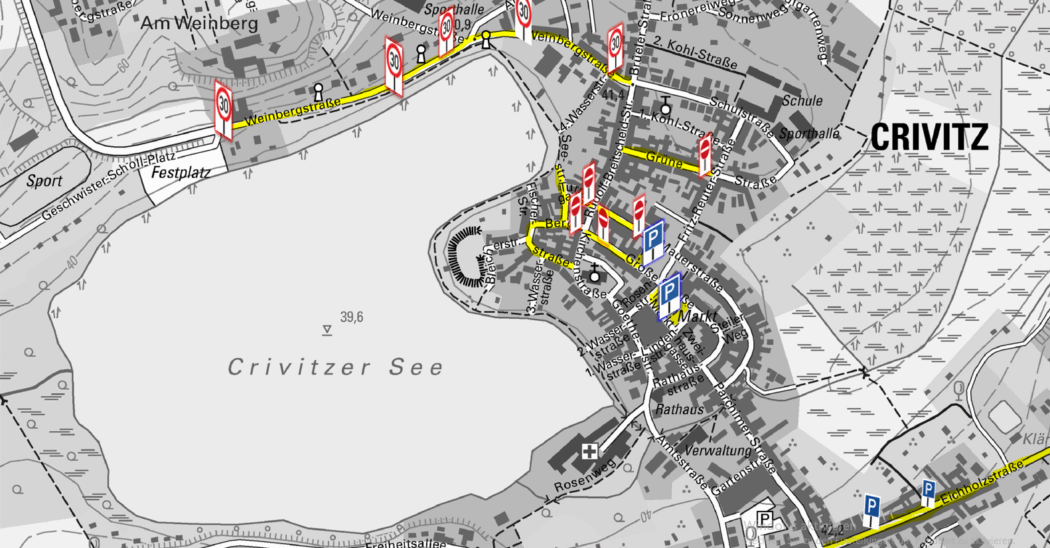
Seit Jahren erleben die Bürger das Gleiche: Es gibt keine Unterlagen, keine Karten, keine Pläne. Alles bleibt hinter verschlossenen Türen – die Öffentlichkeit erfährt nur Bruchstücke. Auch diesmal veröffentlichte der Bauausschuss der Stadt Crivitz keinerlei Material zu den Planungen, weder Karten noch erläuternde Hinweise. Die Stadtspitze hüllt sich weiterhin in Schweigen und hält die Details im Verborgenen.Trotz dieser Informationslücke hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Sie reagierte auf die mündlichen Darstellungen in der Sitzung und machte ihre Kritik öffentlich. Damit wurde deutlich: Auch ohne offizielle Informationen sind die Menschen aufmerksam und bereit, sich einzubringen. Die Initiative zeigt, dass Transparenz und Beteiligung eingefordert werden – selbst dann, wenn die Verwaltung keine Unterlagen bereitstellt.
Ein Konzept, das keines ist!
All diese Vorstellungen zeigen: Es gibt keine Gesamtschau, kein durchdachtes Konzept. Stattdessen Stückwerk, Umdeutungen, politische Manöver und Streit. Die Bürger erleben eine Endlosschleife, in der Ideen auftauchen und verschwinden, ohne jemals zu einem echten Plan zu werden. Ein Verkehrskonzept ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es ist Zeit, dass Crivitz endlich den Schritt wagt: mit Fachplanern, mit Bürgerbeteiligung, mit Mut zur Veränderung. Die Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, welche Vorstellungen existieren – und ein Recht darauf, dass diese Vorstellungen endlich in ein echtes Konzept münden.

Fazit:
Das Fazit aus dieser langen und widersprüchlichen Geschichte ist klar und zugleich ernüchternd: Crivitz hat über Jahre hinweg gezeigt, wie man ein Thema endlos diskutieren, vertagen und umdeuten kann, ohne jemals zu einer echten Lösung zu gelangen. Aus einem Parkraumkonzept wurde ein Verkehrskonzept, aus Versprechen wurden Vertagungen, aus Bürgeranliegen wurden Proteste – doch ein durchdachter Plan existiert bis heute nicht.
Die zentrale Erkenntnis lautet: ohne externe Fachplanung, ohne echte Bürgerbeteiligung und ohne politische Kultur des Respekts wird Crivitz weiter im Kreisverkehr der Ideen stecken bleiben.Die bisherigen Vorstellungen – Einbahnstraßen, Tempo-30-Zonen, Ersatzparkplätze – sind Stückwerk, das mehr Konflikte schafft als löst.
Die unendliche Geschichte muss ein Ende haben. Crivitz braucht endlich ein echtes Verkehrskonzept – nicht als Schlagwort, sondern als verbindlichen, fachlich fundierten und bürgernahen Plan.
03.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./470[163(38-22)]/CLA-306/45-2025
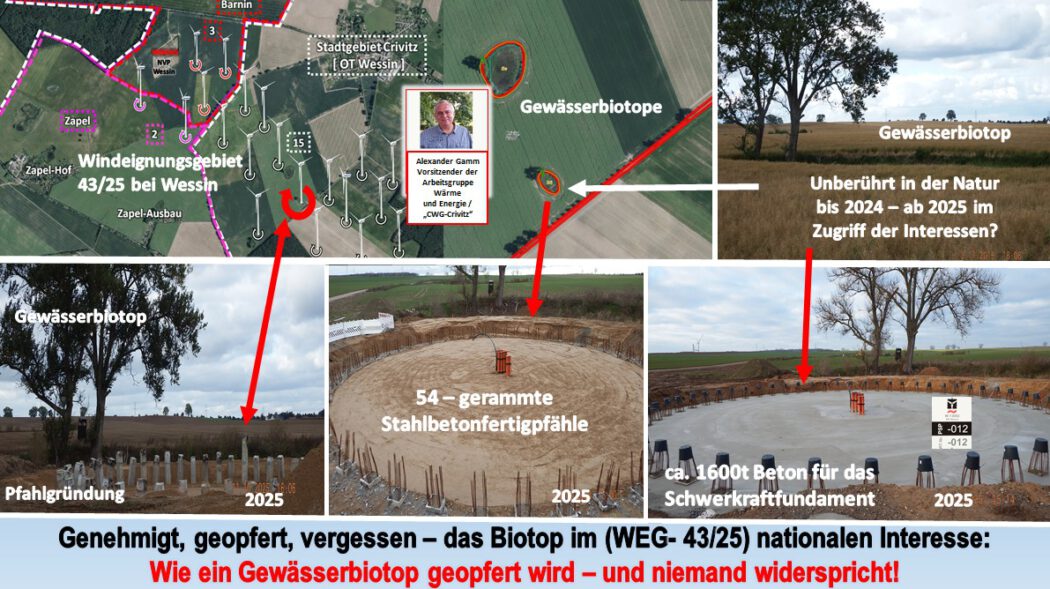
Windeignungsgebiet 43/25 – ein Konflikt zwischen Klimazielen und Lebensräumen


Zwischen den sanften Hügeln und den wasserreichen Senken des Crivitzer Ortsteils Wessin liegt ein Gewässerbiotop, das über Jahrzehnte hinweg ein Rückzugsraum für Vögel, Amphibien und Schlafplatz für Rotmilane und andere Großvögel sowie seltene Pflanzen war. Wessin ist mehr als nur ein Ortsteil von Crivitz. Es ist eine Landschaft, die seit Jahren als Rastplatz für Zugvögel dient und Nahrungshabitate für viele Großvögel darstellt deren Bedeutung weit über die Region hinausreicht.



Hier finden sich die großen Trupps der Kraniche, die im Herbst und Frühjahr majestätisch über die Felder ziehen und in Scharen zu hunderten auf den Wiesen niedergehen. Störche haben ihre Horste in der Nähe, Großvögel brüten in den geschützten Bereichen, und die Vielfalt der Arten macht Wessin zu einem lebendigen Naturraum, der jedes Jahr aufs Neue seine Rolle im großen Kreislauf der Vogelwanderungen erfüllt.





Doch dieses Biotop steht nun vor seiner endgültigen Transformation – nicht durch natürliche Prozesse, sondern durch den Druck der Energiewende und die Berechenbarkeit politischer Entscheidungen.
Ab 2025 soll hier das Windeignungsgebiet 43/25 entstehen. 16 bis 20 Windräder sind geplant, jedes von ihnen ein technisches Monument bis zu einer Höhe von 230m, das auf einem Fundament aus bis zu 1.700 Tonnen Beton und hunderten Tonnen Stahl ruht.


Pfahlgründungen werden den Boden durchbohren, Zufahrtswege die Landschaft zerschneiden, und das Biotop, das bislang als lebendiger Organismus existierte, wird zu einem „Betonbiotop“ degradiert – ein Sinnbild für die Rücksichtslosigkeit, mit der Natur geopfert wird, wenn nationale Energieziele und kommunale Einnahmen für die klamme Stadtkasse auf dem Spiel stehen.




Die Stadt Crivitz hat lange versucht, sich gegen diese Entwicklung zu stemmen. Es gab Veränderungssperren, eigene Planungen, Widersprüche gegen die Unterlagen des Investors. Doch mit den neuen Bundesgesetzen – dem Windenergieflächenbedarfsgesetz, den EEG-Novellen – wurde die kommunale Selbstbestimmung entwertet. Heute präsentiert sich die Stadt Crivitz und ihre Bürgermeisterin Frau Britta Brusch- Gamm (CWG-Crivitz) als pragmatischer Mitspieler, der die Realität akzeptiert: Einnahmen aus Windkraft sollen die klammen Stadtkasse füllen und den maroden Haushalt sanieren, auch wenn dafür Natur unwiederbringlich verloren geht.

Besonders sichtbar wird diese Haltung in der Person von Alexander Gamm auch als Paul Hermann in Facebook aktiv. Als ehemaliger Bauausschussvorsitzender und heutiger CWG – Fraktionär und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie ist er zum Gesicht dieser Entwicklung geworden. Unter seiner Führung hat Stadt Crivitz den Kurs gewechselt – weg von der Verteidigung der Natur, hin zur Suche nach finanziellen Vorteilen. Alexander Gamm spricht von Konzepten für Wärme und Energie, von Kooperationen mit der WEMAG, von Beteiligungsmodellen für Bürger.
Besonders finden sich im Genehmigungsbescheid selbst: Dort finden sich Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen, die den Eingriff in Biotope und den Schutz von Arten rechtlich absichern sollen – und zugleich zeigen, wie weit staatliche Stellen bereit sind, Kompromisse zu machen. So wird festgehalten, dass bestimmte Biotope zwar grundsätzlich unter Schutz stehen, aber im „überragenden öffentlichen Interesse“ der Energieversorgung eine Ausnahme zulässig ist. Mit juristischen Formeln wie „keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen“ oder „Abwägung im Rahmen der Raumordnung“ wird die Zerstörung von Lebensräumen legitimiert. Selbst streng geschützte Bereiche werden durch Auflagen wie Ersatzmaßnahmen oder Monitoring scheinbar ausgeglichen, obwohl jeder weiß, dass ein zerstörtes Gewässerbiotop nicht einfach ersetzt werden kann. Diese Ausnahmeentscheidungen sind der stille Beweis dafür, dass der Naturschutz längst zur Verhandlungsmasse geworden ist – ein Hindernis, das man mit Paragraphen überwindet, statt ein Wert, den man schützt.
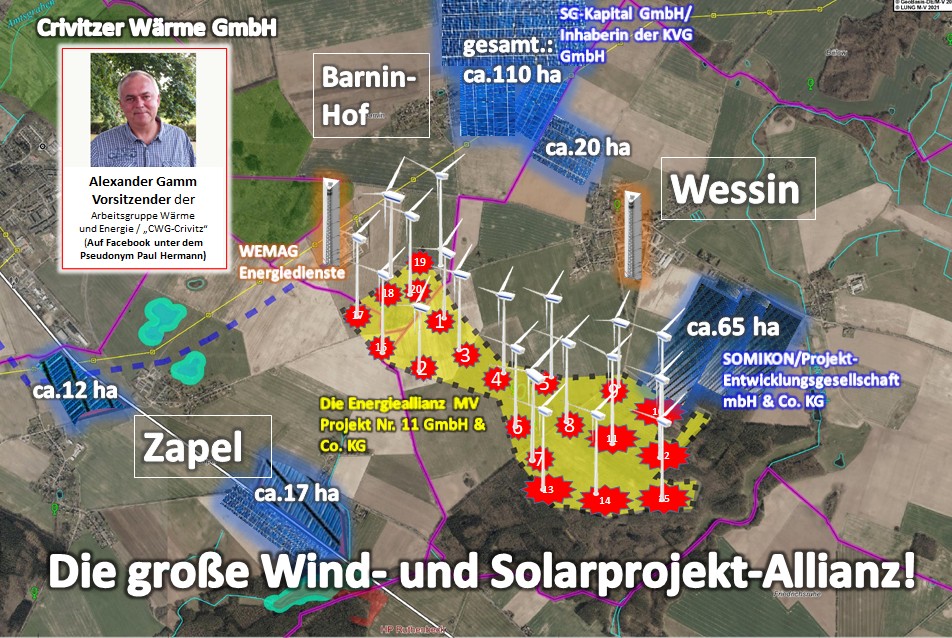
Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, sondern Teil einer größeren Dynamik. Der NABU-Bundesverband warnt eindringlich vor den Folgen der Umsetzung der europäischen Richtlinie REDIII in deutsches Recht. Umweltprüfungen wie die UVP oder artenschutzrechtliche Bewertungen werden in sogenannten Beschleunigungsgebieten abgeschafft. Schutzgebiete wie Natura 2000 oder Vogelzugkorridore sind nicht ausreichend ausgeschlossen. Öffentlichkeitsbeteiligung wird reduziert, während die Belastung vor Ort steigt. Die Folge: Rechtsunsicherheit, Akzeptanzverlust und eine Energiewende, die auf Kosten der Biodiversität beschleunigt wird. NABU fordert, dass vorbelastete Flächen – Dächer, Industrieareale, Parkplätze – Vorrang haben müssen. Doch in Wessin wird stattdessen ein intaktes Biotop geopfert.


Die Bürger sehen, wie ihre Landschaft verschwindet, wie Natur geopfert wird, wie Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden. Sie erleben die Ohnmacht einer Kommune, die zwar protestiert, aber am Ende doch berechenbar ist: Wer zahlt, bestimmt. Die Investoren liefern Einnahmen, die Stadt Crivitz liefert Flächen. Das Gewässerbiotop in Wessin wird so zum Bauernopfer – ein Opfer im nationalen Interesse der Energiegewinnung und zugleich ein Opfer im kommunalen Interesse, Einnahmen zu generieren.
Die Natur und Tierwelt zählen zu den größten Verlierern dieser Entwicklung. Vögel und Fledermäuse verlieren ihre Rast- und Zuggebiete, Amphibien und Insekten ihre Lebensräume. Böden und Gewässer werden durch Betonfundamente und Pfahlgründungen dauerhaft verändert. Ein Fundament für ein einziges Windrad bedeutet: 1.000 bis 1.700 Tonnen Beton, 400 bis 700 Kubikmeter Transportbeton, 54 Stahlbetonpfähle tief im Boden. Die schiere Masse dieser Bauwerke zeigt, wie radikal die Eingriffe sind – und wie endgültig die Transformation vom Gewässerbiotop zum Betonbiotop.


Doch hinter dieser technischen und ökologischen Dimension steht eine politische und gesellschaftliche Wahrheit: Die Energiewende wird als „grün“ verkauft, doch sie ist oft eine Naturwende – vom Biotop zum Beton. Klimaziele werden gegen Naturschutz ausgespielt, Einnahmen gegen Artenvielfalt, Beton gegen lebendige Ökosysteme. Die Stadt Crivitz, die Bürger, die Tiere – sie alle sind Teil eines Spiels, dessen Regeln längst nicht mehr vor Ort geschrieben werden.
Fazit:
Am Ende bleibt die ernüchternde Wahrheit: Das Gewässerbiotop in Wessin wird nicht nur durch Betonfundamente und Zufahrtswege zerstört, sondern auch durch die Ausnahmegenehmigungen im Immissionsbescheid, die den Eingriff in geschützte Natur rechtlich absichern. Was als „überragendes öffentliches Interesse“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein staatlich vorgegebener Kompromiss, bei dem der Naturschutz zur Fußnote degradiert wird. Die Stadt Crivitz nimmt diese Opfer in Kauf, um möglicherweise kleinere Einnahmen zu erzielen, und die Bürger erleben, wie ihre Landschaft verschwindet, während ihre Stimme kaum Gewicht hat.
Das Fazit ist klar: Die Energiewende darf nicht zur Naturwende werden – doch in Wessin zeigt sich, wie schnell Klimaziele gegen Artenvielfalt ausgespielt werden und wie leicht Biotope zu Bauernopfern werden, wenn Politik und Interessengruppen gemeinsame Sache machen.
01.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./469[163(38-22)]/CLA-305/44-2025

Die Crivitzer Parkplatz-Geschichte – Von kleinen Zahlen zu großen Fragen!
Es begann unscheinbar, fast beiläufig: Im Jahr 2018 tauchte die Idee auf, auf dem Gelände des alten Sparmarktes einen Ausweichparkplatz zu schaffen. Die Kosten sollten überschaubar sein – gerade einmal 11.900 €. Ein Betrag, der in den Haushaltsplänen kaum auffiel, aber doch Hoffnung weckte: Endlich eine Lösung für die angespannte Parksituation in der Innenstadt, endlich eine Perspektive, den Marktplatz von Autos zu befreien und ihn wieder als Ort der Begegnung zu nutzen.

Doch wie so oft in der Kommunalpolitik wuchs das Projekt mit den Jahren – und mit ihm die Kosten. Aus dem vermeintlichen Schnäppchen wurde ein Prestigeprojekt: 26 Stellplätze für ca. 156.000 €, also stolze ca. 6.000 € pro Stück. Die Fläche wurde beräumt, ein Architekturbüro plante für weitere 25.000€, und schließlich entstand eine neue Parkplatzanlage, die nun als „Ausgleichsparkplätze“ firmiert. Auch die Grundstücksgeschichte selbst ist bemerkenswert: 2022 wurden Teilflächen des alten Sparmarktes verkauft – insgesamt rund 738 Quadratmeter für 40.700 Euro. Gleichzeitig genehmigte die Stadt eine Grundschuld über 1,8 Millionen Euro für den Erwerber. Der Rest der Fläche blieb in städtischer Hand und wurde für die neuen Parkplätze genutzt.

Doch die Logik dieser Ausgleichsflächen ist ebenso kompliziert wie die Geschichte selbst. Von den 26 Plätzen sollen 13 dauerhaft vermietet werden, die anderen 13 nur für maximal zwei Stunden frei nutzbar sein – im Jahr 2026. Damit sollen die 32 Stellplätze auf dem Marktplatz kompensiert werden, die künftig wegfallen sollen. Doch schon die einfache Rechnung zeigt: Ersatz, der zur Hälfte gleich wieder privatisiert wird, ist kein wirklicher Ersatz. Und außerdem fehlen immer noch sechs Stellplätze. Aus dem „Ausgleich“ wurde ein handfestes Ungleichgewicht.


Die Diskussion darüber wurde im September 2025 erneut entfacht. Ein Antrag zur Widernutzung des Marktplatzes brachte das Thema zurück auf die Tagesordnung. Die CWG-Fraktion, die den Platz als Ruhezone und Ort der Begegnung versprochen hatte, musste erklären, warum die Ersatzfläche nicht ausreicht. Der Bauausschuss tagte auch unter Losung zu diesem Thema „10 Jahre Parkplatz auf dem Marktplatz“ – und stellte fest, dass die Dauervermietung zwar Einnahmen bringt, aber die öffentliche Nutzbarkeit einschränkt.
Ein Verkehrs- und Parkraumkonzept? Fehlanzeige. Seit über einem Jahrzehnt wurde keines erarbeitet. Stattdessen wurden punktuelle Maßnahmen in den vergangenen Jahren wie verlängerte Parkzeiten in einzelnen Straßen umgesetzt – ohne strategischen Zusammenhang.

Die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch – Gamm ( CWG – Crivitz) bestätigte im Juni 2025 die Freigabe der neuen Parkplatzanlage – vorerst kostenlos. Doch die Möglichkeit von Gebühren oder Zeitbegrenzungen bleibt offen. Parallel dazu kündigte sie Gespräche mit dem Ordnungsamt über Tempo-30-Zonen an – ein weiteres Thema, das bislang ohne klare Linie behandelt wurde.
Und so steht Crivitz heute vor einem Dilemma: Der Wunsch nach einem autofreien Marktplatz kollidiert mit der Realität einer Innenstadt, die auf Parkplätze angewiesen ist. Die Ersatzfläche ist da – aber nur zur Hälfte nutzbar. Die Bürger fragen sich: War das wirklich die Lösung? Oder nur ein teures Symbol?

Fazit mit Kopfschütteln: Ausgleich, der keiner ist!
Manchmal erzählt eine Zahl mehr als tausend Worte. 26 neue Parkplätze für ca. 156.000€ – das klingt nach einer Lösung für die Innenstadt. Doch wenn davon 13 gleich wieder dauerhaft vermietet werden, bleibt die Hälfte der Stellflächen für die Öffentlichkeit übrig. Und damit fehlen immer noch sechs, um die 32 Plätze des Marktplatzes zu ersetzen.
Was als „Ausgleich“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein Ungleichgewicht. Die Stadt hat viel Geld investiert, doch die eigentliche Frage bleibt unbeantwortet: Wie soll die Innenstadt künftig funktionieren, wenn der Marktplatz autofrei wird und die Ersatzflächen nicht ausreichen?Statt Klarheit gibt es neue Arbeitskreise, neue Diskussionen und neue Kompromisse. Für die Bürger bedeutet das: Sie zahlen mit Steuern für Parkplätze, die sie am Ende gar nicht nutzen können. Für die Politik bedeutet es: Sie muss erklären, warum ein Ausgleich am Ende keiner ist.
Die Crivitzer Parkplatzgeschichte ist damit mehr als eine Debatte über Stellplätze. Sie ist ein Symbol für kommunale Entscheidungsprozesse, die sich im Kreis drehen. Und sie zeigt, wie schnell aus einem Versprechen ein Kopfschütteln wird.
29.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./468[163(38-22)]/CLA-304/43-2025

In Crivitz wird derzeit ein Schauspiel inszeniert, das den Titel „Wärmeplanung“ trägt. Die Bühne gehört der Stadtvertretung, die Regie führt Alexander Gamm, und die Bürger dürfen – wenn überhaupt – als Statisten am Rand stehen. Transparenz? Ein Fremdwort. Beteiligung? Ein Gnadenakt.
Bereits im Oktober 2024 wurde ein „Letter of Intent“ mit der WEMAG unterzeichnet – ein Vorvertrag, der die Gründung der Crivitzer Wärme-GmbH besiegelte. Verpflichtungen, Risiken, Kosten? Alles fein säuberlich geregelt, nur eben nicht für die Öffentlichkeit. Die Bürger erfuhren davon erst später, in einer Veranstaltung, bei der Alexander Gamm als „Sachverständiger“ die Eckpunkte in atemberaubendem Tempo präsentierte. Ein wahrer Gnadenakt: immerhin durften sie hören, was längst beschlossen war.
Doch damit nicht genug. In der Einwohnerfragestunde am 27. Oktober 2025 erklärte Herr Gamm: „Wir gehen erst dann an die Öffentlichkeit, wenn gesicherte Informationen vorliegen. Und außerdem ist noch nicht klar, wie die Fernwärme kommt und zu welchem Preis.“ Eine Aussage, die weniger nach Offenheit klingt, sondern vielmehr nach einer eleganten Begründung für fortgesetzte Geheimverhandlungen. Der Bürger soll erst dann miteinbezogen werden, wenn alles fertig ist – wenn Verträge unterschrieben, Gesellschaften gegründet und Anteile verteilt sind. Eine bemerkenswert kuriose Herangehensweise an ein Projekt, das die gesamte Stadt betrifft.
Besonders pikant sind die Beteiligungsverhältnisse: Bei der Crivitzer Wärme-GmbH wurde am Ende ein 50:50-Modell mit der WEMAG präsentiert – die Stadt Crivitz und die WEMAG gleichberechtigt, zumindest auf dem Papier. Doch beim Windgebiet Crivitz West (Krudopp) sieht es anders aus: Dort heißt es angeblich 40:60 – mit 60 % für die WEMAG und nur 40 % für die Stadt. Wo also bleibt die kommunale Kontrolle? Die Bürger erfahren es nicht. Sie dürfen bestenfalls irgendwann im Nachhinein lesen, dass Gesellschaften gegründet wurden – mit kommunalem Anteil, aber ohne echte Mitsprache.
In der Crivitzer Neustadt soll ein Heizhaus entstehen, ausgestattet mit Hochleistungswärmepumpen. Klingt modern, klingt nachhaltig – wenn man die Details kennen würde. Ein „Referenzkunde“ aus Schleswig-Holstein soll die Wirtschaftlichkeit sichern. Die übrigen Crivitzer Bürger? Vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Biogas fällt aus, Diesel und Gas stehen zur Debatte – Lösungen, die nicht unbedingt dem Ideal einer nachhaltigen Wärmewende entsprechen. Aber wer fragt schon nach, wenn die Antworten ohnehin im Geheimen bleiben.
Und hier zeigt sich der eigentliche Widerspruch: Während die Stadt Crivitz ihre Sitzungen lieber nichtöffentlich abhält und Einladungen exklusiv verteilt, zeigt das Amt Crivitz mit seiner Klimamanagerin, wie echte Beteiligung aussieht. In ihrer Einladung heißt es: „Alle Interessierten sind eingeladen, das Klimaschutz-Konzept aktiv mitzugestalten.“ Und weiter: „Ziel des Workshops ist es, praktikable Klimaschutz-Ideen zu finden in den Bereichen, in denen die Bürger viel Einfluss haben oder hoch betroffen sind.“
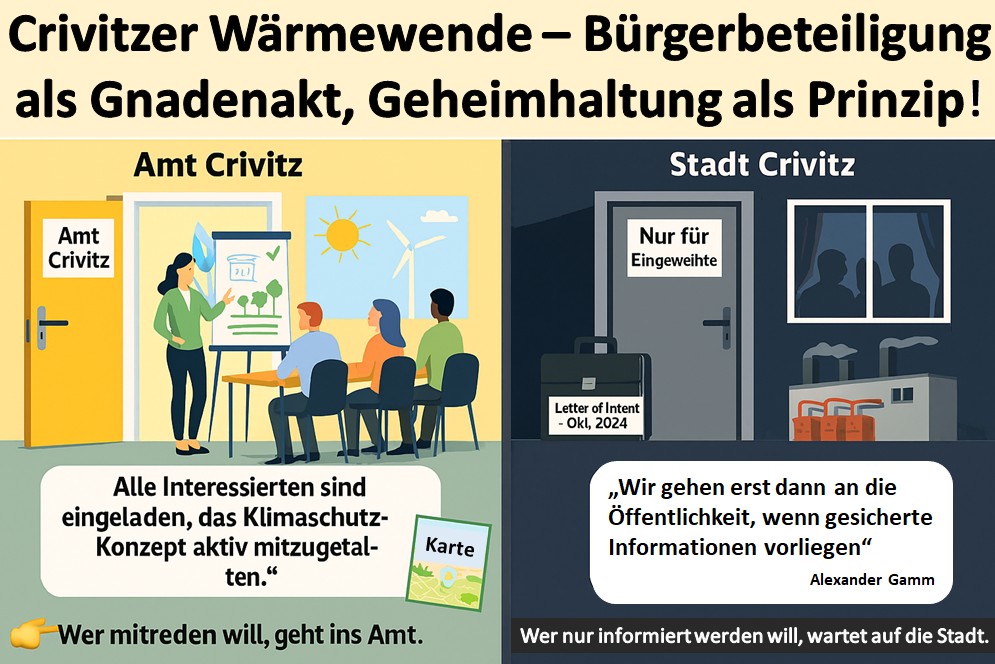
Das Amt organisiert Workshops am 2. Dezember in Crivitz und am 3. Dezember in Banzkow, jeweils mit Vorträgen von Energieberatern, Thementischen zu erneuerbaren Energien, Mobilität und privaten Haushalten sowie einem Infotisch mit Material zum Mitnehmen. Dazu eine Online-Ideenkarte, die bis Ende Januar zugänglich ist – ohne Anmeldung, für alle Bürger offen. Transparenz als Prinzip, nicht als Ausnahme.
Und mit im Zentrum des Geschehens in der Stadt Crivitz: Alexander Gamm – auf Facebook auch unter dem Namen Paul Hermann unterwegs. Mal tritt er als Bauausschussmitglied der Stadt Crivitz auf, mal als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, mal als CWG-Fraktionsmann, mal als Ehemann der Bürgermeisterin. Doch egal in welcher Rolle: die Fäden laufen stets bei ihm zusammen. Er ist es, der die vertraulichen Treffen mit der WEMAG mit vorbereitet, die Abläufe organisiert und schließlich als „Experte“ vor die Öffentlichkeit tritt – allerdings nur, um ausgewählte Informationen in wohl dosierten Häppchen zu servieren. Bürgerbeteiligung? Ja, aber nur solange sie nicht stört und die Regie im Hintergrund ungestört bleibt.
Fazit:
Die Crivitzer Wärme-GmbH, das Windgebiet Ost, das Heizhaus in der Neustadt – all das sind Projekte, die unsere Zukunft bestimmen. Doch während das Amt Crivitz die Bürger einlädt, Ideen zu entwickeln und mitzudiskutieren, setzt die Stadt Crivitz weiter auf Geheimhaltung. Transparenz wird als Gnadenakt verkauft, Beteiligung als Pflichtübung.
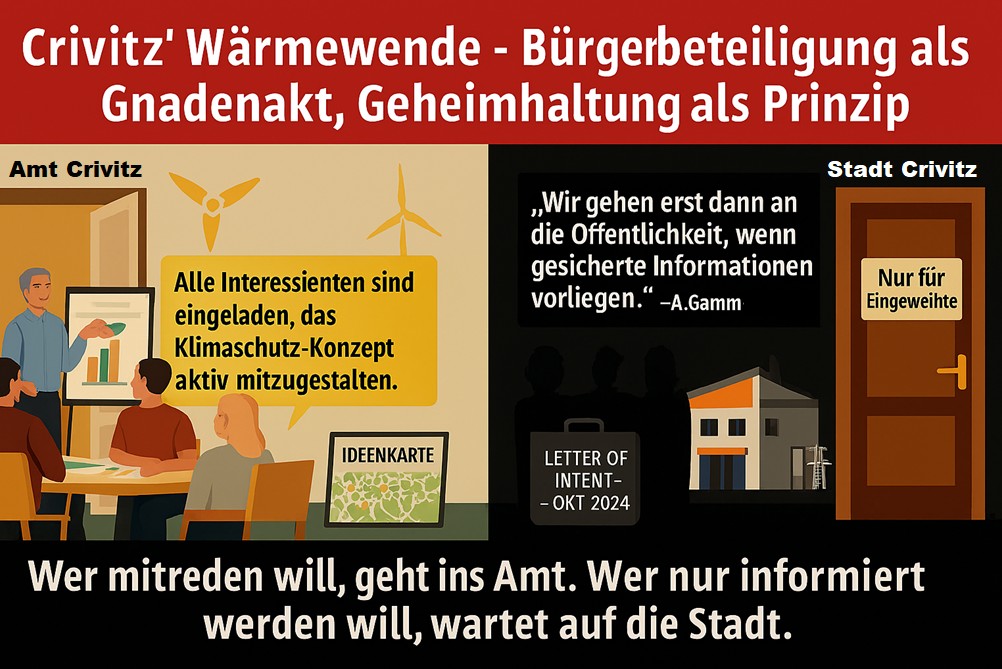
Ironisch gesagt: Crivitz erfindet die Demokratie neu – als exklusives Insider-Spiel. Wer wirklich mitreden will, muss ins Amt gehen. Wer nur informiert werden will, darf auf die Stadt warten.
14.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./467[163(38-22)]/CLA-303/42-2025
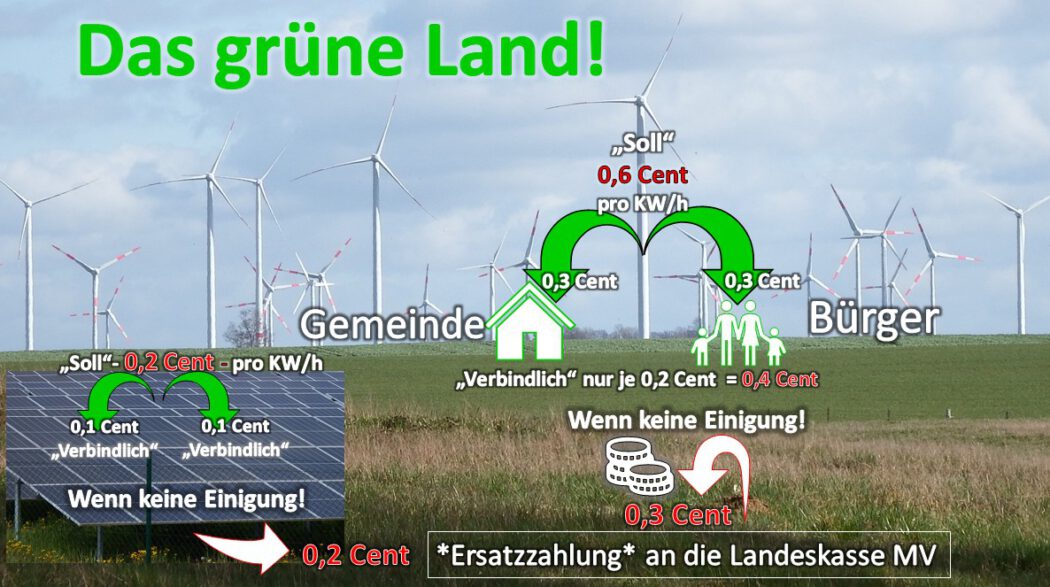
Akzeptanz durch Beteiligung? Der neue Entwurf im Check!
Die SPD- und Linke-geführte Landesregierung von MV hat einen neuen Entwurf des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes (BüGembeteilG M-V) vorgelegt. Es soll die Menschen stärker am Ausbau von Wind- und Solarenergie beteiligen und gleichzeitig die Akzeptanz für neue Anlagen erhöhen. Auf dem Papier klingt das nach Fortschritt – doch wer genauer liest, erkennt schnell: Die Beteiligung bleibt kompliziert, unverbindlich und für die Bürger meist nur ein Versprechen.
Der Wirtschaftsminister Herr Minister Dr. Wolfgang Blank präsentierte den Entwurf mit Nachdruck:
„Wind und Sonne: Wer profitiert wirklich?“
Was steht im Gesetzentwurf?
Im sogenannten Standardmodell für Windräder sollen Gemeinden 0,3 Cent pro Kilowattstunde erhalten und die Bürger ebenfalls 0,3 Cent – zusammen also 0,6 Cent. Das ist die Zahl, mit der die Landesregierung wirbt. Allerdings handelt es sich nur um eine Soll-Regelung. Verbindlich ist lediglich eine Beteiligung von 0,2 Cent für die Gemeinde und 0,2 Cent für die Bürger.

Bei Solarparks sind die Beträge noch kleiner: jeweils 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Gemeinde und Bürger. Gemeinden können außerdem statt Zahlungen auch Anteile an Anlagen erwerben oder ganze Anlagen kaufen – eine Option, die in der Praxis wohl nur selten genutzt wird.

Wie laufen die Verhandlungen?
Bei Windrädern: Alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern müssen einbezogen werden. Bei Solarparks: Nur die Standortgemeinde ist beteiligt. Wenn mehrere Gemeinden betroffen sind, müssen sie sich auf eine gemeinsame Verhandlungsführung einigen. Tun sie das nicht, übernimmt automatisch das zuständige Amt.
Kommt keine Einigung zustande, greift die Ersatzzahlung:
Das Geld fließt nicht direkt an die Gemeinde, sondern in ein Sondervermögen des Landes und wird im jeweiligen Landkreis für „akzeptanzsteigernde Maßnahmen“ verwendet. Die Gemeinde hat keinen direkten Zugriff, sie kann lediglich Anträge stellen. Für die Bürger bedeutet das: Sie bleiben außen vor, es sei denn, ihre Gemeinde hat zuvor eine Vereinbarung mit dem Betreiber getroffen.
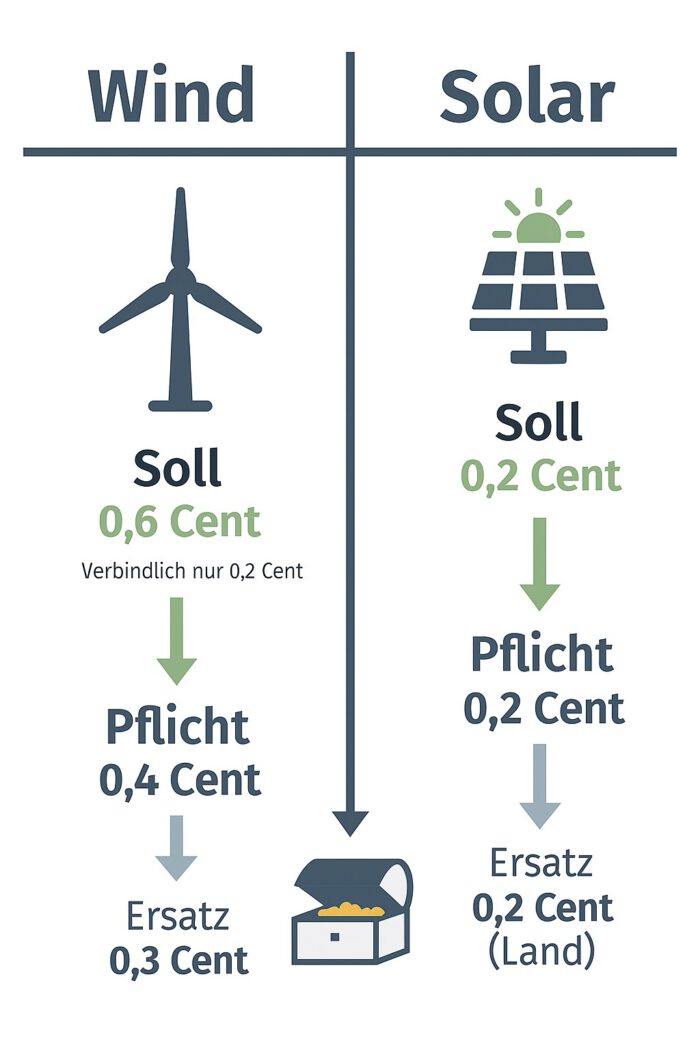
Die Kernfrage: Bleibt der Bürger außen vor?
Kritik der Opposition
Die Opposition spart nicht mit deutlichen Worten:
Was heißt das für die Bürger?
Für die Menschen vor Ort bleibt die Beteiligung nach dem jetzigen Entwurf des Gesetzes unsicher. Wenn eine Vereinbarung zustande kommt, können kleine Beträge auf der Stromrechnung oder Direktzahlungen fließen – spürbar, aber meist überschaubar. Wenn die Verhandlungen scheitern, landet das Geld beim Land, der Landkreis entscheidet über die Verwendung, und der Bürger sieht davon nichts direkt.
Ironisch gesagt: Die Windräder drehen sich vor der Haustür, die Beteiligung dreht sich um Verhandlungen – und wenn die scheitern, dreht sich das Geld Richtung Landeskasse.
Nachtrag:
Windeignungsgebiet – 43/25 bei Crivitz (OT-Wessin) – Fristen verstrichen, Beteiligung verpufft?
Nach dem jetzigen Entwurf des Bürgerbeteiligungsgesetzes 2.0 gilt eine klare Regel: Innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung einer Anlage müssen Betreiber und Gemeinden eine Beteiligungsvereinbarung schließen. Bei Windrädern sind alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern beteiligt, bei Solarparks nur die Standortgemeinde. Kommt keine Einigung zustande, greift die Ersatzzahlung an das Land, die in ein Sondervermögen fließt und über den Landkreis verteilt wird – nach einem gestellten ANTRAG der Gemeinde- Bürger profitieren dann nicht direkt.
Im Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin, wo bis zu 20 Windräder entstehen sollen, ist diese Frist jedoch schon Geschichte. Die Genehmigung wurde am 4. Oktober 2024 erteilt, die Öffentlichkeit erfuhr davon erst im Februar 2025. Selbst wenn das Gesetz im Dezember 2025 beschlossen wird, wäre die Frist längst verstrichen – ironisch gesagt: die Beteiligung ist schon verfrühstückt, bevor das Gesetz überhaupt gilt.
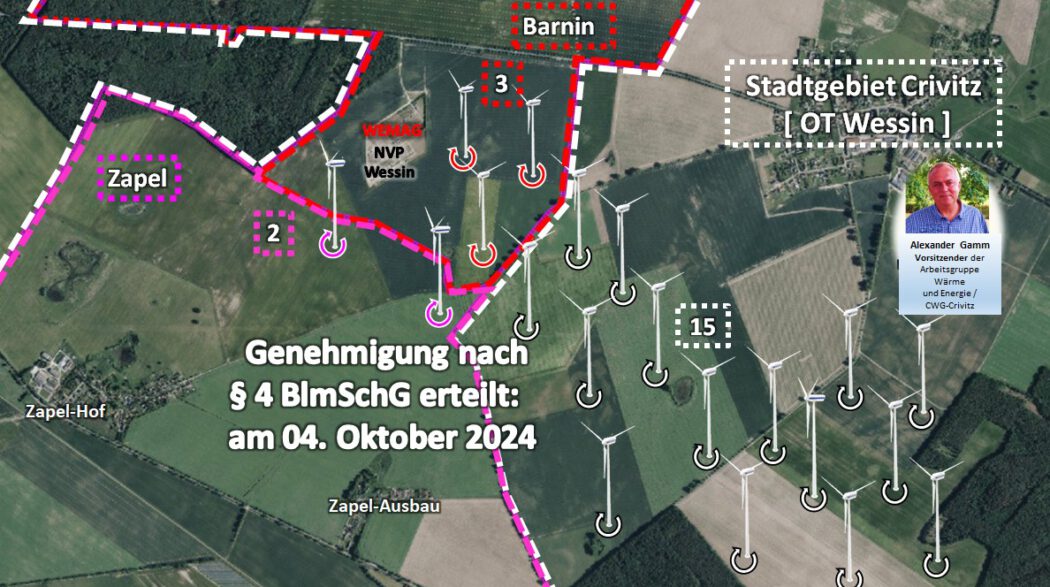
Hinzu kommt: Bereits rund 60 % der Fundamente für die 20 Windenergieanlagen sind fertiggestellt. Es wird also längst aktiv gebaut, während die Beteiligungsdebatte noch auf dem Papier geführt wird. Die Bürgermeisterin von Crivitz, Britta Brusch-Gamm, stellte am 17. März 2025 im Bericht zu wichtigen Angelegenheiten klar: „Bis zum heutigen Tag haben keine Gespräche mit dem Bauherrn stattgefunden.“ Damit ist deutlich: Verhandlungen sind nicht nur gescheitert, sie haben faktisch gar nicht stattgefunden.
Besonders bemerkenswert ist ihre politische Stellungnahme aus Juli 2024 an den regionalen Planungsverband Westmecklenburg, als die Stadt Crivitz noch große Pläne hatte: „Wir würden gern, im Rahmen des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV, aus Mangel an eigener Fläche in diesem Gebiet, ein ‚physisches‘ Windrad haben wollen – weil 20 % Beteiligung deutlich mehr als ein einzelnes Windrad wären und damit der vernünftige Nutzen für unsere Gemeinde gleichzeitig ein wesentlich besserer wäre.“ Damals wollte man noch groß einsteigen. Heute stellt sich die Frage: Ist das alles nur Luft – oder bezieht sich diese Vision inzwischen auf das Gebiet Crivitz-Ost bei Krudopp, das aktuell im Bauausschuss heiß diskutiert werden soll?
Und doch gab es Kontakt: Am 7. April 2025 beschloss die Stadtvertretung Crivitz einen Nutzungsvertrag mit der Energieallianz MV Projekt Nr. 11 GmbH & Co. KG – für Wege, Leitungen und Kranstellplätze. Einnahmen winken, aber von echter Bürgerbeteiligung bleibt nichts übrig. Für Crivitz bedeutet das: erst einmal leer ausgehen. Wahrscheinlich läuft es auf eine Ersatzzahlung an das Land hinaus, über die der Landkreis entscheidet. Ob die Nachbargemeinden Zapel und Barnin im Stillen verhandeln, ist unklar. Bekannt ist nur, dass sie ihre eigenen Energieparkpläne schon 2024 zurückgezogen haben und einst gemeinsam mit Crivitz (Ortsteil Wessin) auftreten wollten – eine Bekundung, die inzwischen zwölf Monate alt ist.
So bleibt die ironische Pointe: Während die Windräder schon gebaut werden – sind die Fristen für die Bürgerbeteiligung längst vorbei, oder etwa nicht? Für Wessin ist das Gesetz damit nur noch ein Kapitel im Lehrbuch der verpassten Chancen.
Fazit:
Der Entwurf des Bürgerbeteiligungsgesetz 2.0 verspricht Teilhabe, liefert aber vor allem komplizierte Soll-Regeln. Die groß angekündigten 0,6 Cent pro Kilowattstunde sind eher ein politisches Schaufenster als ein verbindlicher Anspruch. In der Praxis bleibt nur die Pflicht zu 0,2 Cent – ein Betrag, der kaum Begeisterung weckt.
Scheitern die Verhandlungen, fließt das Geld als Ersatzzahlung ins Land, nicht in die Gemeindekasse. Damit bleibt der Bürger Zuschauer, während Betreiber und Verwaltung die eigentlichen Akteure sind. Am Ende ist es weniger Beteiligung als ein eleganter Weg, Zustimmung zu kaufen, ohne echte Mitbestimmung zu gewähren.
12.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./466[163(38-22)]/CLA-302/41-2025

Demokratie hat sich hier offenbar eine verlängerte Auszeit genommen.
Es gibt diese besonderen Momente in der Kommunalpolitik, in denen man sich fragt, ob die Uhr nicht nur langsam tickt, sondern ob sie schlicht den Dienst quittiert hat. Genau so wirkt es derzeit in Crivitz, wo die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Wessin und Gädebehn seit über 500 Tagen geduldig auf ihre demokratisch gewählten Ortsteilvertretungen warten – und nun erfahren mussten, dass sie noch weitere 320 Tage Geduld aufbringen sollen. Wie in der Stadtvertretersitzung am 27. Oktober 2025 verkündet wurde, soll die direkte Wahl der Ortsteilvertretungen erst am 20. September 2026 stattfinden. Das ist nicht weniger als zwei Jahre und drei Monate nach der Kommunalwahl 2024. Man könnte sagen: Demokratie braucht hier nicht nur einen langen Atem, sondern auch ein bequemes Sitzkissen und eine Thermoskanne für die Wartezeit.
Dabei hätte alles ganz anders laufen können – wenn man denn gewusst hätte, dass es überhaupt eine Wahl geben könnte. Denn zur Kommunalwahl 2024 bestand die Möglichkeit, die Ortsteilvertretungen direkt zu wählen. Nur: Das war offenbar ein gut gehütetes Geheimnis, fast so, als stünde es in einer Fußnote, die niemand liest. In der Stadtvertretersitzung wurde beteuert, dass diese Option für viele „völlig neu“ gewesen sei. Man könnte meinen, dass Wahlmöglichkeiten zur Wahl gehören – aber in der Stadt Crivitz scheint das eher ein optionales Extra zu sein, das man nur auf Nachfrage erhält.

Nun also die Lösung: Die Wahl der Ortsteilvertretungen wird mit der Landtagswahl am 20. September 2026 zusammengelegt. Das spart Kosten, vereinfacht Abläufe und ist organisatorisch sicher bequem. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das allerdings: Noch einmal zehn Monate, zwei Wochen und zwei Tage warten – auf eine Wahl, die längst hätte stattfinden können. Und wenn sie dann endlich wählen dürfen, bleibt der neuen Vertretung gerade einmal zwei Jahre und acht Monate im Amt, bevor schon wieder neu gewählt wird. Demokratie auf Zeit, könnte man sagen. Oder: Ein Hoch auf die Effizienz – wenn man Effizienz als die Kunst versteht, Dinge möglichst lange hinauszuzögern. Und wer kandidieren will, sollte den Kalender zücken: Der letzte Tag zur Einreichung von Bewerbungen für die direkte Wahl ist der 7. Juli 2026.

Besonders charmant ist dabei die stille Voraussetzung, die niemand so recht aussprechen wollte: Die derzeitigen Ortsteilvertreter aus dem Jahr 2019 sollen bitte noch ein weiteres Jahr durchhalten – ganz ohne frische Legitimation, aber mit viel Geduld. Denn nur wenn sie ihre Bereitschaft bekunden, bis zum Wahltermin im Amt zu bleiben, kann die Übergangsphase überhaupt funktionieren. Falls nicht, droht ein demokratisches Vakuum – oder wie man in Crivitz sagen würde: eine kreative Pause im Mitbestimmungsprozess. Statt von „Sabbatical“ zu sprechen, sagen wir es lieber klar: Die Demokratie hat sich hier offenbar eine verlängerte Auszeit genommen.
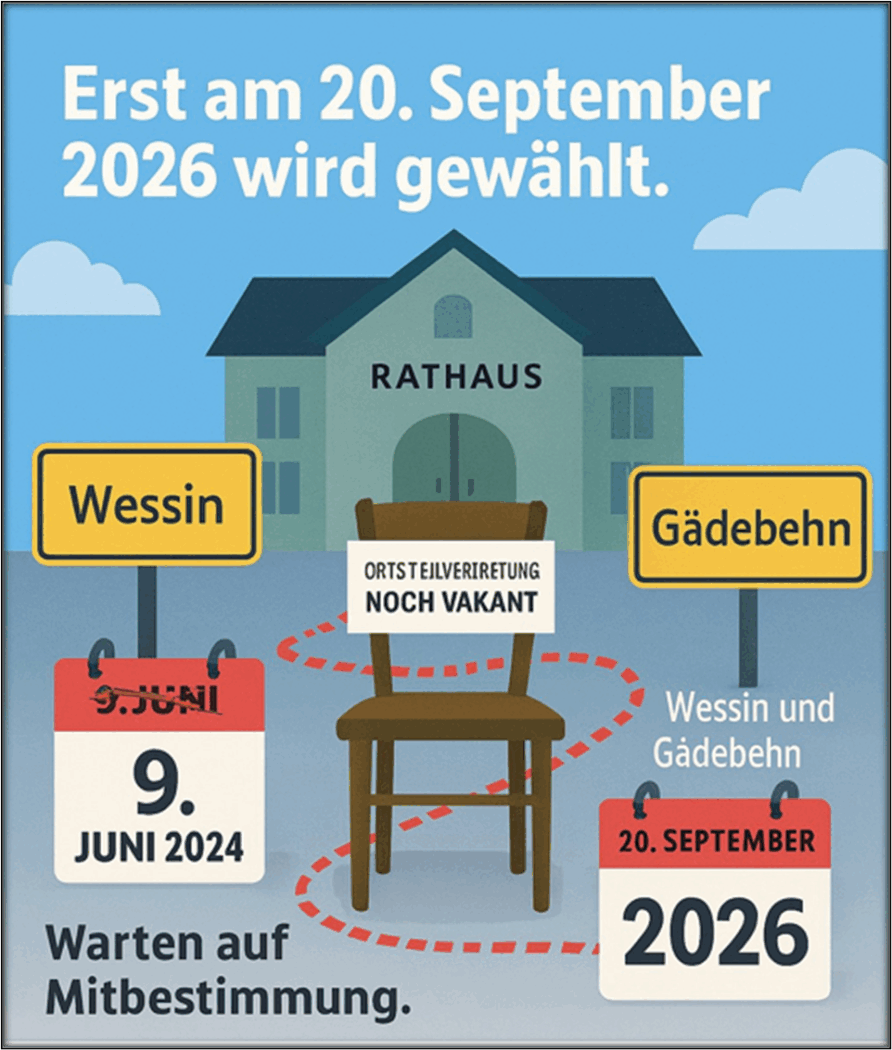
Die Ironie liegt nicht nur im Zeitverlauf, sondern auch in der Tatsache, dass Demokratie hier nicht an fehlendem Engagement scheitert, sondern an Verfahrensschleifen, Satzungswirrwarr und organisatorischer Bequemlichkeit. Die Bürger von Wessin und Gädebehn haben gewählt. Sie haben sich eingebracht. Sie haben auf demokratische Verfahren vertraut. Und sie warten. Seit über 500 Tagen. Nun sollen sie noch 320 weitere Tage warten – auf eine Wahl, die längst hätte stattfinden können.
Demokratie beginnt vor Ort. Aber in Crivitz scheint sie erst einmal auf Urlaub zu sein – mit offenem Rückflugdatum und vielleicht sogar einem verlängerten Aufenthalt.
Fazit:
Die Geschichte von Wessin und Gädebehn zeigt, wie Demokratie im Schneckentempo zur Farce werden kann. Über 500 Tage ohne Vertretung, weitere 320 Tage bis zur Wahl – und das alles, obwohl die Möglichkeit längst bestand. Statt Bürgernähe gibt es Verfahrensschleifen, statt Mitbestimmung eine verlängerte Wartezeit. Am Ende bleibt der Eindruck: Demokratie ist zwar versprochen, aber sie kommt verspätet – wie ein Zug, der immer wieder auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Und wer glaubt, dass Bürgerbeteiligung selbstverständlich ist, lernt in Crivitz: Sie ist eher ein Geduldsspiel.
06.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./465[163(38-22)]/CLA-301/40-2025
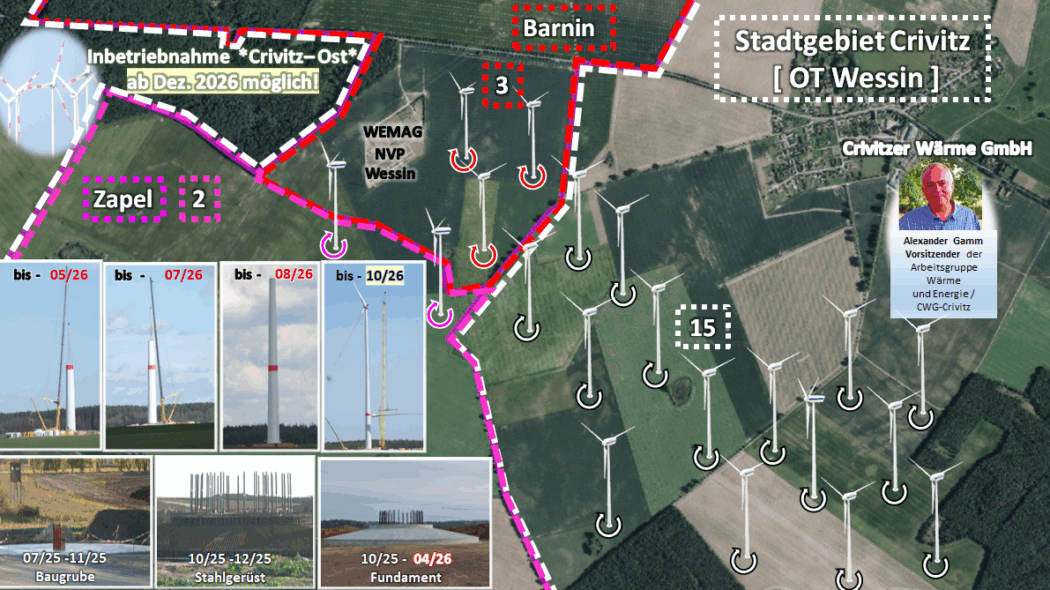
Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin: Ein Lehrstück über Macht, Natur und die stille Last der Bürger
Was als Fortschritt verkauft wird, fühlt sich für viele Menschen im Ortsteil Wessin und den umliegenden Dörfern wie ein Rückschritt an. Das Windeignungsgebiet 43/25, in dem bis zu 20 Windenergieanlagen entstehen sollen, ist nicht nur ein technisches Großprojekt – es ist ein politisches Drama, ein ökologischer Kraftakt und ein wirtschaftliches Spiel mit ungleichen Einsätzen. Es ist die Geschichte einer Region, die sich bemüht, gehört zu werden, während Entscheidungen über ihre Zukunft längst in anderen Räumen getroffen wurden – nicht zuletzt in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk der WEMAG AG.
Bereits im Sommer 2024 zeichnete sich ab, dass die Stadt Crivitz mit ihrer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG) nicht bereit war, die Pläne für das Windgebiet widerspruchslos hinzunehmen. In einer politischen Stellungnahme, gerichtet an den Regionalen Planungsverband sowie an Mitglieder des Kreistags und Landtags, formulierte sie eindringlich die Sorgen und Einwände der Stadt. Die Region rund um Barnin, Zapel und Wessin sei ökologisch sensibel, eine Vogelschutzzone der Stufe 3 – nicht die höchste Schutzklasse, aber dennoch ein wertvolles Nahrungshabitat für zahlreiche Arten. Der Investor hatte seine Bauunterlagen vorgelegt, doch die Stadt verweigerte das gemeindliche Einvernehmen. Es fehlten Unterlagen, Nachbesserungen blieben aus. Die Stadt reagierte mit einer Veränderungssperre, wollte eigene Untersuchungen anstoßen, eine alternative Planung entwickeln – ein letzter Versuch, Einfluss zu nehmen.
Doch die Kommunikation blieb brüchig. Der Regionale Planungsverband reagierte auf die Einwände der Stadt mit knappen Worten: „Dem Hinweis wird nicht gefolgt.“ Wirtschaftliche Teilhabe sei gesetzlich geregelt, aber nicht Gegenstand der Regionalplanung. Auch das zuständige Ministerium schwieg. Die rechtlichen Rahmenbedingungen änderten sich durch das Wind-an-Land-Gesetz, die kommunale Planung wurde entwertet. Die Bürgermeisterin sprach später von einem „Plan für NICHTS“. Ein bitteres Fazit, das die Ohnmacht der lokalen Ebene gegenüber übergeordneten Interessen offenlegt.
Während die Stadt öffentlich um Mitsprache rang, formierte sich im Hintergrund eine neue Dynamik. Die Arbeitsgruppe „Wärme und Energie“ der Stadt Crivitz wurde im August und September 2024 reaktiviert – unter Leitung von Alexander Gamm, Ehemann der Bürgermeisterin, CWG-Fraktionär. Auf Facebook tritt er unter dem Namen Paul Hermann auf, nicht als technischer Experte, sondern als politischer Gestalter. Seine Rolle ist komplex: Er ist Strippenzieher, Stratege und Teil eines Netzwerks, das sich zunehmend selbst organisiert und im nicht öffentlichen Teil ausschließlich berät. Mit Unterstützung der Landesenergieagentur LEKA MV entwickelte die Stadt ein Strombilanzkreismodell, das nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch Unternehmen und Privathaushalte versorgen sollte.
Die Idee war charmant: Wenn die Windräder schon kommen, sollen die Gemeinden wenigstens wirtschaftlich profitieren. „Wir sprachen beim zuständigen Ministerium vor und machten dort auf dieses Modell aufmerksam. Unsere Vorstellungen gehen noch weiter: dass wir das Strombilanzkreismodell gern nicht nur für unsere öffentlichen Gebäude nutzen wollten, sondern auch für die umliegenden Unternehmen und Privathäuser. DAS WÄRE AUS UNSERER SICHT EINE ECHTE BETEILIGUNG DER MENSCHEN, DIE DIE LAST TRAGEN. Wir würden gern, im Rahmen des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV, aus Mangel an eigener Fläche in diesem Gebiet, ein physisches“ Windrad haben wollen – weil 20 % Beteiligung deutlich mehr als ein einzelnes Windrad wären und damit der vernünftige Nutzen für unsere Gemeinde gleichzeitig ein wesentlich besserer wäre.“
Eine völlig neue Denkweise und Herangehensweise zu diesem gesamten Windthema wurde sichtbar. Am 23.09.2024 wurde überraschend schnell eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LoI) zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Wärmeversorgungsprojekts in der Stadt Crivitz vertraglich abgeschlossen. Während sich die Stadt Crivitz klammheimlich mit der WEMAG AG zusammentat, um eine eigene Wärmegesellschaft zu gründen, blieb die Öffentlichkeit – mal wieder – komplett außen vor. Natürlich gibt es diesen LoI, aber wer hätte gedacht, dass dieser Vertrag im Geheimen abgeschlossen wurde? Keine öffentliche Diskussion, keine Ausschussberatung, keine Bürgerinformation über Inhalte oder gegenseitige Verpflichtungen.
So erfuhr die Stadt Crivitz erst durch eine Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU WM) am 10. Februar 2025, dass die Genehmigung für den Bau und Betrieb der 20 Windkraftanlagen bereits am 4. Oktober 2024 erteilt worden war. Die Bürgermeisterin zeigte sich entrüstet Ihren Bericht vom 17.03.2025: „Der Bauherr hatte uns Beteiligungsmöglichkeiten zugesagt. Danach wollte man nicht mehr mit uns reden.“
„Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin: Politisch als ‚überragendes öffentliches Interesse‘ deklariert – ökologisch jedoch ein Desaster“
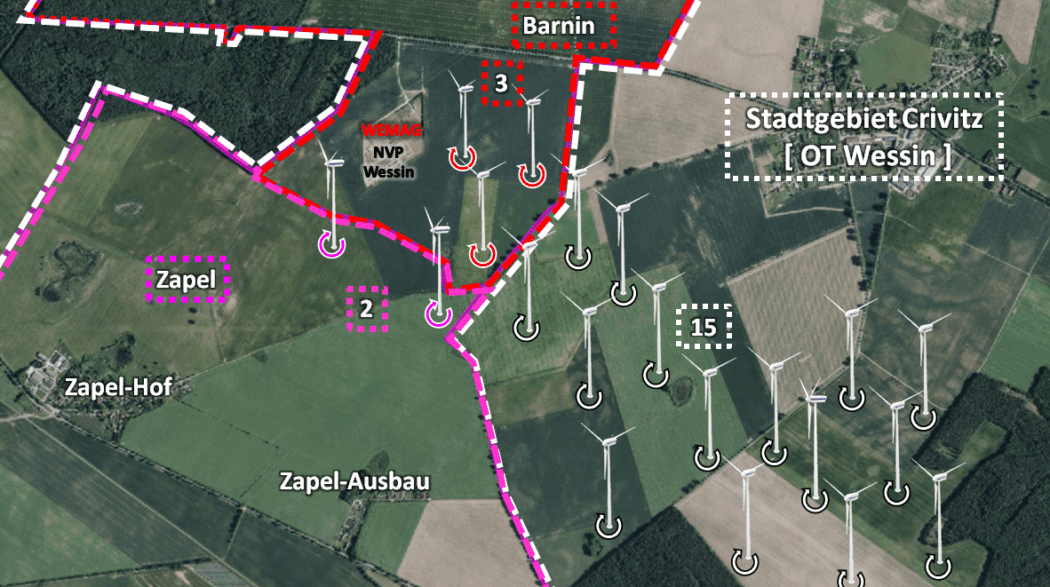
Die Genehmigung für das Windeignungsgebiet in Wessin-Zapel-Barnin umfasst auch eine Ausnahme vom Biotopschutz nach § 20 NatSchAG M-V. So wurde eine Ausnahmegenehmigung für die mittelbaren Beeinträchtigungen eines 7.804 m² Feldgehölzes mit Bäumen, 1.232 m² Baumreihe, 11 Einzelbäumen und 14.003 m² naturnahes Kleingewässer erteilt. Die Verpflichtung zur Kompensation des Eingriffs in das Landschaftsbild im Umfang von 30,8386 ha Kompensationsflächenäquivalenten geht auf die Flächenagentur M-V GmbH über – ein rechtlich zulässiger, aber ökologisch fragwürdiger Vorgang.
Auch während der Bauphase gelten Auflagen: Gesetzlich geschützte Gehölze dürfen nicht beschädigt werden, Amphibienschutzzäune sind zu errichten, und Brutaktivitäten von Vögeln müssen durch Fachpersonal geprüft werden. Doch laut Bürgerberichten aus Wessin und Zapel-Hof wurden in diesem Jahr bis zu 18 Rotmilane gesichtet – so viele wie nie zuvor. Sie nutzen die verbliebenen Baumreihen und Sölle mit hohen Bäumen als Schlafplätze. Das Gebiet ist ein begehrtes Nahrungshabitat für Großvögel – doch das scheint niemanden mehr zu interessieren. Der Bau schreitet dennoch voran.
Am 7. April 2025 beschloss die Stadtvertretung den Abschluss eines Nutzungsvertrags mit der Energieallianz MV Projekt Nr. 11 GmbH & Co. KG. Es geht um die Verlegung von Versorgungsleitungen, temporäre Wegeflächen und Kranstellplätze auf öffentlichen Flächen. CWG-Fraktionär Markus Eichwitz, zugleich erster Bürgermeister, informierte über die Nutzungsentgelte. Die Stadt, die zuvor auf Widerstand setzte, reagierte nun schnell, als Einnahmen winkten. Im Oktober 2025 betonte die Bürgermeisterin in einer öffentlichen Stellungnahme plötzlich:„Seit nunmehr fast drei Jahren arbeiten wir in einer Arbeitsgruppe gemeindeübergreifend (ohne Sitzungsgeld, Mitglieder nehmen Urlaub für wichtige Termine tagsüber) an einem Wärme- und Energiekonzept mit der WEMAG, um auch hier mehr Einnahmen aber auch Kostenminimierung durch das Strom Bilanzkreis- Modell für Schule, Kita und Turnhalle zu erreichen.“
Seit Frühjahr 2025 ist die Energieallianz MV Projekt Nr. 11 GmbH & Co. KG aktiv im Bau tätig die bereits im Juli 2025 ihre Geschäftsanschrift nach 26605 Aurich geändert hat. Bereits im November 2025 sind rund 65 % der Fundamente fertiggestellt.

Zwei Montagetrupps mit Kränen könnten ab April 2026 mit dem Aufbau der Windräder beginnen. Bei optimaler Logistik und rechtzeitiger Lieferung der Bauteile ist eine Fertigstellung bis Oktober 2026 realistisch – spätestens aber bis Dezember 2027.

Die Auflagen für den Bau sind umfangreich, aber ihre Umsetzung bleibt fraglich. Die ökologische Belastung ist spürbar, die Kommunikation lückenhaft, die wirtschaftlichen Interessen klar verteilt – und die Bürger? Sie tragen die Last.
Was bleibt, ist ein Gefühl der Enttäuschung. Ein Projekt, das unter dem Deckmantel des „überragendes öffentliches Interesse“ und „öffentliche Sicherheit“ gemäß § 2 EEG vorangetrieben wird, entpuppt sich als Paradebeispiel für politische Widersprüchlichkeit, intransparente Entscheidungsprozesse und einseitige wirtschaftliche Nutznießung. Die Bürgerinnen und Bürger verdienen volle Transparenz, echte Beteiligung und eine ehrliche Debatte – nicht nur über Windräder, sondern über die Zukunft ihrer Region.
Fortschritt ohne Vertrauen ist kein Gewinn
Das Windeignungsgebiet 43/25 zeigt, wie politische Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen hinweg getroffen werden – im Namen des Gemeinwohls, aber oft zum Vorteil weniger. Die Stadt Crivitz kämpfte um Mitsprache, doch wurde übergangen. Ökologische Bedenken blieben unbeachtet, wirtschaftliche Interessen dominierten, und die Kommunikation war lückenhaft.
Was bleibt, ist ein Projekt, das nicht nur Landschaft verändert, sondern Vertrauen erschüttert. Die Energiewende braucht mehr als Gesetze – sie braucht ehrliche Beteiligung, Transparenz und Respekt gegenüber den Menschen, die die Last tragen.
01.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./464[163(38-22)]/CLA-300/39-2025

Mit großer Betroffenheit und aufrichtiger Anteilnahme möchten wir, die Redaktion des Crivitzer Lokalanzeigers, an dieser Stelle das nachholen, was in der öffentlichen Würdigung bislang versäumt wurde: einen ehrenden Nachruf auf Dipl.-Ing. Klaus Gottschalk, der am 28. September 2025 im Alter von 73 Jahren verstorben ist.
Dipl.-Ing. Klaus Gottschalk war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit der Crivitzer Kommunalpolitik. Als langjähriger Stadtvertreter und engagierter Bürger setzte er sich mit außergewöhnlicher Hingabe für die Belange unserer Stadt und ihrer Menschen ein. Für sein über 20-jähriges ehrenamtliches Engagement wurde ihm im August 2014 die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages verliehen – eine verdiente Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz. Auch nach diesem offiziellen Meilenstein blieb er bis zum Juli 2019 aktiv in der Stadtvertretung, bevor er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Was Klaus Gottschalk auszeichnete, war nicht allein seine fachliche Kompetenz als Diplom-Ingenieur, die insbesondere im Bauausschuss geschätzt wurde. Es war vor allem seine menschliche Haltung, die ihn zu einem verlässlichen Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger machte. Er hörte zu, gab kluge Ratschläge, und hatte stets ein offenes Ohr für Anliegen, die andere vielleicht überhörten. Dabei war er nie parteiisch, sondern stets der Sache verpflichtet – mit einem feinen Gespür für Gerechtigkeit, sozialer Verantwortung und kommunaler Transparenz.
Dipl.-Ing. Klaus Gottschalk scheute sich nicht, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Mit Mut und Klarheit legte er den Finger in die Wunde, wenn es notwendig war – immer mit dem Ziel, das Beste für Crivitz zu erreichen. Seine Stimme war eine Stimme der Vernunft, des Ausgleichs und der konstruktiven Kritik. Viele Bürgerinnen und Bürger erinnern sich an ihn als jemanden, den man jederzeit ansprechen konnte – und der nie auswich, sondern sich kümmerte.
In den vergangenen Wochen wurde das Andenken an Klaus Gottschalk nicht in dem Umfang öffentlich gewürdigt, wie es seinem langjährigen Wirken für die Stadt Crivitz entsprochen hätte. Gelegenheiten, die Raum für ein stilles Erinnern auf Sitzungen hätten bieten können, sind vorbeigegangen – was viele Menschen bewegt und nachdenklich gestimmt hat. Denn mit Klaus Gottschalk verbinden wir nicht nur politische Verantwortung, sondern auch persönliche Begegnungen, wertvolle Gespräche und aufrichtige Unterstützung.
Deshalb ist es unserer gesamten Redaktion ein aufrichtiges Anliegen, ihm auf diesem Wege die Wertschätzung zukommen zu lassen, die seinem langjährigen Wirken und seiner Persönlichkeit gerecht wird.
Crivitz verliert mit Dipl.-Ing. Klaus Gottschalk nicht nur einen verdienten Kommunalpolitiker, sondern einen Menschen, der mit Herz, Verstand und Haltung gewirkt hat. Sein Engagement für unsere Stadt war über viele Jahre hinweg sichtbar – in Ausschüssen, Gesprächen, Initiativen und nicht zuletzt in seinem offenen Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Sein Andenken wird in unserer Stadt weiterleben – in den Erinnerungen derer, die ihn kannten, und in dem, was er für Crivitz bewegt hat.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn vermissen. Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Respekt.
Die Redaktion des Crivitzer Lokalanzeigers.
27.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./463[163(38-22)]/CLA-299/38-2025

Beschluss ohne Wirkung: Der Hundesportplatz als Symbol politischer Blockade!
Was als scheinbar lokaler Nutzungskonflikt zwischen zwei Hundesportvereinen begann, hat sich über zwei Jahre hinweg zu einem politischen Lehrstück über Intransparenz, Machtverhältnisse und systematische Ausgrenzung entwickelt. Der Streit um den Hundesportplatz in Crivitz offenbart nicht nur tiefe Gräben zwischen den Fraktionen der Stadtvertretung, sondern auch eine fragwürdige Praxis: öffentliche Debatten werden systematisch in den nichtöffentlichen Bereich verschoben – fernab der Bürgerinnen und Bürger, die davon unmittelbar betroffen sind.
Seit Jahren kämpft der Hundesportverein Lewitzrand e.V. um Zugang zu einem Trainingsplatz, der ausschließlich vom HSV Crivitz Eichholz e.V. genutzt wird. Beide Vereine engagieren sich für den Hundesport, beide leisten ehrenamtliche Arbeit – doch nur einer erhält die kommunale Trainingsfläche zur alleinigen Nutzung. Warum? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Chronologie der Ereignisse – und sie bleibt bis heute unbeantwortet. Bereits 2023 wurde der Pachtvertrag mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. öffentlich im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine behandelt. Die damalige Vereinsvorsitzende Diana Rommel – damals selbst Fraktionsmitglied der CWG-Crivitz und zugleich Mitglied im selben Ausschuss – äußerte sich zur Bedeutung des Vertrags für ihren Verein. Auch in den Sitzungen am 29. April 2024, 12. November 2024,9. Dezember 2024 und 27. Mai 2025 war der Vertrag Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Dennoch wurde der Zugang für den zweiten Verein systematisch blockiert – durch politische Mehrheiten, durch taktisches Schweigen und durch eine Verwaltung, die sich auf formale Hürden beruft, wo Transparenz geboten wäre.

Erst Ende 2024 begann die Opposition, das Thema mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen. Am 9. Dezember 2024 stellte die CDU-Fraktion einen Antrag auf Kündigung des Pachtvertrags mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. Doch noch bevor dieser Antrag zur Diskussion gelangen konnte, intervenierte der 1. Bürgermeister Markus Eichwitz – zugleich tragender Fraktionär der CWG – mit einem Gegenantrag auf ersatzlose Streichung des Tagesordnungspunkts. Die CWG-Fraktion verfügte über eine knappe Mehrheit – und nutzte sie, da die Opposition an diesem Tage nicht vollständig vertreten war, um jede Debatte im Keim zu ersticken. Als Begründung wurde angeführt, die Kündigungsfrist sei ohnehin abgelaufen. Der Fraktionsvorsitzende der CWG kommentierte den Antrag der CDU mit den Worten: „Dann könnte man ja in Zukunft jeden Pachtvertrag kündigen. Das machen wir nicht mit.“ Eine bemerkenswerte Haltung – nicht nur angesichts der konkreten Problemlage, sondern auch im Hinblick auf das Demokratieverständnis, das darin zum Ausdruck kommt.
Nun kann man davon ausgehen, dass nur die Stadtspitze – bestehend aus Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm sowie dem 1. Bürgermeister Markus Eichwitz und dem 2. Bürgermeister Hartmut Paulsen – den eigentlichen Inhalt des Vertrages kennt. Man kann dies durchaus als bewussten Ausschluss der gewählten Gremien und der Öffentlichkeit bezeichnen. Der Eindruck drängt sich auf.
Als auch weitere Anfragen zu diesem Thema – etwa am 27. Mai 2025 – erneut von der CWG-Fraktion abgeblockt wurden, startete die CDU-Fraktion am 30. Juni 2025 einen neuen Versuch: ein zweiter Antrag auf Kündigung des Pachtvertrags, diesmal im nichtöffentlichen Teil der Sitzung (TOP N 22). Mitglieder des HSV Crivitz Eichholz e.V. waren anwesend und fragten, ob es sich um ihren Vertrag handle. Bürgermeisterin Brusch-Gamm verweigerte jede Auskunft im öffentlichen Teil.
Erst am 15. September 2025 wurde der Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung endlich öffentlich bekannt gegeben. Die CDU-Fraktion hatte sich gemeinsam mit der AfD-Stadtfraktion und dem Bündnis für Crivitz (BfC) durchgesetzt. Der Pachtvertrag mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. soll gekündigt werden – ein deutliches Signal an die CWG-Fraktion, dass ihre bisherige Machtstellung nicht mehr selbstverständlich ist. Die Opposition hatte sich erstmals fraktionsübergreifend zu einem Thema positioniert, das viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. Doch der Beschluss blieb vage: Ein konkreter Kündigungszeitpunkt wurde nicht genannt. Bis heute – Ende Oktober 2025 – ist nichts geschehen.

Stadtvertreter, die im September 2025 öffentlich nachfragten, wurden erneut in den nichtöffentlichen Bereich verwiesen. Auch Anträge auf Einsichtnahme von Bürgern – so ist es der Redaktion bekannt gemacht worden – die den Pachtvertrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz (IFG-Anträge) einsehen wollten, wurden vom Amt Crivitz erst nach acht Wochen beantwortet – und dann rigoros abgelehnt.
Die Begründung: Datenschutz. Der HSV Crivitz Eichholz e.V. habe ein schutzwürdiges Interesse bekundet. Doch diese Argumentation hält einer rechtlichen und politischen Prüfung vermutlich kaum stand. Denn: Es handelt sich um einen Pachtvertrag über kommunale Flächen, der mehrfach öffentlich behandelt wurde. Bereits am 11. Juli 2023 wurde im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine öffentlich über den Vertrag beraten. Auch in den Sitzungen am 29. April 2024, 12. November 2024,9. Dezember 2024 und 27. Mai 2025 wurde das Thema öffentlich angesprochen. Der Beschluss BV 1805/24 zum Abschluss eines Pachtvertrags mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. über eine Fläche von ca. 7.200 m² wurde öffentlich bekannt gegeben. Die Beteiligung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner mit Rede- und Antragsrecht gemäß § 36 Abs. 5 KV M-V sowie die öffentliche Kommunikation des Vorgangs belegen, dass der Verein selbst öffentlich eingebunden war und sich zu den Vertragsinhalten äußerte.
Auch aus zivilrechtlicher Sicht ist ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von § 242 BGB (Grundsatz von Treu und Glauben) und § 675 BGB (Geschäftsbesorgungsvertrag analog bei Verwaltungshandeln) nicht erkennbar. Die Offenlegung dient dem berechtigten Informationsinteresse der Öffentlichkeit und stellt keine unzumutbare Belastung für den Verein dar. Gemäß § 2 Abs. 1 KV M-V hat jede Gemeinde ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln – dazu gehört auch die Pflicht zur Transparenz und Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere bei der Verwaltung öffentlicher Flächen.

Im September 2025 auf der Stadtvertretersitzung nutzte die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) erneut den Datenschutz, um öffentliche Nachfragen abzuwehren. Doch was ist so geheim an diesem Vertrag? Was genau soll hier verschleiert werden? Wer hat den Vertrag unterschrieben? Und wie lang ist die Kündigungsfrist, die angeblich niemand kennt?
Fakt ist: Bis heute kann kein Bürger den Pachtvertrag einsehen. Ob der Vertrag tatsächlich gekündigt wurde, bleibt unklar. Bereits im Dezember 2024 hatte erste Bürgermeister Markus Eichwitz erklärt, dass die Kündigungsfrist bereits überschritten sei. Nun, fast ein Jahr später, dürfte die Situation ähnlich seien. Es ist zu befürchten, dass dieses Thema die Stadt noch bis 2026 oder 2027 beschäftigen wird – denn nur die Stadtspitze kennt die genauen Fristen.
Was bleibt, ist ein Bild des Verschleierns, Verzögerns und Verdrängens. Ein Bild, das dem zweiten Hundesportverein – dem Lewitzrand e.V. – seit zwei Jahren jede Perspektive nimmt. Ein Verein, der täglich um seine Existenz und einen Trainingsplatz kämpft. Ein Verein, der sich an demokratische Verfahren hält, Anträge stellt, Gespräche sucht – und immer wieder vor verschlossenen Türen steht. Warum dürfen nicht zwei Hundesportvereine denselben Platz nutzen? Warum erhält nur einer ein Privileg – und der andere nicht? Warum wird ein öffentliches Thema systematisch in den nichtöffentlichen Raum gedrängt? Und warum schweigt die Stadtspitze zu den entscheidenden Fragen?
Diese Fragen sind nicht nur sportpolitisch relevant. Sie betreffen das demokratische Selbstverständnis einer Stadt. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen – aber wer lässt hier eigentlich wen mitmachen?
Fazit:
Wenn Transparenz zur Ausnahme wird, steht die Demokratie auf dem Prüfstand
Der Fall des Crivitzer Hundesportplatzes zeigt exemplarisch, wie kommunale Machtstrukturen genutzt werden können, um öffentliche Kontrolle zu umgehen, berechtigte Anliegen zu blockieren und demokratische Verfahren auszuhöhlen. Zwei Jahre lang wurde ein Antrag nach dem anderen verschoben, entkräftet oder in den nichtöffentlichen Bereich gedrängt – während der Hundesportverein Lewitzrand e.V um seine Existenz kämpft und der HSV Crivitz Eichholz e.V. durch politische Rückendeckung privilegiert bleibt.

Die CWG-Fraktion hat jede Öffnung verhindert, jede Debatte abgewehrt und sich auf formale Argumente zurückgezogen, wo politische Verantwortung gefragt wäre. Dass selbst Stadtvertreter keinen Einblick in den Pachtvertrag erhalten, ist nicht nur ein verwaltungstechnisches Problem!.
Wenn öffentliche Flächen nur einem Verein zugänglich gemacht werden, ohne nachvollziehbare Begründung, und wenn Bürgeranfragen systematisch abgewehrt werden, stellt sich nicht nur die Frage nach Fairness, sondern nach dem Zustand unserer kommunalen Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Transparenz, Mitbestimmung und Gleichbehandlung – und sie haben das Recht, zu erfahren, warum ein Platz, der allen gehören sollte, nur einem gehört.
Die Crivitzer Hundesportplatz-Affäre ist noch nicht zu Ende. Aber sie hat bereits gezeigt, wie wichtig es ist, hinzusehen, nachzufragen und nicht lockerzulassen. Demokratie lebt nicht von wohlklingenden Reden über Füreinander und Miteinander – sondern davon, dass Menschen mitgestalten können und dürfen. Genau das wurde hier gezielt verhindert.
25.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./462[163(38-22)]/CLA-298/37-2025

Crivitzer Energiezukunft – Gleichgewicht auf dem Papier, Schweigen in der Realität
In Crivitz wird derzeit viel über Energie gesprochen – aber wenig öffentlich. Die Crivitzer Wärme-GmbH, einst als übergeordnete Trägergesellschaft für nachhaltige Projekte wie Windkraft, Solarenergie, Biogas und ein Heizkraftwerk in der Neustadt Crivitz angekündigt, soll nun zur gleichberechtigten Partnerschaft zwischen der Stadt und der WEMAG AG werden. 50:50 – das klingt nach Partnerschaft, Mitsprache und Verantwortung. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein komplexes Geflecht aus Intransparenz, widersprüchlicher Kommunikation und politischer Selbstinszenierung.
Besonders bemerkenswert ist die abrupte Kehrtwende in der öffentlichen Darstellung durch Alexander Gamm (in Facebook auch als Paul Hermann unterwegs). Noch am 23.09.2024 hatte er in der Stadtvertretung erklärt, dass die Stadt Crivitz lediglich eine untergeordnete Rolle in der geplanten Gesellschaft einnehmen werde – von einer gleichberechtigten 50:50-Beteiligung war damals keine Rede. Umso überraschender war seine „sensationelle“ Ankündigung in der Einwohnerfragestunde am 30.06.2025, die er wieder einmal als Bühne nutzte und in der er plötzlich erklärte, es handele sich um eine paritätische Beteiligung mit der WEMAG. Laut Protokoll heist es: „Zur gemeinsamen Gesellschaft mit der WEMAG: Es handelt sich nicht um eine Minderheitsbeteiligung der Stadt. Aus den Unterlagen, die auch der AfD-Fraktion zur Verfügung stehen, ist klar ersichtlich, dass es sich um eine 50-50-Beteiligung handelt.“ Welche Unterlagen? Diese Aussage widerspricht nicht nur seinen eigenen früheren Ausführungen, sondern wirft auch die Frage auf, warum diese „neue Realität“ nicht längst offen kommuniziert wurde – und warum offenbar nur eine einzelne Fraktion Zugang zu den entscheidenden Unterlagen erhielten und nicht die gesamte Stadtvertretung.
Noch im Stadtblatt 09/2023 wurde die Arbeitsgruppe „Wärme und Energie“ als offenes Bürgerformat beworben. Wörtlich hieß es: „Wir laden sehr gerne zum Mitmachen ein, weil es uns alle betrifft und Lösungen braucht, die wiederum uns alle betreffen. Sprechen Sie unsere Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter direkt an, kommen Sie in unsere Sitzungen und bringen sich ein.“ Ein Aufruf zur Beteiligung, zur Mitgestaltung, zur Transparenz. Doch was folgte, war das genaue Gegenteil: Nach der Kommunalwahl 2024 wurde die Arbeitsgruppe faktisch zur Blackbox erklärt – ein „Top-Secret“-Gremium, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte. Keine öffentlichen Protokolle, keine Einladungen, keine Beteiligung. Die Öffentlichkeit wurde systematisch ausgeschlossen, Informationen wurden nur selektiv und häppchenweise präsentiert – stets durch denselben Akteur: Alexander Gamm.
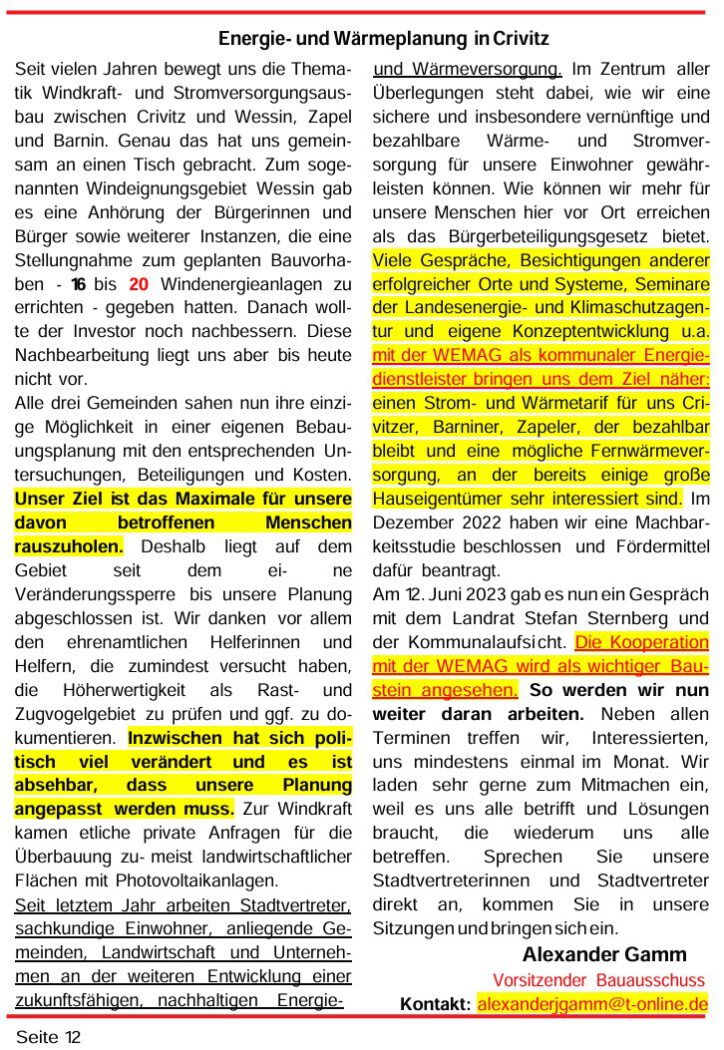
Alexander Gamm, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, jetzt sachkundiger Einwohner im Bauausschuss ( CWG – Crivitz) , Ehemann der Bürgermeisterin ( Crivitzer Wählergemeinschaft) und jetzt vermutlich auch führender Kopf der Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG), war nicht nur zentraler Strippenzieher im Hintergrund – er war auch der Autor des Stadtblatt-Artikels, in dem die Bürgerbeteiligung groß angekündigt wurde. Dass ausgerechnet er es war, der diesen Prozess in die Intransparenz führte, ist mehr als nur ein politischer Widerspruch – es ist ein Paradebeispiel für kontrollierte Öffentlichkeit.
Die CWG, die von 2019 bis 2024 mit absoluter Mehrheit die Geschicke der Stadt bestimmte, hat diesen Kurs maßgeblich geprägt. Unter ihrer Führung – und mit Alexander Gamm als langjährigem Vorsitzenden des Bauausschusses (als Fraktionschef der Graktion -die LINKE/Heine) – wurde das Thema Energie- und Wärmeplanung konsequent in nichtöffentliche Sitzungen verlagert. Entscheidungen wurden vorbereitet, abgestimmt und verkündet, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger je die Möglichkeit hatten, sich einzubringen oder auch nur umfassend informiert zu werden.
Rechtlich betrachtet ist die Crivitzer Wärme-GmbH eine kommunale GmbH – genauer: ein kommunales Unternehmen in Privatrechtsform. Denn mit 50 % Beteiligung übt die Stadt maßgeblichen Einfluss aus. Damit unterliegt die Gesellschaft den strengen Vorgaben der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründung muss angezeigt und genehmigt werden. Die Rechtsaufsicht prüft, ob der öffentliche Zweck erfüllt wird, ob das Engagement mit dem Haushalt vereinbar ist und ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Besonders brisant wird das, wenn die Kommune – wie Crivitz – finanziell angeschlagen ist. Der Haushalt 2025 der Stadt Crivitz ist bereits belastet, und die Wärme-GmbH wird zunehmend als Einnahmequelle dargestellt. In der öffentlichen Stellungnahme der Bürgermeisterin im Oktober 2025 heißt es: „Seit nunmehr fast drei Jahren arbeiten wir in einer Arbeitsgruppe gemeindeübergreifend (ohne Sitzungsgeld, Mitglieder nehmen Urlaub für wichtige Termine tagsüber) an einem Wärme- und Energiekonzept mit der WEMAG, um auch hier mehr Einnahmen aber auch Kostenminimierung durch das Strom Bilanzkreis- Modell für Schule, Kita und Turnhalle zu erreichen.“ Die ursprüngliche Zielsetzung – bezahlbare Versorgung, Bürgernähe, Nachhaltigkeit – weicht einem neuen Fokus: Haushaltsrettung. Die Wärme-GmbH wird zur Hoffnungsträgerin für kommunale Liquidität. Doch das ist rechtlich heikel: Kommunen dürfen keine privaten Unternehmen subventionieren. Sie dürfen keine Kredite aufnehmen, um Verluste auszugleichen. Und sie dürfen keine Beteiligungen eingehen, die den eigenen Haushalt gefährden.

Parallel zur Wärme-GmbH wird ein weiteres Großprojekt vorbereitet: die Gründung einer Betreibergesellschaft für Windenergie im Gebiet Crivitz-West. Der kommunale Anteil? Nur 30–40 %. Die Bürger? Sie erfuhren davon – immerhin – noch vor Vertragsunterzeichnung, und zwar aus Antragunterlagen vom Mai 2025, die erst im September 2025 öffentlich bekannt wurden. Doch auch hier gilt: Keine öffentliche Debatte, keine echte Beteiligung. Entscheidungen werden getroffen, Beteiligung wird behauptet. Im Antrag zur WEMAG heißt es: „Die Stadt Crivitz und die mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH […] beabsichtigen die Entwicklung und Realisierung eines Wärmeversorgungsprojektes […] sowie die Umsetzung von Photovoltaik- und Windenergieprojekten […] insbesondere im Gebiet Crivitz West.“Die Sektorenkopplung – Strom aus Wind für Wärme in der Neustadt – klingt innovativ. Doch wer entscheidet über die Umsetzung? Wer kontrolliert die Einnahmen? Wer schützt die Bürger vor möglichen Belastungen?
In Crivitz kursiert inzwischen ein weiterer Verdacht: Dass die neuen Gesellschaften auch zur Versorgung gescheiterter oder gestrandeter politischer Kandidaten dienen könnten. Die Vielzahl an Gremien, Arbeitsgruppen und neuen Beteiligungsgesellschaften könnte nicht nur Intransparenz, sondern auch neue Posten – fernab öffentlicher Kontrolle schaffen. Die Nähe zwischen Alexander Gamm, der CWG-Fraktion und der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm wirft Fragen auf.
Crivitz’ Energiezukunft ist zu wichtig, um hinter verschlossenen Türen verhandelt zu werden. Die Bürger verdienen mehr als Informationshäppchen. Sie verdienen Mitsprache, Transparenz und eine Energiepolitik, die nicht nur auf dem Papier gleichberechtigt ist. Die Crivitzer Wärme-GmbH, die Windprojekte Ost und West, die Haushaltslage 2025 – all das sind keine technischen Details, sondern politische Entscheidungen. Entscheidungen, die das Leben der Menschen betreffen. Entscheidungen, die öffentlich diskutiert werden müssen.
Fazit
Die Energieprojekte in Crivitz betreffen uns alle – doch echte Beteiligung fehlt. Was als offene Bürgergruppe angekündigt wurde, wurde hinter verschlossene Türen verlagert. Die Crivitzer Wärme-GmbH, die Windprojekte und neue Gesellschaften entstehen ohne öffentliche Debatte, mit widersprüchlichen Aussagen und fragwürdiger Transparenz. Die Stadt geht finanzielle Risiken ein, während zentrale Entscheidungen von wenigen Personen gesteuert werden – allen voran Alexander Gamm und die CWG.
Jetzt ist es Zeit, Fragen zu stellen, Einblick zu fordern und dafür zu sorgen, dass Crivitz’ Energiezukunft nicht nur verwaltet, sondern gemeinsam gestaltet wird.
22.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./461[163(38-22)]/CLA-297/36-2025

500 Tage ohne neue Ortsteilvertretungen – ein demokratischer Offenbarungseid!
Was sich hier entfaltet hat, ist weit mehr als ein verwaltungstechnisches Missgeschick oder eine bedauerliche Verzögerung. Es ist ein strukturelles Versagen mit Ansage – ein politischer Offenbarungseid. Ein Lehrstück darüber, wie Mitbestimmung ausgehöhlt werden kann: durch taktisches Lavieren, durch beredtes Schweigen, durch eine beunruhigende Mischung aus juristischer Unkenntnis und administrativer Selbstüberschätzung.
Was ist eine Wahl wert, wenn sie keine Wirkung entfaltet? Was bedeutet Demokratie, wenn sie auf Ortsteile nicht angewendet wird? Und was geschieht, wenn Verwaltung und Politik sich in einem Netz aus Taktik, Unkenntnis und Schweigen verfangen? Die Situation in den Ortsteilvertretungen in Wessin und Gädebehn macht deutlich, wie leicht demokratische Verfahren ins Stocken geraten können, wenn politische und verwaltungsrechtliche Prozesse nicht ineinandergreifen.
Am 9. Juni 2024 wählten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Crivitz ihre neue Stadtvertretung – und mit ihr, so glaubte man, auch die Ortsteilvertretungen für Wessin und Gädebehn. Mit Inkrafttreten der neuen Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns wurde erstmals die Möglichkeit geschaffen, Ortsteilvertretungen auf unterschiedliche Weise zu besetzen: entweder durch eine direkte Wahl der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, durch ein Benennungsverfahren innerhalb der Stadtvertretung oder – abweichend vom Gesamtergebnis der Kommunalwahl in der Stadt Crivitz – allein auf Grundlage der Wahlergebnisse in den jeweiligen Ortsteilen wie Wessin und Gädebehn. Ein Fortschritt für die lokale Demokratie – theoretisch. Doch was folgte, war kein demokratischer Aufbruch, sondern ein lähmender Stillstand.
Crivitz, 22. Oktober 2025. Ein Datum, das sich wie ein Mahnmal in das Gedächtnis der Ortsteile Wessin und Gädebehn einbrennen sollte. Exakt 500 Tage sind vergangen seit jener Kommunalwahl am 9. Juni 2024 – einem Tag, der für viele Bürgerinnen und Bürger Hoffnung auf Mitbestimmung und neue demokratische Teilhabe bedeutete. Doch diese Hoffnung wurde vertagt, verdrängt, vielleicht sogar bewusst nach hinten verschoben. Denn bis heute wurde keine neue Ortsteilvertretung gewählt, die den Wählerwillen der aktuellen Wahlperiode ab 2024 abbildet. Zwar haben sich die bisherigen Ortsteilvertretungen bereit erklärt, ihre Arbeit kommissarisch fortzuführen – ein Akt der Verantwortung, welcher Respekt abverlangt und der den demokratischen Stillstand zumindest abfedert. Doch diese Übergangslösung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bürgerinnen und Bürger seit eineinhalb Jahren auf eine Neuwahl oder Benennung warten, die ihnen laut Kommunalverfassung längst zusteht. Es fehlt nicht an Engagement vor Ort – es fehlt an politischem Willen und administrativer Klarheit.
Bereits im Juli 2024, zur Konstituierung der neuen Stadtvertretung, stellte die AfD-Fraktion einen Antrag, die Ortsteilvertretungen gemäß der neuen Kommunalverfassung M-V über ein einfaches Benennungsverfahren innerhalb der Stadtvertretung zu benennen. Das Verfahren war rechtlich zulässig, effizient und hätte den Ortsteilen binnen Wochen wieder Handlungsfähigkeit verliehen. Damit das Benennungsverfahren hätte greifen können, wäre eine Einigung aller Fraktionen auf gemeinsame Kandidaten notwendig gewesen. Doch vor allem die Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG) unter der Führung von Fraktionschef Andreas Rüß lehnte diesen Weg entschieden und mehrmals ab – und das, ohne zuvor die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen zu informieren oder einzubeziehen. Stattdessen setzte die CWG auf direkte Neuwahlen in Wessin und Gädebehn – obwohl es zu diesem Zeitpunkt keinerlei öffentliche Diskussion oder Anhörung in den betroffenen Ortsteilen gegeben hatte.

Die CWG verfolgte offenbar eine Strategie, die auf Machterhalt und Imagepflege in den Ortsteilen abzielte. Durch Neuwahlen hoffte man, die eigene Position in Wessin und Gädebehn auszubauen. Die CDU-Fraktion sowie das neu gegründete Bündnis für Crivitz (BfC) stimmten zwar dem Vorschlag der CWG zu – jedoch mit tiefem, spürbarem Bauchgrummeln. Die Chance auf eine geeinigte paritätische Besetzung der Ortsteilvertretungen wurde vertan. Stattdessen begann ein langwieriger Prozess zur Änderung der Hauptsatzung, der sich über ein Jahr hinzog und von rechtlichen Unsicherheiten begleitet war.
Der Sommer 2024 verging und auch der Herbst war vorüber. Erst im Dezember 2024 war dann die nächste Versammlung zu diesem Thema angesetzt. Die AfD-Stadtfraktion reagierte wieder schneller und stellte einen weiteren Antrag – diesmal mit konkretem Bezug auf § 32a Absatz 2 Satz 1 der Kommunalverfassung M-V. Ziel war es, die Sitze in den Ortsteilvertretungen von Wessin und Gädebehn nicht nach dem Gesamtergebnis der Stadt Crivitz, sondern ausschließlich nach den Wahlergebnissen in den jeweiligen Ortsteilen zu vergeben. Ein juristisch fundierter Vorschlag, der den lokalen Wählerwillen respektiert hätte und eine realistische Sitzverteilung ermöglicht hätte – basierend auf den tatsächlichen Stimmen vor Ort in den Ortsteilen. Dabei wäre diese Lösung greifbar gewesen – und zwar schon im Herbst 2024. Denn die Wahldaten lagen sicherlich archiviert vor. Die Auswertung wäre mit überschaubarem Aufwand möglich gewesen. Keine Spekulation, kein Losverfahren, keine parteipolitische Verzerrung – sondern ein klares, demokratisch sauberes Bild.

Auch dieser Antrag scheiterte – diesmal aufgrund des Einschreitens der Rechtsaufsicht. Verwaltung und Aufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim machten deutlich, dass die Briefwahlergebnisse nicht getrennt nach Ortsteilen ausgewertet worden waren. Ein Versäumnis, das kaum nachvollziehbar ist, zumal die entsprechenden Gesetzesänderungen bereits seit April 2024 bekannt waren. Das Amt Crivitz und die Wahlleitung waren vermutlich auf die neuen Anforderungen nicht vorbereitet: In den Wahllokalen fehlten separate Briefwahlurnen für Wessin und Gädebehn, und die Stimmen wurden ausschließlich für die Gesamtstadt Crivitz erfasst. Diese Information traf alle Fraktionen der Stadtvertretung überraschend – und bedeutete zugleich, dass eine weitere Möglichkeit zur demokratischen Besetzung der Ortsteilvertretungen ungenutzt blieb. Diesmal nicht aus politischem Kalkül, sondern aus rechtlicher Konsequenz.
Was folgte, war ein politischer Kraftakt – allerdings einer, der mehr Fragen aufwarf als Antworten lieferte. Im Dezember 2024 beschloss die Stadtvertretung von Crivitz, getragen von der Mehrheit der CWG-Fraktion, flankiert von Teilen der CDU und BfC – und bemerkenswerterweise auch mitgetragen von der AfD-Fraktion – eine neue Variante: Die Mitglieder der Ortsteilvertretungen sollten direkt von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile gewählt werden, gemäß den Bestimmungen des Landes- und Kommunalwahlgesetzes. Eine Neuwahl also, ausschließlich für die Ortsteilvertretungen.
Natürlich ist die direkte Wahl ein zentraler Bestandteil unserer parlamentarischen Demokratie – und grundsätzlich ein begrüßenswerter Weg, um Bürgerbeteiligung zu stärken. Doch im konkreten Fall wirkte die Entscheidung der Stadt Crivitz eher wie ein überstürzter Vorstoß, ohne die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Wessin und Gädebehn waren über diese neue Möglichkeit nicht informiert worden. Es fehlte an Aufklärung, an Vorbereitung und an öffentlichen Versammlungen, die den Prozess hätten begleiten können.
Was folgte, war ein organisatorischer Kraftakt mit vielen offenen Fragen. Ein neuer Wahlkampf musste aufgesetzt werden, Wahlausschüsse für die Ortsteile mussten gewählt werden – mindestens einer, möglicherweise sogar zwei. Gleichzeitig war unklar, ob überhaupt genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stehen würden. Man rechnete vorsorglich mit Ergänzungswahlen, zusätzlichen Sitzungen bei Einsprüchen und möglichen Nachwahlen. Auch die finanziellen Auswirkungen waren erheblich: Aufwandentschädigungen für Wahlvorstände, Druckkosten für Wahlscheine und Briefwahlunterlagen, die Besetzung der Wahllokale – all das verursachte Kosten, die in einer Stadt mit ohnehin angespannter Haushaltslage schwer zu stemmen sind. Hinzu kam die Frage, ob das Amt Crivitz überhaupt über ausreichend Personal verfügte, um alle Wahllokale in den Ortsteilen ordnungsgemäß zu betreuen. Die Folge: Der gesamte Prozess zur Konstituierung und Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Ortsteilvertretungen verzögerte sich weiter – nun bis mindestens ins zweite Quartal 2025. Was als demokratischer Fortschritt gedacht war, wurde durch mangelnde Vorbereitung und fehlende Transparenz zu einem langwierigen und belastenden Verfahren – für Verwaltung und Bürger gleichermaßen.
Doch damit war die Hängepartie noch lange nicht vorbei. Erst nach weiteren drei Monaten – am 14. März 2025 – wurde die überarbeitete Hauptsatzung endlich veröffentlicht. Viele hofften nun, dass die Ortsteilwahlen bald stattfinden könnten. Doch diese Zuversicht hielt nicht lange. Denn die neue Satzung offenbarte gravierende handwerkliche und verwaltungsrechtliche Mängel, die eine Umsetzung erneut verzögerten und den gesamten Prozess zurückwarfen. Die in der Hauptsatzung von Crivitz festgelegten Regelungen zur Wahl der Ortsteilvertretungen erwiesen sich als widersprüchlich und rechtlich kaum haltbar. Für Gädebehn und die umliegenden Ortsteile war vorgesehen, dass jeweils ein Vertreter gewählt wird – mit der Option, bei fehlenden Kandidaten zusätzliche Vertreter aus anderen Ortsteilen hinzuzuziehen. Für Wessin hingegen war ein ganz anderes Verfahren geplant: eine gemeinsame Wahl von fünf Vertretern für drei Ortsteile. Zwei völlig unterschiedliche Modelle – ohne nachvollziehbare Begründung und ohne rechtliche Absicherung.
Die Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim schritt ein und beanstandete die Satzung zu Recht. Mit der Rücknahme der fehlerhaften Fassung war klar: Eine erneute Überarbeitung war unvermeidlich. Die Stadt Crivitz musste nicht nur die Wahlverfahren überarbeiten, sondern auch die Ortsteilgrenzen präzise erfassen und dokumentieren – eine neue gesetzliche Pflicht, die sich aus § 42 Absatz 1 der geänderten Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ergibt. Bislang waren die Gemeinden lediglich verpflichtet, die Namen ihrer Ortsteile festzulegen. Nun verlangt das Gesetz eine genaue Beschreibung der geografischen Abgrenzungen – ein Schritt, der nicht nur verwaltungstechnisch aufwendig ist, sondern auch politisch sensibel.
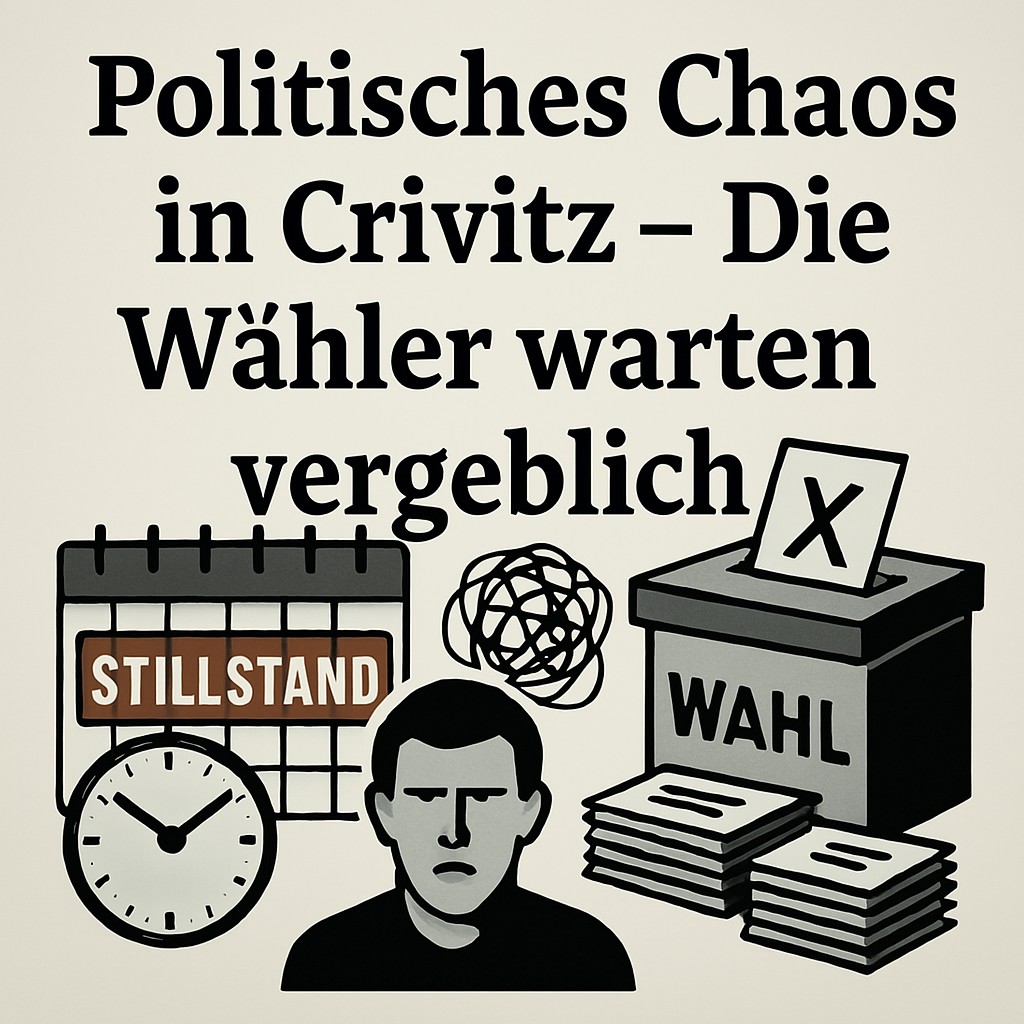
Besonders heikel: Die Ortsteile Wessin und Gädebehn sind durch frühere Fusionsverträge mit der Stadt Crivitz miteinander verbunden. Die neue Rechtslage macht es notwendig, von diesen vertraglichen Regelungen abzuweichen – und zwar mithilfe der sogenannten salvatorischen Klausel, die Anpassungen bei geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen erlaubt. Ein juristisch komplexer Vorgang, der erneut Zeit kostete und die ohnehin schleppende Entwicklung weiter verzögerte bis zum Herbst 2025.
Seit der Veröffentlichung der überarbeiteten Hauptsatzung am 14. Oktober 2025 ist offiziell der Weg für die Ortsteilwahlen in Wessin und Gädebehn frei. Doch faktisch ist bis heute – Stand Ende Oktober – nichts passiert. Kein Wahltermin wurde bekannt gegeben, keine Information ging an die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen, keine öffentliche Kommunikation, kein Zeitplan, keine Einladung zur Beteiligung. Die Verwaltung des Amtes Crivitz schweigt. Auch die Stadtspitze – Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG), ihr Stellvertreter Markus Eichwitz (CWG) und der zweite stellvertretende Bürgermeister Hartmut Paulsen (CDU) – äußert sich nicht und lässt jegliche Kommunikation vermissen. Keine Stellungnahme, keine Erklärung, kein Signal an die Öffentlichkeit. Währenddessen warten die Bürgerinnen und Bürger in Wessin und Gädebehn weiter – seit über 500 Tagen.
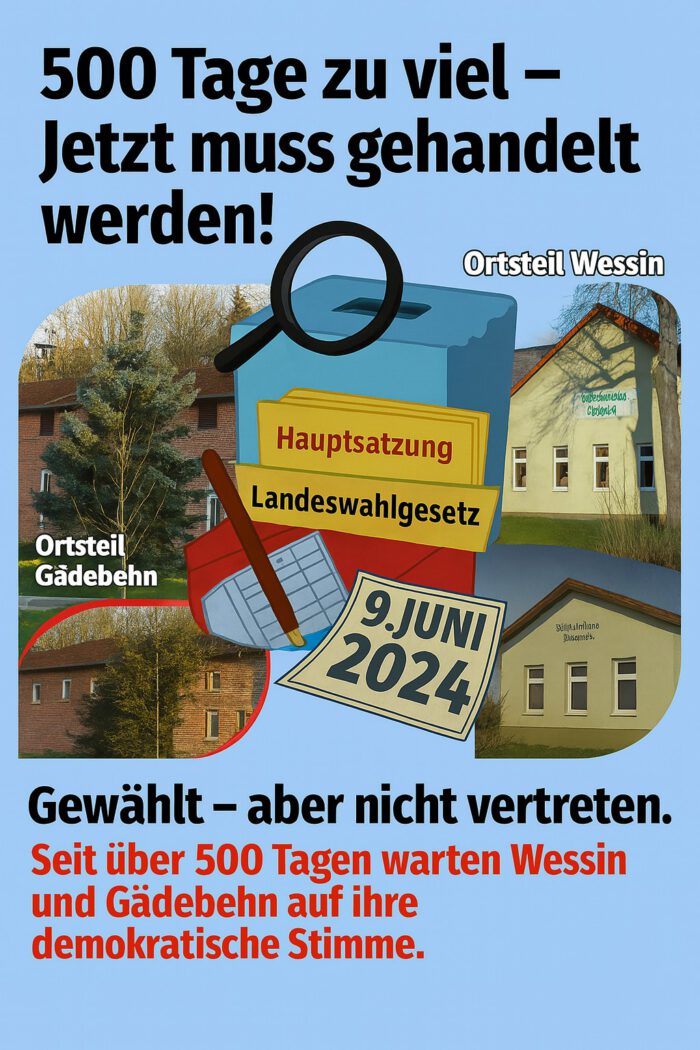
Die zentrale Frage bleibt unbeantwortet: Wann dürfen die Ortsteile endlich wieder mitreden? Wann wird gewählt? Wann endet der Zustand, in dem zwei Ortsteile faktisch von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind?
Ebenso auffällig wie das Schweigen zur Wahlorganisation ist die völlige Abwesenheit jeder Debatte über die entstehenden Kosten. Denn klar ist: Die Neuwahlen werden Geld kosten – und zwar nicht wenig. Aufwandentschädigungen für Wahlvorstände, Druckkosten für Wahlunterlagen, Briefwahlorganisation, Porto, zusätzliche Sitzungen, mögliche Ergänzungs- oder Nachwahlen – all das muss finanziert werden. Doch bis heute gibt es keine öffentliche Kostenaufstellung, keine Schätzung, keine Haushaltsplanung. Die Frage, wie diese Ausgaben in den ohnehin angespannten Haushalt der Stadt Crivitz für 2026 integriert werden sollen, wurde schlicht nie gestellt. Warum? Vielleicht, weil die Antwort unangenehm wäre.
Und falls sich doch jemand Gedanken über die Finanzierung machen sollte – ein Vorschlag liegt ja quasi zwischen den Zeilen bereit: Die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter könnten doch einfach auf ihr Sitzungsgeld verzichten, zumindest für die Sitzungen, in denen über die Ortsteilwahlen gesprochen wird. Das wäre nicht nur ein symbolischer Akt der Solidarität mit den Bürgern, sondern auch ein kleiner Beitrag zur Entlastung der Stadtkasse. Aber keine Sorge – das war natürlich nur ein Gedanke.
Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Fazit:
Wenn Demokratie zur Verwaltungsroutine wird, verliert sie ihr Versprechen!
Die Geschichte der Ortsteilvertretungen in der Stadt Crivitz zeigt exemplarisch, wie demokratische Teilhabe scheitern kann – nicht durch offenen Widerstand, sondern durch Verzögerung, Schweigen und strukturelle Unklarheit. Was als Fortschritt gedacht war, wurde durch taktisches Lavieren und mangelnde Vorbereitung zu einem lähmenden Stillstand. Die Bürgerinnen und Bürger in Wessin und Gädebehn wurden über 500 Tage lang von ihrer politischen Mitwirkung ausgeschlossen – obwohl sie gewählt hatten, obwohl sie bereit waren, obwohl die rechtlichen Grundlagen längst existierten.
Demokratie lebt nicht allein von Wahlen, sondern von ihrer Umsetzung. Sie braucht klare Verfahren, transparente Kommunikation und den politischen Willen, Ergebnisse zu respektieren – auch wenn sie unbequem sind. Wenn Verwaltung und Politik sich gegenseitig blockieren, wenn Satzungen fehlerhaft bleiben und Bürger nicht informiert werden, dann wird aus Mitbestimmung ein leeres Versprechen.
19.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./460[163(38-22)]/CLA-296/35-2025

Crivitz und der Preis der politischen Sturheit – Wie der Haushalt 2025 zum Wendepunkt wurde
Die Stadt Crivitz steht im Herbst 2025 am haushaltspolitischen Abgrund – und das ist keine Übertreibung. Was im Frühjahr 2025 mit einem dramatischen Titel begann – „Haushaltsplan des Grauens: Geld, das schneller verdampft als kochendes Wasser!“ – hat sich bis zum Herbst zu einer haushaltspolitischen Krise verdichtet, die Crivitz noch Jahre beschäftigen wird.
Bereits im Dezember 2024, als eigentlich der Haushalt für das Folgejahr hätte beraten und verabschiedet werden sollen, entschied sich die Stadtspitze für eine andere Priorität: Mit Unterstützung der CWG ( Crivitzer Wählergemeinschaft) -Fraktion wurde die Hauptsatzung geändert – und die Aufwandsentschädigungen für die drei zentralen Funktionsträger der Stadt erhöht. Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, ihr erster Stellvertreter Markus Eichwitz und der zweite Stellvertreter Hartmut Paulsen erhielten damit eine spürbare finanzielle Aufwertung ihrer Ämter. Insgesamt stieg die jährliche Belastung für den Stadthaushalt um rund 7.800 €.
Diese Entscheidung fällt zeitlich bemerkenswert: Nur fünf Wochen später begannen die ersten Krisensitzungen zum Haushalt 2025 – einem Haushalt, der sich als hochproblematisch und genehmigungsbedürftig herausstellen sollte. Es stellt sich die Frage, ob die Verantwortlichen bereits im Dezember 2024 ahnten, dass die finanzielle Lage der Stadt sich zuspitzen würde – und ob man sich deshalb noch rechtzeitig um die eigenen Rahmenbedingungen kümmerte, bevor die haushaltsrechtlichen Einschränkungen greifen konnten. Für viele Bürgerinnen und Bürger wirkt diese Reihenfolge irritierend: Erst werden persönliche Entschädigungen erhöht, dann folgt ein Haushalt mit massiven Kürzungen, Auflagen und Sparzwängen. Während die Stadt gezwungen ist, über 800.000 € einzusparen, bleiben die Dezember 2024 -Beschlüsse unangetastet. Das wirft Fragen auf – nicht nur zur haushaltspolitischen Verantwortung, sondern auch zur politischen Haltung gegenüber dem Gemeinwohl.
Finanzpolitische Überdehnung in Crivitz – eine Bilanz mit Folgen:Zwischen 2018 und 2024 verfolgte die Stadt Crivitz eine Investitionspolitik, die in ihrer Dimension und Gleichzeitigkeit beispiellos war: Mit jährlich 15 bis 20 parallel gestarteten Projekten erreichte die Investitionsquote teils bis zu 320 % des Haushaltsvolumens. Von einem Investitionsstau kann daher keine Rede sein. Vielmehr offenbart sich ein Politikstil, der dauerhaft die Belastungsgrenzen des kommunalen Haushalts überschritten hat – ohne Rücksicht auf die strukturelle Tragfähigkeit oder die langfristige Finanzierbarkeit. Verantwortlich für diesen Kurs war maßgeblich die Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG), die in den vergangenen fünf Jahren über eine absolute Mehrheit in der Stadtvertretung verfügte. Unter ihrer Führung wurde eine finanzpolitische Eskalation betrieben, die sich zunehmend von haushaltsrechtlicher Vernunft entfernte: Immer neue Projekte, steigende Ausgaben, fehlende Priorisierung. Parallel dazu wurden die laufenden Ausgaben im Ergebnishaushalt – insbesondere für Personal, Bauhof, Reinigung, Verwaltung, Bewirtschaftung und geringwertige Wirtschaftsgüter – massiv ausgeweitet. Die Fixkosten stiegen auf ein Niveau, das selbst in wirtschaftlich stabilen Kommunen als kritisch gelten würde. Hinzu kamen kontinuierliche Kreditaufnahmen sowie erhebliche Steuer- und Gebührenerhöhungen, die nicht nur die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich belasteten, sondern auch zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen durch das Land führten – ein Effekt, der die finanzielle Lage weiter verschärfte.
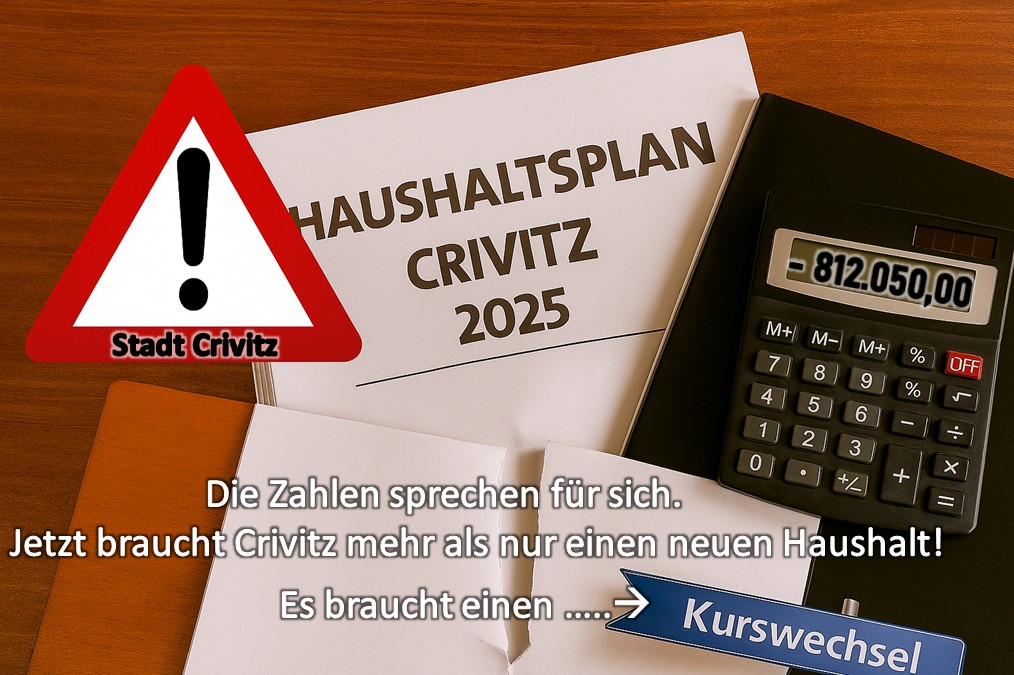
Die Folgen dieser Politik sind gravierend: Der städtische Finanzhaushalt ist strukturell überfordert, die Liquidität drastisch gesunken, die Rücklagen vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2025 verfügt die Stadt weder über finanzielle Reserven noch über haushaltsrechtliche Spielräume. Crivitz steht faktisch haushaltspolitisch handlungsunfähig da.Diese Situation ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis eines politischen Kurses, der auf Expansion statt Konsolidierung, auf Wirkung statt Verantwortung setzte. Die Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG- Crivitz) hat in ihrer zentralen Verantwortung dafür gesorgt, dass sich Crivitz finanziell übernommen hat – und nun stehen alle Bürgerinnen und Bürger vor den Konsequenzen: mit Kürzungen, Sparzwängen und einem Verlust an kommunaler Gestaltungsfähigkeit für die nächsten Jahre.
_________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_________
Der Haushalt 2025, am 28. April 2025 unter denkbar knappen Bedingungen beschlossen, war von Anfang an ein Pulverfass: Nur mit einer Stimme Mehrheit – ermöglicht durch die Enthaltung eines BFC-Mitglieds (Herr Hans-Jürgen Heine) – wurde der Beschluss gegen den Widerstand der Opposition von der CDU-Fraktion (Crivitz und Umland), der AfD-Stadtfraktion und Teilen der BFC-Fraktion durchgesetzt. Die CWG-Fraktion, angeführt von Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, ihrem ersten Bürgermeister Markus Eichwitz und dem CWG-Fraktionschef Andreas Rüß, setzte ihren sturen Kurs durch – koste es, was es wolle.
Doch ein politischer Beschluss ersetzt keine haushaltsrechtliche Genehmigung. Und genau diese blieb aus. Ganze acht Monate und elf Tage befand sich die Stadt in einer vorläufigen Haushaltsführung – ein Zustand, der nicht nur Investitionen blockierte, sondern auch das Vertrauen in die kommunale Steuerungsfähigkeit erschütterte. Die Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim verweigerte die Genehmigung – nicht nur wegen überzogener Kreditansätze, sondern auch wegen gravierender Versäumnisse bei den Jahresabschlüssen. Die Abschlüsse der Jahre 2022 und 2023 lagen nicht vor – ein klarer Verstoß gegen § 60 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V, der die zeitnahe Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnungen verlangt. Ohne diese Zahlen fehlte der Rechtsaufsicht jede belastbare Grundlage zur Bewertung der Haushaltslage. Die Stadt konnte weder neue Verpflichtungen eingehen noch Investitionen umsetzen – ein Zustand, der die kommunale Handlungsfähigkeit massiv einschränkte.
Erst am 11. September 2025 fiel das Urteil – und es war ein Schlag ins Gesicht der CWG-Fraktion. Die Rechtsaufsicht genehmigte den Haushalt nur unter erheblichen Einschränkungen und Auflagen. Die ursprünglich geplanten Verpflichtungsermächtigungen wurden von 1.218.000 € auf 828.000 € gekürzt. Investitionskredite, die mit 585.000 € angesetzt waren, wurden auf 225.000 € reduziert. Der Kassenkreditrahmen von 2.500.000 €, der bereits 21 % der laufenden Einzahlungen ausmachte und damit die genehmigungsfreie Grenze deutlich überschritt, wurde versagt und auf 1.200.270 € begrenzt – also um über 50 %. Außerdem wurde die Stadt verpflichtet, bis zum Jahresende mindestens 812.050 € im laufenden Haushalt einzusparen – mit sofortiger Vollziehung.
Diese Auflagen sind nicht nur eine haushaltsrechtliche Maßregelung, sie sind die Quittung für eine seit Jahren kritisierte und falsche Finanzstrategie der CWG-Fraktion. Eine Politik, die auf hohe Investitionsquoten, steigende Ausgaben und fortlaufende Kreditaufnahmen setzte, ohne die strukturelle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Die Folge: schwindende Rücklagen, aufgebrauchte Kapitalreserven, eine Liquiditätslücke von fast fünf Millionen Euro bis 2028 – und eine dauernde Leistungsfähigkeit, die mit –70,0 Punkten als gefährdet eingestuft wurde.
Besonders brisant ist die Geschwindigkeit, mit der die Stadt die geforderten Einsparungen nachweisen konnte. Innerhalb von zehn Tagen wurden rund 800.000 € „freigemacht“ – ein Umstand, der Fragen aufwirft: Wie realistisch war die ursprüngliche Haushaltsplanung? Wie viel „Luft“ war tatsächlich eingeplant? Und wie glaubwürdig ist diese Haushaltsführung, die solche Summen auf Knopfdruck einsparen kann, während gleichzeitig von finanzieller Not gesprochen wird?
Auch die Investitionsplanung gerät ins Wanken. Der geplante Anbau der Feuerwehr – Crivitz, der durch eine neue Planungsvariante plötzlich eine Million Euro teurer geworden wäre, wurde kurzerhand verworfen. Eine neue Planung soll folgen – irgendwann. Doch angesichts der haushaltsrechtlichen Lage ist klar: Dieses Projekt wird frühestens 2027 oder 2028 realisierbar sein. Denn künftig wird jede Kreditaufnahme einzeln genehmigt werden müssen – abhängig von Liquidität und Haushaltslage.
Und dennoch: Am 24. September 2025 beschloss der mehrheitlich CWG-geführte Hauptausschuss neue Ausgaben. Zwei Kommunalfahrzeuge für den Crivitzer Bauhof im Gesamtwert von 225.000 €, Brandschutzmaßnahmen an der Regionalen Schule für 285.000 €, der Austausch der ELA-Zentrale für 45.000 €. Damit sind die Mittel für 2025 endgültig ausgeschöpft. Die Kassen sind leer. Doch das nächste Kapitel beginnt bereits: In 75 Tagen muss der Haushalt für 2026 vorgelegt werden – ein Haushalt, der unter noch schwierigeren Vorzeichen stehen wird. Denn die Ausgaben steigen weiter: höhere Kreis- und Amtsumlagen, ständig steigende Personal-und Baukosten, kaum Spielraum für neue Investitionen. Viele Projekte werden gestrichen werden müssen. Viele Wünsche bleiben unerfüllt.
Ein Wort wird die kommenden Beratungen in den nächsten Jahren bis 2029 dominieren: S P A R E N.

Die Geschichte des Haushalts 2025 ist damit nicht abgeschlossen. Sie ist der Auftakt zu einer tiefgreifenden haushaltspolitischen Neuorientierung, die längst überfällig ist. Die Bürgerinnen und Bürger von Crivitz haben ein Recht auf Transparenz, auf Wirtschaftlichkeit, auf eine Finanzpolitik, die nicht auf Hoffnung, sondern auf Realität basiert. Denn was heute beschlossen wird, wirkt weit in die Zukunft – auf die Infrastruktur, auf die Lebensqualität, auf die kommunale Selbstständigkeit. Es liegt nun an der Stadtvertretung, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und den Kurs zu korrigieren. Sonst wird aus dem „Haushaltsplan des Grauens“ ein strukturelles Haushaltsdesaster – mit fatalen Folgen für die Zukunft der Stadt Crivitz.
Fazit:
Die haushaltspolitische Krise in Crivitz ist kein plötzliches Unglück, sondern das Ergebnis jahrelanger Fehlentscheidungen, mangelnder Weitsicht und politischer Sturheit. Statt rechtzeitig Verantwortung zu übernehmen und strukturelle Probleme offen anzugehen, wurden persönliche Vorteile priorisiert – wie die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen im Dezember 2024 –, während sich die finanzielle Lage der Stadt bereits bedrohlich zuspitzte. Der Haushalt 2025 wurde unter Missachtung haushaltsrechtlicher Grundlagen durchgesetzt, ohne genehmigte Jahresabschlüsse, mit überzogenen Kreditansätzen und ohne Rücksicht auf die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt.

Die spätere Genehmigung durch die Rechtsaufsicht – unter drastischen Auflagen – war kein grünes Licht, sondern ein Warnsignal. Besonders bezeichnend ist, dass die Stadt binnen weniger Tage über 800.000 € einsparen konnte, was Zweifel an der Seriosität der ursprünglichen Planung aufwirft. Crivitz steht nun an einem Scheideweg: Entweder gelingt ein glaubwürdiger Kurswechsel hin zu Transparenz, Sparsamkeit und Verantwortung – oder die Stadt riskiert ihre finanzielle Handlungsfähigkeit und das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger auf Jahre hinaus.
16.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./459[163(38-22)]/CLA-295/34-2025
*Sötenbarg* schrumpft – „Crivitz West“ als halbe Lösung?
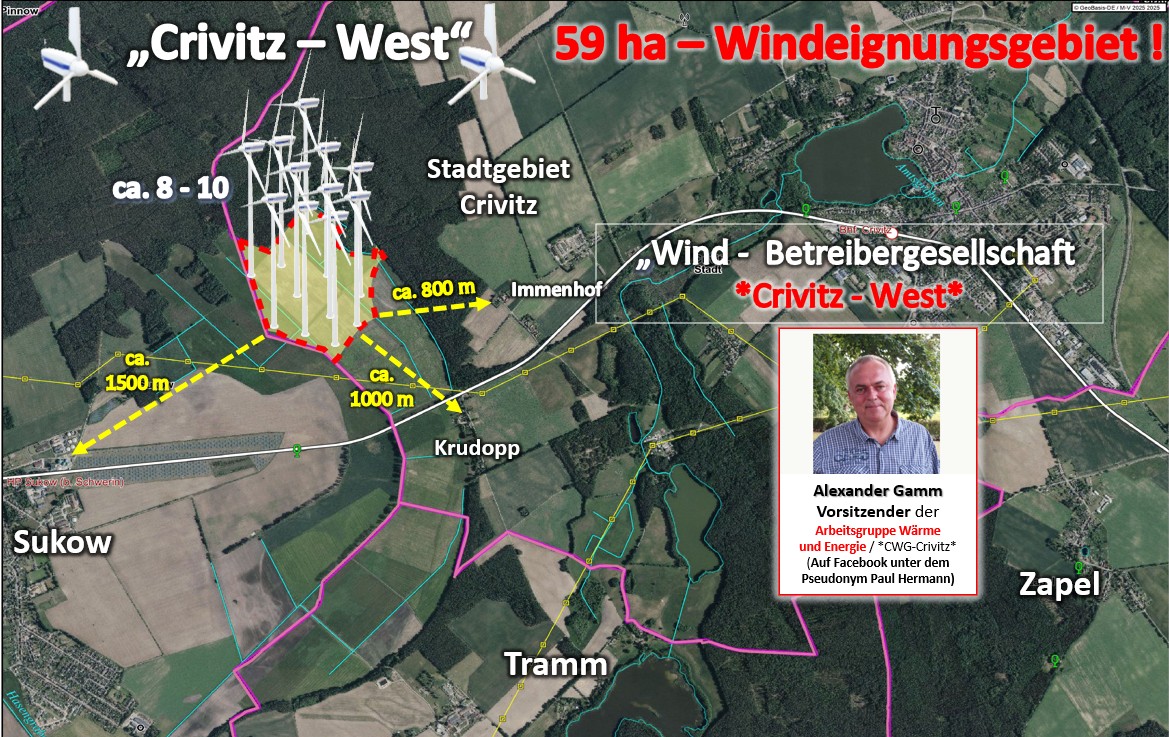
Die rund 59,33 Hektar große Fläche am Waldrand, derzeit genutzt als Acker- und Dauergrünland, bietet auf den ersten Blick ausreichend Raum für Windkraftnutzung. Rein rechnerisch könnten dort etwa 11 bis 12 Windräder errichtet werden – vorausgesetzt, alle Flächen wären uneingeschränkt nutzbar. Doch realistisch betrachtet, also unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten, liegt das Potenzial deutlich darunter. Teile der Fläche sind im Flächennutzungsplan als Schutzgebiet für Moorentwicklung ausgewiesen, was eine Bebauung stark einschränkt oder ganz ausschließt. Hinzu kommt ein nachrichtlich dargestelltes Bodendenkmal, das ebenfalls Einfluss auf die Platzierung und Genehmigungsfähigkeit einzelner Anlagen haben kann. Auch die Lage am Waldrand bringt zusätzliche Anforderungen mit sich – etwa in Bezug auf Artenschutz, Schall- und Schattenwurf sowie Zuwegungen. Unter diesen Bedingungen ist davon auszugehen, dass sich auf der Fläche realistisch etwa 8 bis 10 Windräder genehmigungsfähig unterbringen lassen – vorausgesetzt, der Flächennutzungsplan wird entsprechend geändert und alle erforderlichen Umwelt- und Fachgutachten fallen positiv aus.
In Crivitz, jener kleinen Stadt mit großer Geschichte, weht seit geraumer Zeit ein Wind, der nicht nur die Felder streift, sondern auch die Gemüter bewegt. Es ist ein Wind der Veränderung – doch statt frischer Brise scheint er durch verschlossene Türen zu ziehen, durch Sitzungsräume, deren Fenster zur Öffentlichkeit verriegelt sind. Was sich hier in den vergangenen Monaten rund um die Windenergieplanung abgespielt hat, ist mehr als nur technisches Verwaltungshandeln. Es ist ein Lehrstück über Macht, Einfluss, politische Wiederauferstehung – und über eine Bürgerbeteiligung, die in der Theorie existiert, in der Praxis aber immer wieder übergangen wird.
Bereits im Juni 2024 hatte die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH einen Antrag beim Regionalen Planungsverband Westmecklenburg eingereicht. Ziel war die Aufnahme des rund 117 Hektar großen Gebietes „Sötenbarg“ als neues *Voranggebiets* für Windeignung. Die Fläche liegt strategisch günstig zwischen Sukow, Tramm und Crivitz, mit guter Windhöffigkeit und direkter Netzanbindung über ein neues Umspannwerk bei Wessin. Alles schien vorbereitet – die technischen Voraussetzungen erfüllt, die Infrastruktur vorhanden, die Argumente überzeugend.
Doch die Entscheidung der 75. Verbandsversammlung der regionalen Planungverbandes Westmecklenburg am 1. Oktober 2025 fiel anders aus: Die Fläche wurde abgelehnt. Eine Aufnahme sei für das Erreichen des aktuellen Flächenbeitragswerts von 1,4 % bis 2027 nicht notwendig. Vielleicht ab 2030, hieß es. Vielleicht. Die WEMAG zeigte sich mit dem Beschluss des Planungsverbandes nicht einverstanden. Der Wegfall geplanter Windflächen bedeutet für das Unternehmen hohe Verluste – sowohl durch bereits erbrachte Vorleistungen als auch durch entgangene Erträge. Schadensersatzforderungen stehen im Raum. Doch das Thema „Sötenbarg“ ist damit keineswegs abgeschlossen: Die 117 Hektar Potenzialfläche könnten schon bald wieder auf die politische Tagesordnung kommen. Denn was heute abgelehnt wird, kann morgen wieder strategisch relevant sein.
Während die UKA auf eine überregionale Lösung setzte, hatte die WEMAG Netz GmbH längst eine andere Strategie gewählt – eine, die auf kommunaler Ebene ansetzte. Bereits im Mai 2025 stellte sie einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Crivitz beim Amt Crivitz. Ziel: die Ausweisung eines Windenergiegebiets im Bereich „Crivitz West“. Anders als bei UKA ging es hier nicht um ein Vorranggebiet im Regionalplan, sondern um eine kommunale Lösung – mit direkter Beteiligung der Stadt Crivitz. Und diese war vorbereitet: Schon im November 2024 hatte die Stadt Crivitz eine Absichtserklärung mit der mea Energieagentur MV unterzeichnet. Geplant sind Fernwärme für das Wohngebiet „Neustadt“, Photovoltaik auf städtischen Dächern, Windräder auf kommunalen Flächen. Alles unter dem Banner der Sektorenkopplung – Strom aus Wind, Wärme für alle.
Doch wer wusste davon? Wer wurde gefragt? Die Bürger jedenfalls nicht. Im September 2024 ließ er sich Herr Alexander Gamm als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Energie und Wärme – nicht lumpen und spendierte der Öffentlichkeit großzügige sechs Minuten – auf zwei DIN-A4-Seiten verteilt. Ein kurzer, aber erlesener Einblick in das Konzept, der gerade so ausreichte, um den Schein der Öffentlichkeit zu wahren! Eine geradezu bemerkenswerte Geste, wenn man bedenkt, dass sämtliche vorherigen und zukünftigen Sitzungen sowie Beschlüsse ausschließlich im Verborgenen abgehandelt wurden und weiterhin werden.
Dabei ist die Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns eindeutig: Bei überörtlich bedeutsamen Planungen müssen Bürger frühzeitig informiert und beteiligt werden. Doch in Crivitz scheint diese Regel eher als Option verstanden zu werden – eine, die man ignorieren kann, wenn sie unbequem wird. Weder der UKA-Antrag noch die WEMAG-Initiative wurden transparent kommuniziert. An die Stelle offener und nachvollziehbarer Entscheidungen ist ein System getreten, in dem Abläufe nicht mehr transparent sind und informelle Netzwerke die Richtung vorgeben. Wichtige Weichenstellungen scheinen weniger in den dafür vorgesehenen Gremien als vielmehr im geschlossenen Zirkel der Führungsebene getroffen zu werden, ohne die Öffentlichkeit einzubeziehen.
Besonders deutlich wurde die politische Atmosphäre rund um das Windenergieprojekt am 18. September 2025, als der Bauausschuss der Stadt Crivitz tagte. Was als reguläre Sitzung begann, entwickelte sich rasch zu einem Paradebeispiel für die intransparente und konfliktreiche Art, mit der zentrale Zukunftsfragen in Crivitz behandelt werden. Der Tagesordnungspunkt zur Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans – konkret zur Ausweisung des neuen Windeignungsgebiets „Crivitz West“ – tauchte zunächst im öffentlichen Teil der Sitzung auf. Doch kaum war er genannt, wurde er unter dem Vorwand weiterer Klärung in den nichtöffentlichen Teil verschoben. Die Begründung kam von Alexander Gamm, dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, der mit einem knappen „Da müssen wir aber noch einmal darüber reden“ den Deckel auf das Thema legte – und damit die politische Schatztruhe erneut verschloss.
Doch nicht nur die inhaltliche Verschiebung war bemerkenswert. Auch die Art und Weise, wie Herr Alexander Gamm ( in Facebook auch als Paul Hermann unterwegs) sich in der Sitzung verhielt, sorgte für Unmut. Gleich zu Beginn der Sitzung hat er ein Mitglied der AfD-Fraktion mit den Worten „Wir legen keinen Wert auf Sie hier“ brüsk abgewiesen – eine persönliche Herabwürdigung, die weder durch den Vorsitz noch durch andere Ausschussmitglieder sofort unterbunden wurde. Die Mimik der übrigen Teilnehmer sprach Bände: Irritation, Unbehagen, aber kein Widerspruch. Erst als Herr Alexander Gamm später auch anwesende Bürger verbal angriff, griff der Ausschussvorsitzende ein und rief ihn zur Ordnung – allerdings erst, nachdem Alexander Gamm seinem politischen Frust freien Lauf gelassen hatte.
Diese Szene ist kein Einzelfall. Alexander Gamm, der bei der Kommunalwahl 2024 mit nur 67 Stimmen auf Rang 33 landete und keinen Sitz in der Stadtvertretung erringen konnte, wurde später durch die CWG – Crivitz (Crivitzer Wählergemeinschaft) jener Wählergruppe, aus der auch seine Ehefrau ( Britta – Brusch Gamm) stammt und die mittlerweile die Bürgermeisterin stellt – als sachkundiger Einwohner in den Bauausschuss benannt. Seitdem ist er wieder auf seiner alten Wirkungsstätte aktiv, mit einer Rhetorik, die oft weniger von Sachlichkeit als von persönlicher Abrechnung geprägt ist. Seine Auftritte in öffentlichen Sitzungen sind regelmäßig von provokanten Kommentaren, abwertenden Gesten, Zwischenrufen und einer Haltung durchzogen, die eher an politische Selbstinszenierung als an konstruktive Ausschussarbeit erinnert.
Gerade in einem Gremium, das über zentrale Infrastrukturprojekte entscheidet – über Windkraft, Wärmeversorgung, kommunale Beteiligungsmodelle – ist ein solches Verhalten nicht nur unangemessen, sondern gefährlich. Es untergräbt das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Prozesse, erschwert sachliche Diskussionen und verstärkt den Eindruck, dass in Crivitz politische Entscheidungen nicht im Licht der Öffentlichkeit, sondern im Schatten persönlicher Interessen getroffen werden.
„Energiewende mit Preisetikett – Crivitz zwischen Gewinn und Gemeinwohl“

So soll also die Stadt Crivitz mit 30–40 % an einer neuen Betreibergesellschaft für das neue Windeignungsgebiet *Crivitz West* beteiligt werden – ein Schritt, der weitreichende finanzielle und politische Folgen haben könnte. Diese Gesellschaft soll gemeinsam mit der WEMAG Netz GmbH und der mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern gegründet werden und die Errichtung sowie den Betrieb moderner Windkraftanlagen auf städtischen und gegebenenfalls auch Umlandflächen übernehmen. Grundlage für diese Kooperation bildet eine bereits im September 2024 unterzeichnete Absichtserklärung zwischen der Stadt Crivitz und der mea, in der neben der Windenergie auch die Entwicklung eines Wärmeversorgungsprojekts für das Wohngebiet „Neustadt“ vereinbart wurde. Ziel ist eine sektorenübergreifende Versorgung, bei der Strom aus Windkraft direkt zur Wärmebereitstellung genutzt wird – ein Modell, das unter dem Begriff „Sektorenkopplung“ zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Stadt Crivitz bringt dabei nicht nur Flächen ein, sondern wird von Beginn an als aktiver Gesellschafter in die Projektentwicklung eingebunden. Der kommunale Anteil soll nicht nur symbolisch sein, sondern sich auch finanziell bemerkbar machen: Laut Projektbeschreibung wird jede genehmigte Windenergieanlage vermutlich jährlich zwischen 36.000 und 40.000 Euro an die betroffenen Gemeinden des Amtes Crivitz (sicherlich Crivitz und Sukow) – abwerfen. Diese Einnahmen könnten eine neue, stabile Säule im kommunalen Haushalt darstellen, insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Mittel. Darüber hinaus ist ein lokaler Strompreisbonus vorgesehen, der den Bürgern direkt zugutekommen soll und als Instrument zur Akzeptanzsteigerung dient. Die Betreibergesellschaft selbst soll diesen Bonus als Fixbetrag pro genehmigter Anlage bereitstellen – ein Modell, das nicht nur ökologisch, sondern auch sozialpolitisch Wirkung entfalten könnte.

Doch hinter dieser wirtschaftlich vielversprechenden Konstruktion verbirgt sich auch eine politische Dimension, die Fragen aufwirft.
Die Projektentwicklung des Windenergievorhabens „Crivitz West“ wird derzeit maßgeblich von der mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH vorangetrieben – und zwar vollständig auf deren eigene Kosten und Risiko. Das bedeutet: Noch bevor die Stadt Crivitz formell in die Betreibergesellschaft eintritt oder konkrete Haushaltsmittel bereitstellt, übernimmt die mea die gesamte Vorleistung für Planung, Genehmigung und fachliche Absicherung des Projekts. Sie koordiniert das komplexe Genehmigungsverfahren, das für die Errichtung von Windenergieanlagen erforderlich ist, und beauftragt spezialisierte Planungsbüros sowie unabhängige Gutachter mit der Erstellung aller notwendigen Unterlagen. Dazu zählen insbesondere die raumordnerischen, naturschutzfachlichen und technischen Fachgutachten, die für die Antragstellung bei den zuständigen Behörden unerlässlich sind.
Diese Vorgehensweise zeigt, wie ernsthaft und strategisch die mea das Projekt „Crivitz West“ verfolgt. Sie investiert nicht nur finanziell, sondern auch planerisch in eine Infrastruktur, die langfristig die Energieversorgung der Stadt transformieren könnte. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Stadt Crivitz in eine komfortable Position gebracht wird: Sie kann sich als Mitgesellschafterin mit einem Anteil von 30 bis 40 Prozent an der späteren Betreibergesellschaft beteiligen, ohne die initialen Risiken tragen zu müssen. Die Vorleistung der mea schafft somit nicht nur die planerischen Voraussetzungen, sondern auch eine politische und wirtschaftliche Grundlage für die spätere kommunale Beteiligung – mit potenziell hohen Einnahmen und Einflussmöglichkeiten.
Doch diese Konstellation wirft auch Fragen auf: Wer kontrolliert die inhaltliche Ausgestaltung der Gutachten? Wie transparent werden die Ergebnisse kommuniziert? Und wie wird sichergestellt, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Crivitz nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch und sozial berücksichtigt werden? Denn während die Projektentwicklung professionell voranschreitet, bleibt die öffentliche Diskussion bislang aus – ein Umstand, der angesichts der Tragweite des Vorhabens dringend korrigiert werden sollte.
Gerade für politisch angeschlagene Akteure, die bei vergangenen Wahlen wenig Rückhalt fanden, bietet sich hier eine Bühne zur Reetablierung. Die Aussicht auf Mitgestaltung, Einfluss und möglicherweise auch Vergütung innerhalb der Gesellschaft macht die Windenergie nicht nur zu einem ökologischen, sondern auch zu einem machtpolitischen Projekt. Kritiker sprechen bereits von einer „Karriere-Oase“, in der sich neue Netzwerke bilden und alte Kontakte reaktivieren lassen.
Doch diese vielschichtige Konstruktion aus Energiepolitik, Haushaltsstrategie und kommunaler Beteiligung verdient eine öffentliche Diskussion, die ihrem Gewicht gerecht wird. Denn was hier entsteht, ist ein komplexes Geflecht aus ökonomischen Interessen, politischer Selbstverortung und struktureller Machtverlagerung. Die Bürgerinnen und Bürger von Crivitz haben ein Recht darauf, frühzeitig informiert und beteiligt zu werden – nicht nur als Nutznießer, sondern als Mitgestalter einer nachhaltigen und demokratisch legitimierten Energiezukunft. Transparenz, kritische Begleitung und der Blick auf das Gemeinwohl müssen dabei im Zentrum stehen. Nur so kann aus einem Windprojekt ein echtes Gemeinschaftsprojekt werden – und aus der politischen Schatztruhe ein offenes Buch.
Das Fazit lautet daher:
Die Windenergie in Crivitz ist ein Projekt mit großem Potenzial – ökologisch, ökonomisch und sozial. Doch dieses Potenzial kann nur dann zum Tragen kommen, wenn die Prozesse, die es hervorbringen, demokratisch legitimiert, transparent geführt und kritisch begleitet werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen frühzeitig informiert, ernsthaft beteiligt und respektvoll behandelt werden. Nur dann wird aus Windkraft ein Gemeinschaftsprojekt – und nicht ein exklusives Karrieresprungbrett in der politischen Windstille.
30. Aug. 2025 /P-headli.-cont.-red./458[163(38-22)]/CLA-294/33-2025
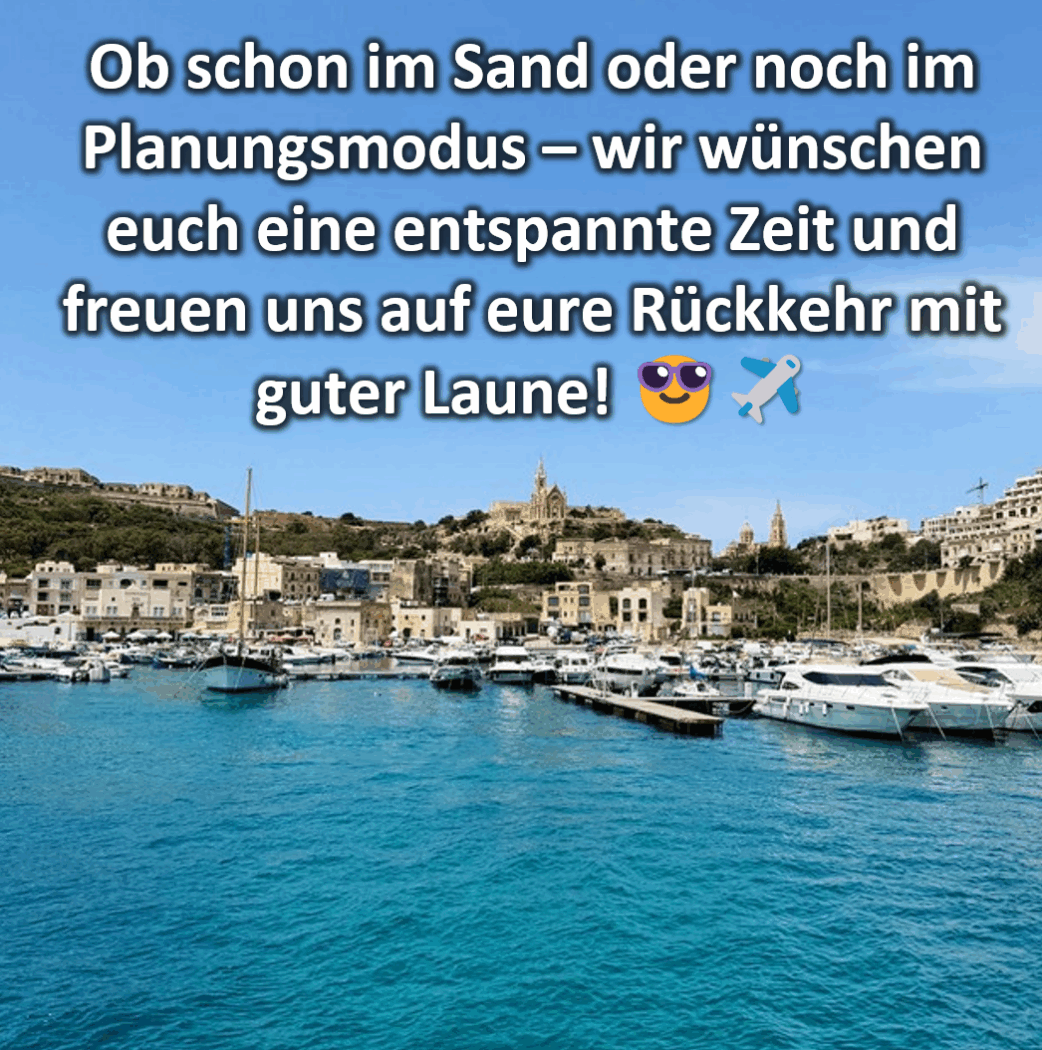
Unsere Redaktion sonnt sich noch ein wenig auf der Urlaubsinsel ☀😎
Bis alle von uns ihren wohlverdienten Urlaub genossen haben, gönnen wir uns noch ein paar entspannte Tage zum Auftanken.
Schon bald sind wir wieder mit frischem Kopf und spannenden Themen für euch da – einige Highlights haben wir bereits recherchiert und akquiriert, und wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen- ihr dürft gespannt sein!
Bleibt neugierig, bleibt uns treu – und bis ganz bald! 💛
17. Juli 2025 /P-headli.-cont.-red./457[163(38-22)]/CLA-293/32-2025
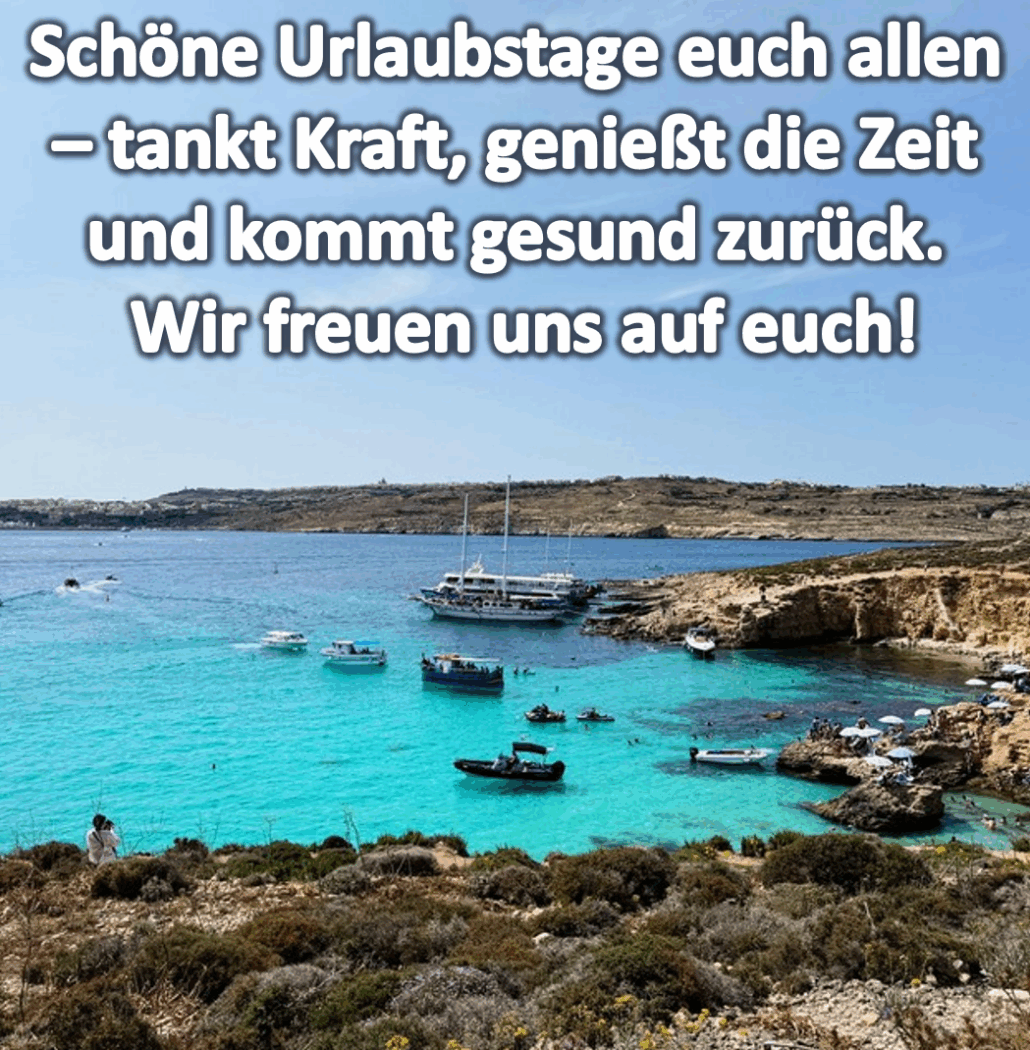
Mit besten Grüßen von der Redaktionsbrücke!
Ab dem kommenden Wochenende gönnt sich unser gesamtes Redaktionsteam eine kleine Auszeit unter der Sonne. Wir tanken neue Energie, lassen die Gedanken schweifen und sammeln frische Inspiration – und melden uns schon bald mit spannenden, neuen Themen zurück bei euch. ☀️📝
Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit – bleibt neugierig und voller Vorfreude!
05. Juli 2025 /P-headli.-cont.-red./456[163(38-22)]/CLA-292/31-2025
Sport für alle? Nicht hier! Ein Pachtvertrag, der nur einem bevorzugten Verein dient!

In Crivitz hätte es eine friedliche Koexistenz zwischen zwei Hundesportvereinen geben können. Doch was sich über Jahre entwickelte, war kein sportlicher Wettstreit, sondern ein politisches Machtspiel, das einen Verein an den Rand der Existenz drängte. Während der Hundesportverein Lewitzrand e.V. verzweifelt um eine faire Lösung kämpfte, zog der HSV Crivitz Eichholz e.V. mit seinen politischen Verbündeten im Hintergrund die Fäden – geschickt, berechnend und ohne Rücksicht auf Verluste seit fast 24 Monate.
Bereits am 11. Juli 2023 war die Richtung klar. In einer Ausschusssitzung für Kultur, Sport und Vereine machte Diana Rommel, die damalige Vorsitzende des HSV Crivitz Eichholz e.V. und gleichzeitig sachkundige Einwohnerin der CWG-Fraktion, unmissverständlich deutlich, dass der Pachtvertrag ihres Vereins erhalten bleiben müsse. Ihre doppelte Rolle als Vereinsvorsitzende und politische Vertreterin der CWG-Crivitz ermöglichte ihr direkten Einfluss auf die Entscheidung. Im Frühjahr 2022 wurde der Vertrag unterzeichnet – ohne öffentliche Diskussion, ohne Zustimmung der Stadtvertretung und ohne Transparenz. Kurz vor der Kommunalwahl 2024 wurde er dann auf Drängen der Kommunalaufsicht mit der damalige Mehrheitsfraktionen CWG-Crivitz und DIE LINKE/Heine legitimiert.
Dieses Vorgehen war kein Zufall, sondern eine gezielte Strategie. Die CWG-Crivitz und DIE LINKE/Heine wollten eine öffentliche Debatte verhindern. . Es war ein Vertrag, der dem HSV Crivitz Eichholz e.V. exklusive Nutzungsrechte für den Trainingsplatz garantierte und den Lewitzrand e.V. von der Fläche verbannte – ein Vertrag, der eine Front schuf, wo es eigentlich Zusammenarbeit hätte geben können.

Als der Lewitzrand e.V. im April 2024 einen Antrag stellte, um eine zusätzliche Trainingsfläche zu erhalten, passierte nichts. In der Stadtvertretersitzung vom 23. September 2024 fragte Frau Jarchow, Mitglied des Lewitzrand e.V., in der Einwohnerfragestunde nach dem Bearbeitungsstand des Antrags. Doch Bürgermeisterin Brusch-Gamm, als oberste Vertreterin der CWG, verwies sie lediglich an die Verwaltung – eine typische Ausflucht, um eine öffentliche Diskussion zu vermeiden.
Im Versuch, doch noch eine Lösung herbeizuführen, organisierte Hartmut Paulsen, CDU-Fraktionär, und zweiter Bürgermeister, am 26. September 2024 ein Vermittlungsgespräch zwischen beiden Vereinen und der Verwaltung. H. Paulsen Vermittlungsversuch scheiterte – ihm fehlte die Durchschlagskraft, die politische Autorität und die Unterstützung. Etwas später setzte die CDU Fraktion zum nächsten Versuch an – ein Antrag am 9. Dezember 2024 auf die Kündigung des Pachtvertrags mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V.

Doch Markus Eichwitz, frisch gewählter erster Bürgermeister und Fraktionär der CWG-Crivitz, zeigte von Anfang an, dass er die Kontrolle über den Trainingsplatz nicht aus der Hand geben würde. Noch bevor der CDU-Antrag zur Diskussion gelangen konnte, stellte er im Namen der CWG-Crivitz direkt zu Beginn der Sitzung einen Gegenantrag, um den Tagesordnungspunkt ersatzlos zu streichen. Dank der knappen Mehrheit der CWG-Crivitz wurde die Kündigung des Pachtvertrags damit verhindert, bevor eine ernsthafte Debatte überhaupt möglich war – ein taktischer Zug, der bereits 2024 jede Möglichkeit der Vertragsauflösung zunichte machte.

Um sich dennoch als „fairer Vermittler“ darzustellen, schlug Markus Eichwitz eine Unterverpachtung des Trainingsplatzes vor. Angeblich sollte der HSV Crivitz Eichholz e.V. dem Lewitzrand e.V. die Fläche unter frei auszuhandelnden Bedingungen mitnutzen lassen. Doch in den folgenden fünf Monaten seit Dezember 2024 geschah nichts. Statt einer echten Lösung setzte der HSV Crivitz Eichholz e.V. unerreichbare Bedingungen – hohe finanzielle Anforderungen, strenge Auflagen und bürokratische Hürden. Es war eine altbewährte Strategie: Formal wurde eine Lösung angeboten, praktisch war sie jedoch nicht umsetzbar.

Während die Stadtpolitik weiter taktiert und die CWG-Crivitz ihre Kontrolle nicht aufgeben will, kämpft der Hundesportverein Lewitzrand e.V. um sein Überleben. Die nächsten zwölf Monate werden entscheidend sein. Wird es eine faire Lösung geben, oder stirbt der Verein durch politischen Druck und wirtschaftliche Hürden langsam aus?
Die Bürger von Crivitz stehen vor der Frage: War dies eine bloße Verwaltungssache – oder eine gezielte politische Strategie, um einen Konkurrenten auszuschalten? Das Drama um den Hundesportplatz ist noch lange nicht zu Ende. Doch die Uhr tickt.
Fazit:
Politische Machtspiele statt fairer Sport?
Der Kampf um den Hundesportplatz in Crivitz zeigt, wie politische Einflussnahme einen Verein systematisch benachteiligen kann. Durch den geheimen Abschluss des Pachtvertrags ohne Zustimmung der Stadtvertretung wurde der Hundesportverein Lewitzrand e.V. ausgeschlossen, während der HSV Crivitz Eichholz e.V. die alleinige Kontrolle erhielt.

Versuche einer Einigung scheiterten an Taktiken der CWG-Crivitz, die öffentliche Debatten verhinderten, Anträge verzögerten und einen fairen Kompromiss blockierten. Der CDU-Versuch, den Pachtvertrag zu kündigen, wurde von Markus Eichwitz, 1. Bürgermeister und angagierter Fraktionär der CWG, mit knapper Mehrheit im Dezember 2024 abgeschmettert. Sein Vorschlag einer Unterverpachtung blieb eine leere Geste – die Bedingungen waren bewusst unerfüllbar.
Während Lewitzrand e.V. um seine Existenz kämpft, bleibt die Machtfrage offen: War dies reine Verwaltung oder eine gezielte politische Strategie, um einen Rivalen auszulöschen?
Die kommenden Monate werden zeigen, ob noch Platz für Fairness in Crivitz bleibt!
01.Juli 2025 /P-headli.-cont.-red./455[163(38-22)]/CLA-291/30-2025

Crivitz, einst bekannt für seinen kommenden Windpark mit 20 Windmühlen – hochmoderne Hoffnungsschleudern: Sie drehen sich bald, also wird’s wohl irgendwann besser –, den Crivitzer See und den berühmten Fischregen von 1792, hat ein neues Naturwunder hervorgebracht: die wundersame Verwandlung einer Leihgabe in eine steuerfinanzierte Skulptur – ganz ohne Kaufbeschluss. Ein politisches Possenspiel der besonderen Art, garniert mit einem Hauch Magie, einer Prise Vernebelung und einer satten Portion Haushaltszauberei.
Akt 1 – Die Leihgabe, die keiner kaufen wollte (öffentlich)!
Man schreibt das Jahr 2017. Ein Künstler – Heiko Voß, seines Zeichens stahlblauer Schmied und leidenschaftlicher Angler – stellt mit viel Herz und Hammerschwung ein Monument aus Metall auf. Der „Crivitzer Fischregen“. 3,50 Meter Höhe, 300 Kilogramm wiegend, Symbol für einen historischen Wetterkapriolen-Fang, eine Hommage an die Stadtgeschichte. Die Skulptur ist offiziell eine Leihgabe, freundlich überlassen – wie ein Buch von der Nachbarin. Eine wirklich tolle Initiative und Sache!
Die Stadt Crivitz nimmt sich im Jahr 2017 vor: Vielleicht kaufen wir sie später mal. Vielleicht. Wenn es passt. Wenn wir Geld haben. Und so bleibt der Fischregen am See. Still. Majestätisch. Und ganz klar: nicht gekauft.
Akt 2 – Das Programm „Lebendige Innenstädte“: Wie aus Innenstadtbelebung Fischregenfinanzierung wurde!
Schnitt: Oktober 2023. Aus dem Nichts taucht in der Stadtvertretung ein Grundsatzbeschluss auf. Die Bürgermeisterin – nennen wir sie stilvoll „Kapitänin des fiskalen Fischzugs“ – lässt durchblicken, man wolle die Skulptur nun doch kaufen. Und zwar, welch originelle Wendung, aus einem Fördertopf für Citymanagement, offiziell betitelt „Re-Start Lebendige Innenstädte M-V“.
Was hat das Förderprogramm ursprünglich auf der Agenda? Na sowas wie:
Was steht nicht drin? Skulpturen kaufen.
Aber man ist kreativ in Crivitz. Und wenn man einen Förderfisch nicht durch die Vordertür bekommt, dann eben durch den Hintereingang.
Akt 3 – Der Fisch, der nie besprochen wurde!
Der Clou an der Geschichte? Niemand wusste davon. Weder der Kulturausschuss, noch die Stadtvertreter im Jahr 2023, noch die Opposition. Keine Beschlussfassung. Keine Vorlage im Vorfeld. Keine öffentliche Debatte. Nur ein fertiger Antrag an das Ministerium, der – wie durch göttliche Eingebung – bereits vor der offiziellen Vorstellung ausgefüllt war. Der Ausschuss fragt nach Details? Antwort: „Chefsache.“ Die CDU? Still, wie immer! Die LINKE/Heine? Diszipliniert und tief schweigend. Der Rest? Ahnungslos.
Und dann, kaum war der Tagesordnungspunkt durchgenickt, erscheint auf der Stadtseite ein hübsch formulierter Projekttext mit dem Titel „Crivitz MITTENDRIN – Auf der Spur der Fische“. Gut gebrütet im stillen Becken des Bürgermeisteramts, serviert nach 21 Uhr.
Akt 4 – Der Schatz im Abschlussbericht
Der Höhepunkt dieser satirischen Fabel findet sich nicht in einem Theaterstück, sondern – ganz bürokratisch – im Jahresabschluss 2022. Dort, versteckt zwischen Amtsdrucksachen und Buchungssätzen, liest man plötzlich: > Zugang / Erwerb Stahlskulptur „Fischregen“ – 11.305,00 €.Und niemand hatte’s gemerkt! Der Fischregen war plötzlich nicht mehr verliehen – er gehörte uns! Ganz offiziell. Ganz haushaltswirksam. Plus jährliche Abschreibung von 1.490,77 € bis 2030 die jährlich erwirtschaftet werden müssen. Für einen Fischregen, der offiziell nie gekauft wurde.
Und zur Garnierung: Eine Spende der Raiffeisenbank über 1.000 € „zweckgebunden für die Skulptur“ für die Wartung!
Akt 5 – Ein Fischregen wie kein anderer!
Während für die Crivitzer Friedensglocke mühsam Spenden gesammelt wurden – von Bürgern, für Bürger – taucht hier ein Steuergeld-finanzierter Fischregen auf, den niemand bestellt hat, den niemand genehmigt hat, dessen Kauf aber längst erfolgt war. Fast schon märchenhaft, wenn es nicht traurig-komisch wäre.
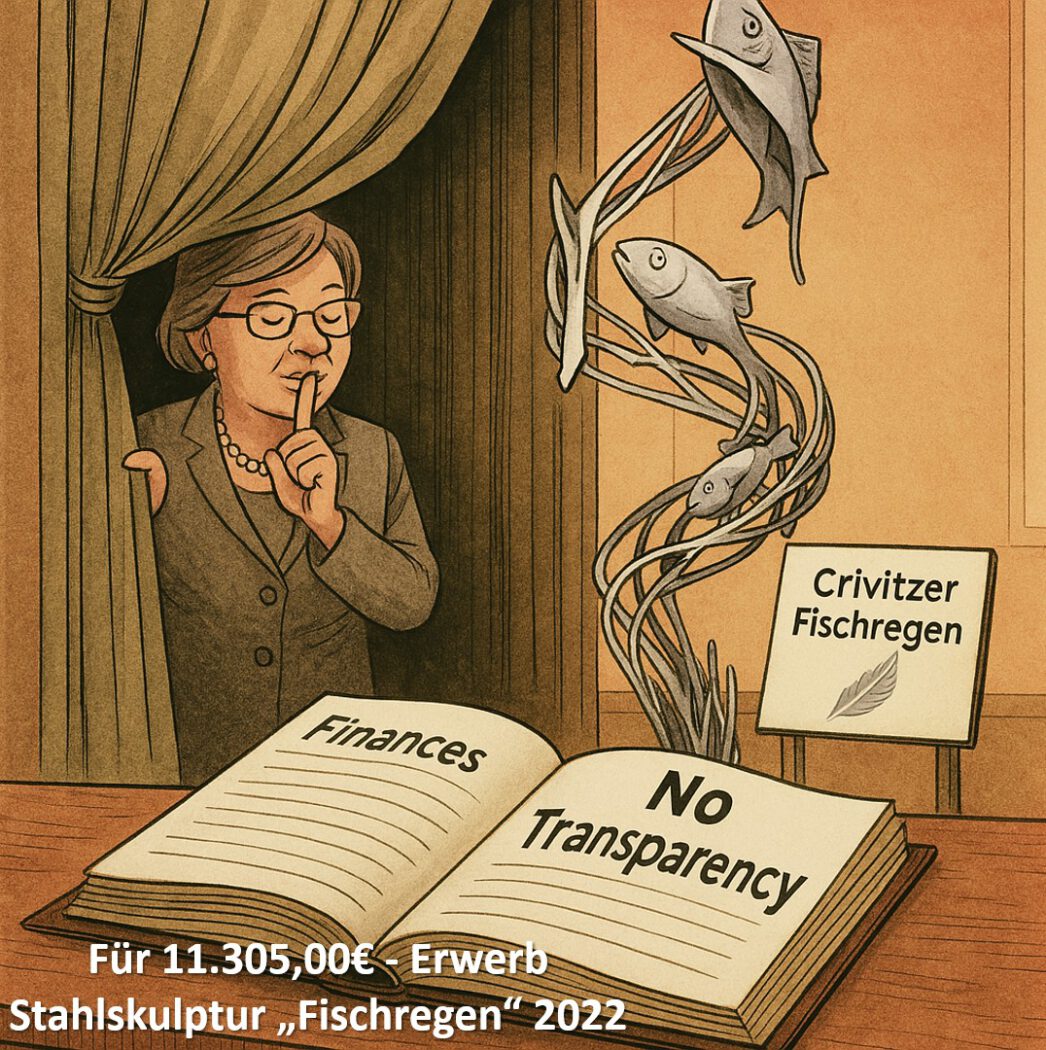
Und jetzt? Jetzt steht er da. Am See. Als Denkmal für:- intransparente Verwaltungskultur,-überraschende Haushaltspositionen,-und für eine politische Ironie, die selbst Loriot Respekt abgenötigt hätte. Wenn du demnächst an der Promenade entlangspazierst und die Sonne auf die verzinkten Flanken der Skulptur scheint, dann nick ihm zu – diesem legendären Fischregen. Er hat mehr erlebt als so mancher Stadtvertreter je erfahren durfte.
Fazit: Kunst aus dem Fördertopf – ohne Mandat, mit Wirkung“
Die Crivitzer Fischskulptur ist nicht nur ein Kunstwerk aus Stahl – sie ist ein Sinnbild dafür, was entstehen kann, wenn Transparenz im Verwaltungsprozess zur Nebensache wird. Statt bürgerschaftlichem Mitgestalten: Stillschweigen. Statt offenem Beschluss: Nachträgliche Haushaltsmitteilung. Statt Spendenaktion wie bei der Friedensglocke: Fördermittel aus einem Programm mit anderem Zweck.
26.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./454[163(38-22)]/CLA-290/29-2025
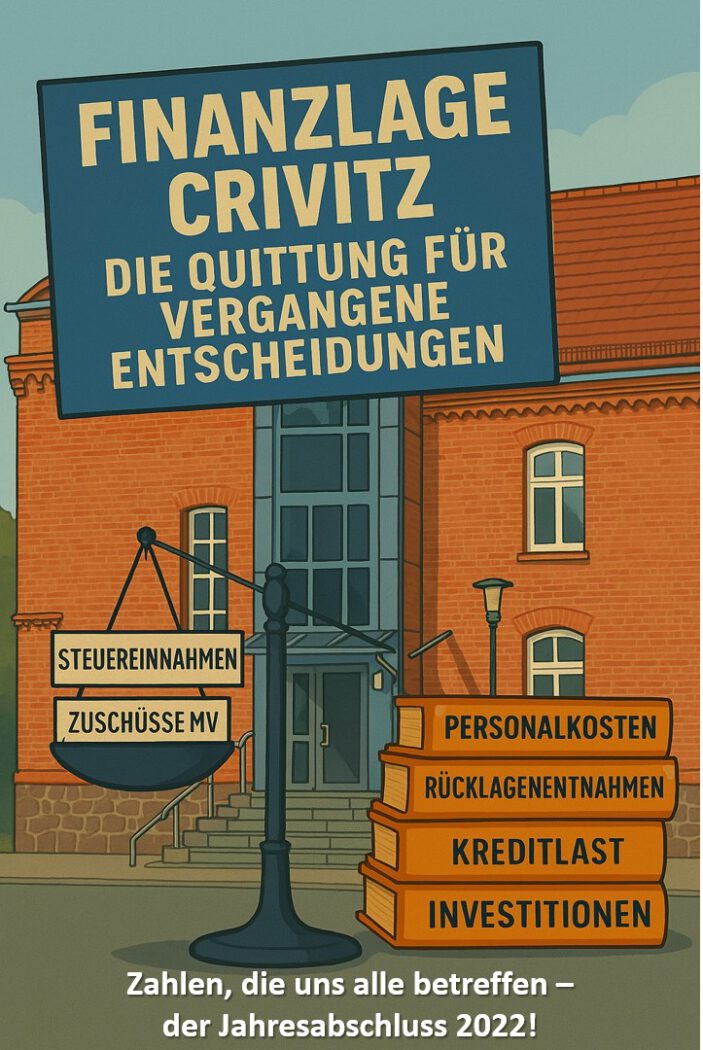
Finanzlage Crivitz – Die Quittung für vergangene Entscheidungen!
Im Sommer 2025 holt Crivitz die Vergangenheit ein – mit voller Wucht. Während die neue kommunalpolitische Amtszeit bereits begonnen hat, erreicht die Öffentlichkeit ein Dokument, das längst hätte veröffentlicht werden müssen: Der Jahresabschluss 2022. Ein Papier, das nüchtern in Tabellen daherkommt, aber bei genauerer Betrachtung ein erschreckendes Kapitel erzählt – das Kapitel einer Stadt, die über Jahre hinweg über ihre Verhältnisse gelebt hat, sich selbst gefeiert hat und erst spät erkennen muss: Der Preis dafür ist hoch. Und er wird noch steigen.
Kapitel 1: Schweigen vor der Kommunalwahl – 2024!
Dass dieser Abschlussbericht erst 30 Monate verspätet veröffentlicht wurde, ist kein bloßer Verwaltungsfehler, sondern ein demokratisches Versäumnis. Denn so wurde den Bürgerinnen und Bürgern – bewusst oder fahrlässig – vor der Kommunalwahl 2024 die Einsicht verwehrt, wie sich bereits im Jahr 2022 dramatische finanzielle Verwerfungen abgezeichnet hatten.
Und dabei hätte genau dieser Bericht vieles erklärt. Etwa die anhaltenden Steuererhöhungen, die zunehmenden Gebühren beim Friedhof, in der Bibliothek oder bei der Nutzung öffentlicher Räume, die längst die Lebensrealität vieler Menschen belasteten. Selbst 2025 wird noch über die Anpassung der Sportstättensatzung debattiert – eine Folge der Finanzierungslast, die damals ihren Ursprung nahm.
Kapitel 2: Der Kurs der CWG – Crivitz und Fraktion Die LINKE/Heine – Fortschritt mit Volldampf ins Defizit!
Schon seit 2014 bestimmten politische Kräfte die Richtung, allen voran die CWG-Fraktion, später getragen oder flankiert durch die Fraktion Die LINKE/Heine. Ihr politisches Mantra: investieren, gestalten, modernisieren. Doch dabei wurde eine einfache Grundregel kommunaler Haushaltsführung missachtet: Man darf nicht mehr ausgeben, als man dauerhaft einnimmt.
Stattdessen wurde der Ausgabenmotor auf Volldampf gestellt:
Kapitel 3: Der Absturz im Zahlenbild!
Der Jahresabschluss 2022 zeigt ein bedrohliches Defizit von –947.009,41€, das nur durch massive Rücklagenentnahmen kosmetisch bereinigt werden konnte. Die Kassenlage verschlechterte sich deutlich:
Gleichzeitig steigen die Personalkosten unkontrolliert:
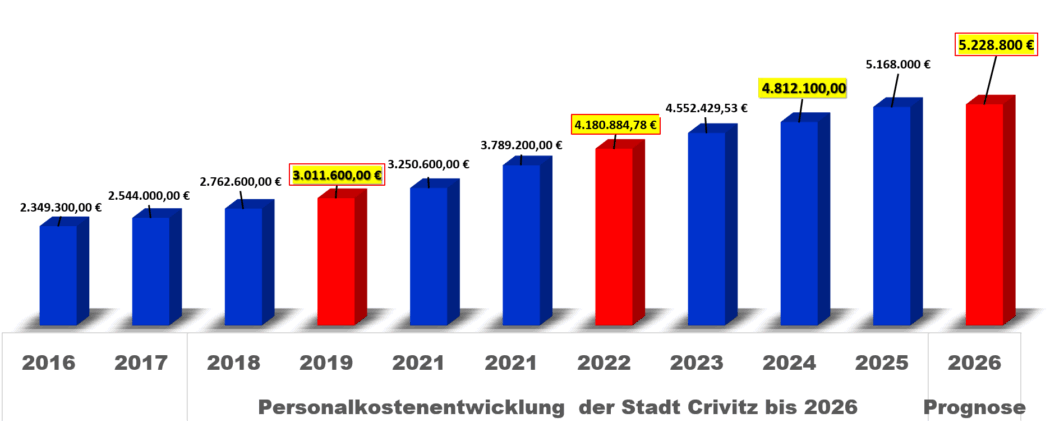
Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Crivitz zeigen sich ähnliche Muster. Die Ausgaben stiegen 2022 auf 312.544,84 € – ein Plus von über 40.000 € im Vergleich zum Vorjahr 2021. Treiber waren unter anderem erhöhte Aufwandsentschädigungen, teils rückwirkend beschlossen, sowie neue Personalstellen wie etwa ein Gerätewart mit Kosten von rund 50.900 €. Hinzu kamen Ausgaben für Fahrzeugwartung, Dienstkleidung und Gebäudeunterhaltung – alles nachvollziehbar und sicher notwendig, aber ohne Gegenfinanzierung eingebunden in ein bereits angeschlagenes Haushaltsgefüge.
Besonders drastisch zeigt sich das Kostenwachstum 2022 auch in anderen Bereichen:
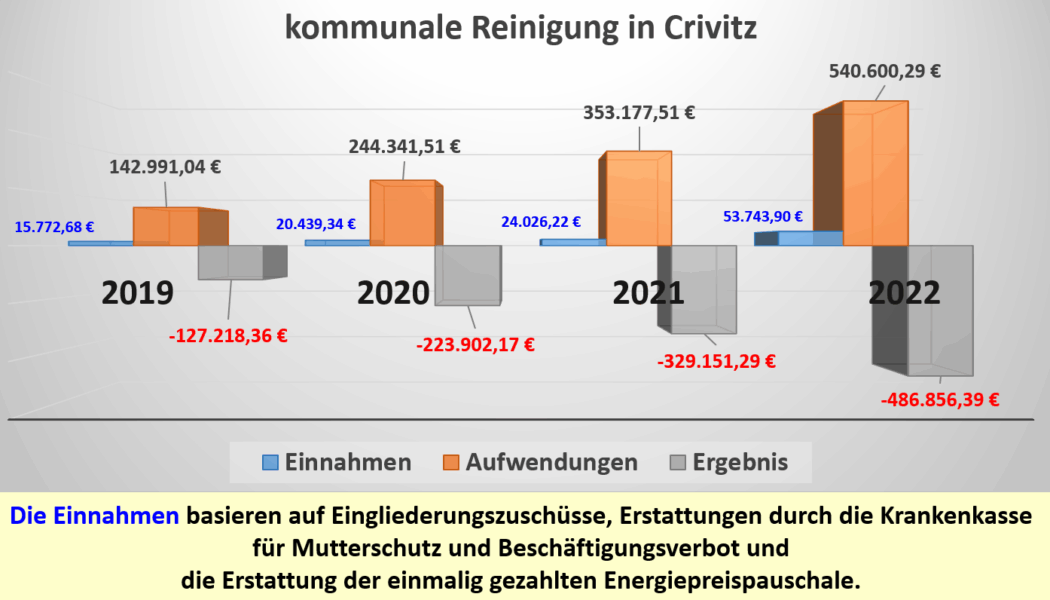
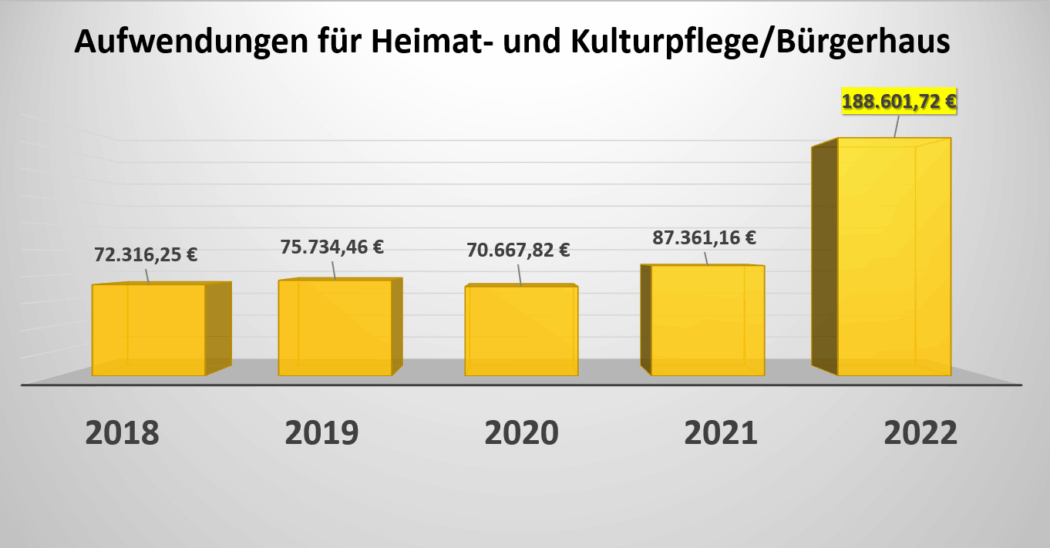
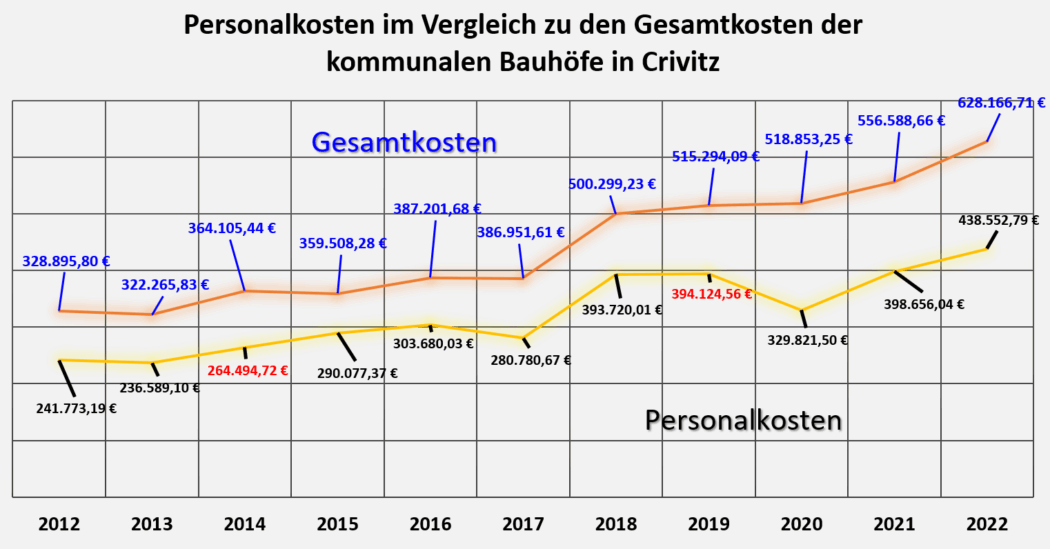
All das verdeutlicht: Ein wachsendes Personaltableau, aber keine betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente.
Kapitel 4: Symbolpolitik statt Substanz!
Trotz dieser finanziellen Schieflage wurden auch 2022 Projekte realisiert, die Symbolkraft über Wirtschaftlichkeit stellten:
Man wollte zeigen, dass Crivitz gestaltet – doch wer gestaltet ohne zu kalkulieren, verliert die Kontrolle.
Und obwohl 2022 die Gesamteinnahmen mit 8,96 Millionen € (aus Steuern und Zuwendungen) solide waren, standen dem Ausgaben gegenüber, die den Haushalt strukturell unterfinanzierten. 2,0 Millionen Euro Schulden, die nicht gedeckt werden konnten. Das strukturelle Defizit lag 2022 bereits bei –314.062,29 € – noch bevor Investitionen für die Folgejahre begannen.
Kapitel 5: Und die Zukunft?
Die Zahlen für 2023 und 2024 sind nicht besser:
Man muss kein Finanzexperte sein, um zu erkennen: Dieser Kurs ist nicht mehr haltbar.
Unser Schlusswort: Die Rechenschaft beginnt jetzt!
Die dramatischen Zahlen des Jahresabschlusses 2022 sind nicht nur ein Verwaltungsakt – sie sind ein politisches Zeitdokument. Die Verantwortung der CWG- Crivitz und Die LINKE/Heine aber auch der CDU-Crivitz und Umland ist in der Vergangenheit klar benennbar, denn sie waren es, die zwischen 2014 und 2022 diesen Kurs nicht nur beschlossen, sondern auch gegen Kritik verteidigt haben. Wer Mahnungen mundtot macht und Rücklagen als Freibrief für Ausgaben missversteht, hat den Gemeinwohlauftrag aus den Augen verloren.
Doch es bleibt Hoffnung – wenn man jetzt handelt:
Was in Crivitz jetzt geschieht, entscheidet darüber, ob diese Geschichte als Tragödie endet – oder als Wendepunkt in eine neue, verantwortungsvolle Politik. Jetzt ist der Moment für Klarheit. Für Mut. Und für einen echten Neuanfang.
Fazit:
Crivitz hat über Jahre hinweg seine finanziellen Grenzen ignoriert und politische Verantwortung durch kurzfristige Gestaltungssymbole ersetzt. Die dramatische Entwicklung, die im Jahresabschluss 2022 offengelegt wurde, ist keine Folge äußerer Umstände, sondern hausgemacht – durch eine Finanzpolitik, die systematisch Rücklagen aufbrauchte, Personal aufstockte, Investitionen auf Pump tätigte und jede Kritik abwehrte.
Demokratische Kontrolle funktioniert nur mit Transparenz, und diese wurde verhindert – 30 Monate verspätete Berichte entziehen den Bürgern ihr Recht auf Mitgestaltung. Wer Mahnungen ignoriert und Risiken verleugnet, riskiert mehr als ein Haushaltsdefizit: Er gefährdet das Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung.
Was jetzt gebraucht wird, ist ein Bruch mit alten Gewohnheiten, eine radikale Kurskorrektur und die Rückkehr zu einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Nur wenn Verwaltung und Politik wieder nach dem Maßstab des Gemeinwohls handeln – statt nach Image oder Mehrheitslogik – hat Crivitz eine Chance auf einen echten Neuanfang. Andernfalls droht das, was in Zahlen begann, zu einem dauerhaften Vertrauensverlust in der Stadtgesellschaft zu werden.
21.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./453[163(38-22)]/CLA-289/28-2025

Was wie eine gewöhnliche Grundstücksveräußerung begann, ist rückblickend zu einem Paradebeispiel für intransparente Kommunalpolitik geworden. Ein scheinbar harmloser Beschluss der Stadt Crivitz aus dem Jahr 2019 mündete nicht nur in einer Schadensersatzforderung von 77.000 €, sondern entlarvte tiefgreifende strukturelle Defizite – bei der Informationsweitergabe, im Umgang mit Verantwortung und vor allem im Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die am Ende alles bezahlen dürfen.
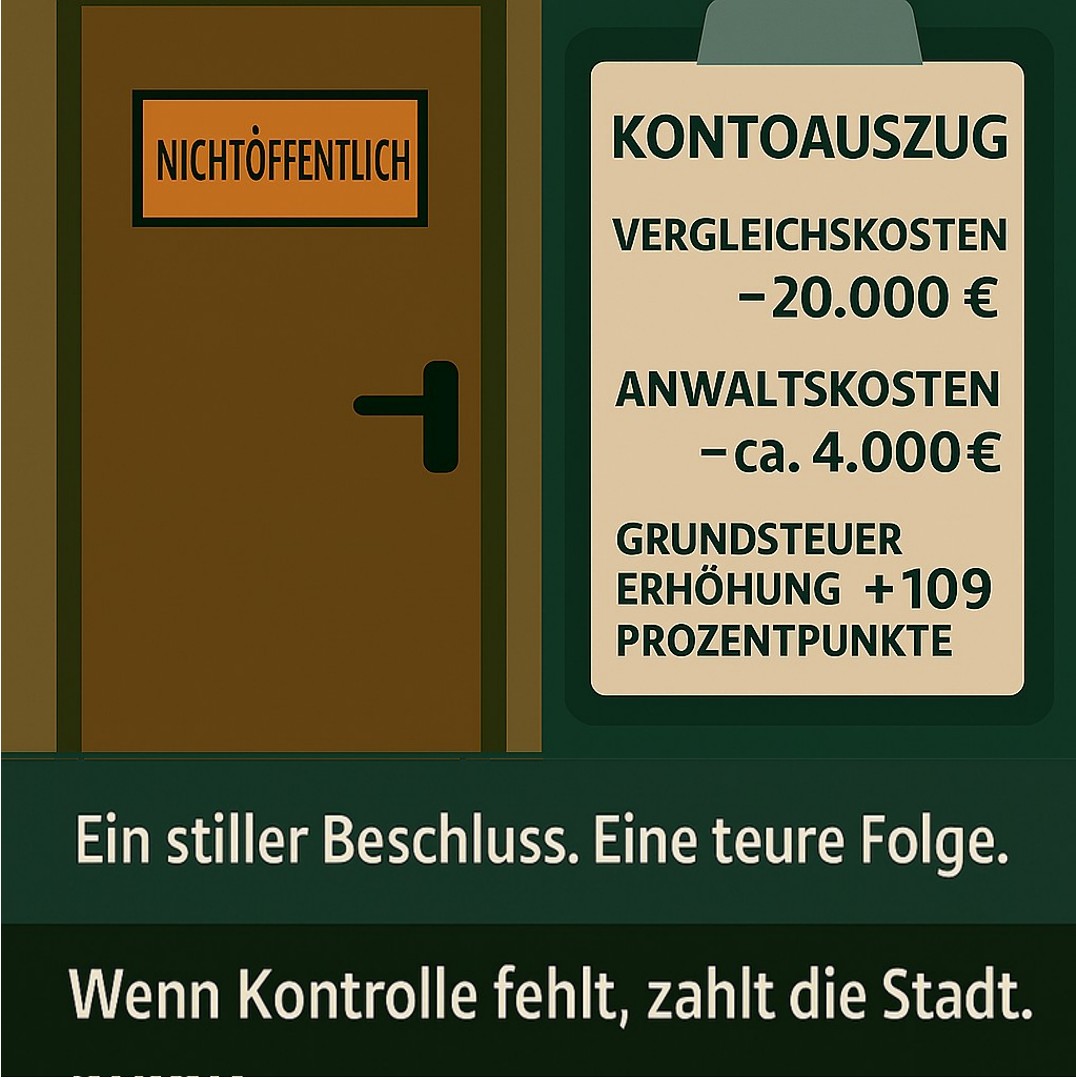
Im April 2019 beschloss die Stadtvertretung Crivitz (BV Cri SV 830/19), kurz vor der Kommunalwahl – was für ein Zufall –, mehrere Grundstücke in der Neustadt, im Gebiet Gemarkung Crivitz, Flur 30, Flurstücke 206/1 (vormals 119, 122 und 123), an die SenCon GmbH zu veräußern. Das Vorhaben versprach Entwicklungspotenzial in Form von Wohnbebauung, einschließlich Projekten für Betreutes Wohnen. Alles schien seinen geplanten Weg zu gehen. Doch es kam anders.
Statt Klarheit und Umsetzung verfiel der Beschluss in Lethargie – ganze 30 Monate lang geschah nichts. Dann, im Oktober 2021, wurde im Hauptausschuss stillschweigend der ursprüngliche Verkaufsbeschluss wieder aufgehoben (BV 445/21) – im nichtöffentlichen Teil der Sitzung, wohlgemerkt. Keine öffentliche Debatte, keine transparente Darlegung der Gründe. Und erschütternder noch: keine Prüfung der möglichen Schadensersatzfolgen, obwohl der Rechnungsprüfer des Amtes Crivitz bereits im Jahr 2019 ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass eine Rücknahme des Beschlusses erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen könnte.
Doch der Hinweis verhallte – nicht etwa versehentlich, sondern offenbar bewusst übergangen. Verantwortung? Nicht wahrgenommen. Transparenz? Fehlanzeige. Stattdessen beschloss die Ausschussmehrheit – erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit – den Verkauf zu kippen, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Erst im Dezember 2023, also vier Jahre nach dem ursprünglichen Hinweis, stellte der Rechnungsprüfer im Jahresabschlussbericht 2021 öffentlich klar, dass die Stadt Crivitz wusste, was auf sie zukommen könnte. Ohne diesen Bericht wäre der ganze Fall vermutlich nie ans Tageslicht gekommen. Es war der unabhängige Kontrollmechanismus, der – als einziger – den Mut und die Verpflichtung hatte, Missstände zu benennen.

Als die Projektgesellschaft im Februar 2022 schließlich 77.000 € Schadensersatz geltend machte, geriet die Stadtspitze in Zugzwang. Die Reaktion war bezeichnend: Man verlegte sämtliche Gespräche und Diskussionen erneut in den nichtöffentlichen Bereich – die Öffentlichkeit blieb systematisch außen vor. Kein Bürger konnte wissen, was dort eigentlich verhandelt wurde. Der Hauptausschuss verhandelte die Forderung still und heimlich – bis zum 1. April 2025. Selbst auf dieser Sitzung wurde der Tagesordnungspunkt so umformuliert, dass kein Bürger erkennen konnte, worum es eigentlich ging. Dort wurde ein gerichtlicher Vergleich beschlossen: Crivitz zahlte 20.000 € an die Klägerin, übernahm ein Drittel der Rechts- und Vergleichskosten – geschätzt weitere 5.000 bis 6.000 € – und ließ damit alle weiteren Ansprüche erledigen. Die Bürger? Erhielten erst am 20. Juni 2025 eine schriftliche Mitteilung über das Urteil – mehr als zwei Monate nach dem Beschluss, fast drei Jahre nach der Klage und ganze sechs Jahre nach dem ersten Grundstücksdeal. Das wirkt wie bewusstes Verzögern, Verschleiern – oder schlichtweg Missachtung demokratischer Transparenz.
Und wer trägt diese Kosten? Natürlich die Bürger. Wieder einmal müssen die Steuerzahler für politisches Versagen einstehen. Ein Versagen, das nicht aus einem plötzlichen Missverständnis resultierte, sondern aus vorsätzlicher Ignoranz gegenüber rechtzeitiger Warnung – aus einem politischen Kalkül, das konsequent versuchte, Fehler unter dem Teppich zu halten. Die Verantwortlichen? Verschwinden in der Masse der Gremien, berufen sich auf die Beschlusslage, schweigen sich aus. Haftung? Keine. Konsequenzen? Fehlanzeige.
Doch der Fall ist mehr als ein Einzelfall. Er zeigt, wie entscheidende Weichenstellungen in nichtöffentlichen Ausschüssen getroffen werden – fern jeder öffentlichen Kontrolle, mit Tagesordnungspunkten, deren Formulierungen so nichtssagend sind, dass sie für Bürger keinen Informationswert mehr bieten. Es ist ein gefährliches Spiel mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit.
Der Grundstücksverkauf war nur Folge eines viel tiefergehenden Problems: Die Erschließung des Wohngebiets „Neustadt“ verschlang seit 1993 rund 11 Mio. DM – umgerechnet etwa 5,6 Mio. €. Die Herstellungskosten lagen bei fast 53 € pro Quadratmeter. In der Eröffnungsbilanz 2012, die erst 2016 veröffentlicht wurde, setzte die Stadt jedoch einen Wert von 70 € pro m² an – deutlich über dem tatsächlichen Bodenrichtwert. Spätere Bewertungen aus dem Jahr 2018 korrigierten diesen Wert zwar auf 38,40 €, doch ein buchhalterischer Verlust von 1,74 Mio. € war bereits entstanden. Wer das zu verantworten hatte? Fehlanzeige.
Noch fragwürdiger wurde es 2018, als René Witkowski, der damalige Finanzchef, in einem Interview erklärte, man habe den Ersatzwert angesetzt, weil man sich die Mühe einer konkreten Recherche im Archiv sparen wollte: „… mit vertretbarem Aufwand nicht recherchierbar.“ (SVZ 19.10.2018) Die damalige Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz), zugleich beruflich auch im Immobilienbereich tätig, kommentierte gegenüber der Lokalpresse sogar: „Mir ist das ziemlich egal, was da auf dem Papier steht.“ (SVZ 19.10.2018) Eine Aussage, die heute wie ein Schlag ins Gesicht verantwortungsbewusster Bürger wirkt.
Besonders pikant: Die Bodenrichtwerte innerhalb Crivitz zeigen gravierende Unterschiede. In der Neustadt liegt dieser bei 26 €, in der Premiumlage Trammer Straße (dem sogenannten Vogelviertel) hingegen bei 75 €. Das Missverhältnis zwischen bilanzierten Werten, tatsächlichem Marktpreis und real erzielbaren Einnahmen ist offenkundig – die Folgekosten trägt letztlich der Steuerzahler.
Bis heute ist der Bebauungsplan Neustadt – trotz der geplanten 5. Änderung seit 2023 – nicht rechtskräftig. Öffentliche Stellungnahmen? Fehlanzeige. Der Bauausschuss, damals geleitet vom Fraktionsvorsitzenden der Linken/Heine, Alexander Gamm (in sozialen Medien auch als „Paul Hermann“ aktiv und inzwischen CWG-Fraktionär), hatte laut Protokoll seit Jahren keine öffentliche Diskussion dazu zugelassen. Politisches Kalkül oder administrative Lethargie?
Was bleibt, ist ein Bild kommunaler Selbstgefälligkeit, bei dem Gremien ihre Entscheidungen treffen, sich gegenseitig decken und das kostspielige Ergebnis den Bürgern aufbürden. Erhöhte Grundsteuern, steigende Gebühren für Bibliotheken, Sportanlagen, Friedhöfe – die Rechnung kommt wie immer bei denen an, die am wenigsten wissen und am wenigsten Einfluss haben.
Doch genau dort muss sich etwas ändern. Entscheidungen dieser Tragweite gehören ins Licht der Öffentlichkeit – nicht hinter verschlossene Türen. Und Menschen, die solche Entscheidungen treffen, müssen Verantwortung tragen – sichtbar und nachvollziehbar.
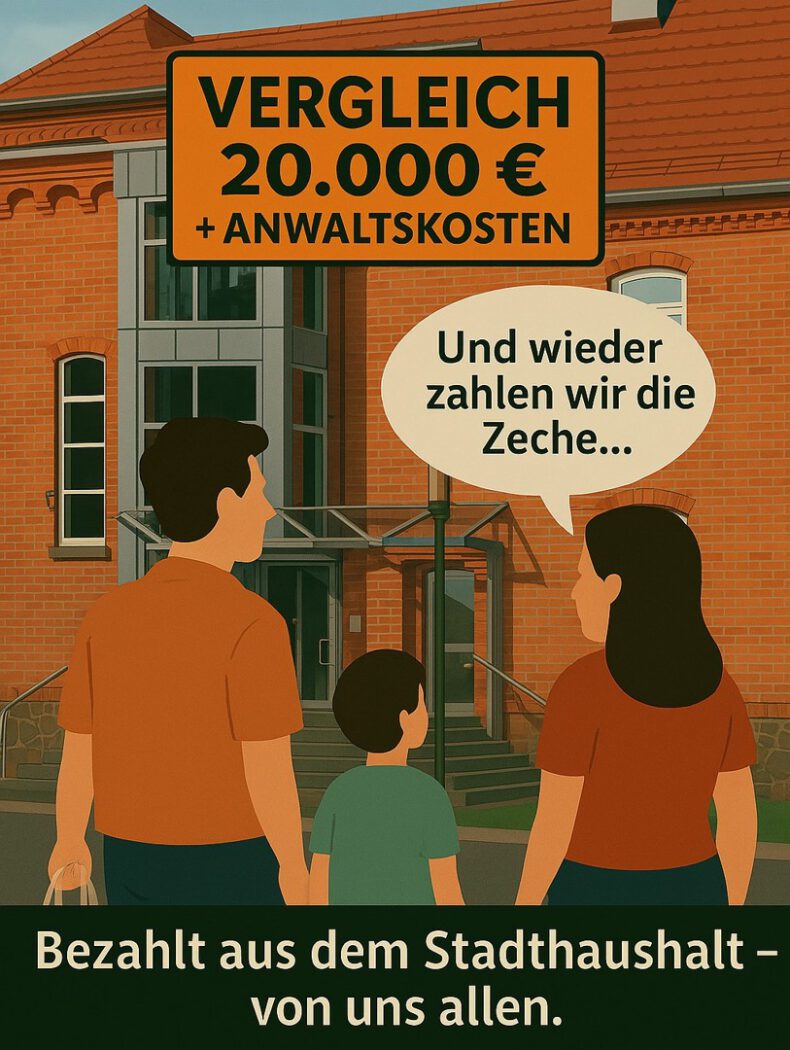
Es ist dem Rechnungsprüfer zu verdanken, dass überhaupt über diesen Fall gesprochen wird. Ohne seine Hartnäckigkeit und Integrität wäre auch dieser Vorgang stillschweigend zu den Akten gelegt worden – wie so viele andere. Doch Kontrolle braucht Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit braucht Mut – bei den Kontrollierenden, aber auch bei den Bürgern, die kritische Fragen stellen und klare Antworten fordern.
Fazit:
Der Fall in Crivitz zeigt auf beunruhigende Weise, wie politische Intransparenz, fehlende Verantwortungsübernahme und das bewusste Ausweichen vor öffentlicher Rechenschaft zu Lasten der Steuerzahler führen. Eine Entscheidung aus dem Jahr 2019 wurde jahrelang verschleppt, Warnungen des Rechnungsprüfers wurden ignoriert, zentrale Beschlüsse im nicht Geheimen gefasst – und erst als es finanziell brenzlig wurde, wurde scheibchenweise kommuniziert, was eigentlich längst öffentlich hätte diskutiert werden müssen.
Dass es ausgerechnet der Rechnungsprüfer war, der den Vorgang 2023 erstmals ans Licht der Öffentlichkeit brachte, unterstreicht die enorme Bedeutung unabhängiger Kontrolle in der Kommunalpolitik. Ohne ihn wäre der teure Deal womöglich vollständig unbemerkt geblieben. Doch statt politischer Aufarbeitung sieht man vor allem eines: Schweigen, Abschieben der Verantwortung und am Ende eine stille Belastung des städtischen Haushalts – finanziert durch die Bürger, die jahrelang im Dunkeln gehalten wurden.
Dieses Beispiel muss Anlass sein, den Wert von Transparenz, offener Debatte und echter politischer Verantwortung in Crivitz neu zu bewerten. Denn Demokratie lebt nicht von verschlossenen Türen, sondern vom Vertrauen der Menschen, die sie tragen – und das darf man nicht weiter verspielen.
19.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./452[163(38-22)]/CLA-288/27-2025

„Poker bis zum Sendeschluss – Wie Crivitz um einen Funkmast stritt und am Ende vom Gesetz überholt wurde“
Wessin, ein beschaulicher Ortsteil von Crivitz, liegt seit Jahren im digitalen Schatten. Kein verlässlicher Empfang, kein 5G, nicht einmal flächendeckendes 2G – und das mitten in Deutschland. Ein Funkloch, das zum Symbol wurde. Symbol für Versäumnisse, Vertuschung und den politischen Kraftverlust einer Kommune, die sich zu lange in taktischen Winkelzügen verlor.
Alles begann im November 2020. Damals trat der erste Investor, die ATC-Germany Holdings GmbH aus Ratingen, an die Stadt Crivitz heran: Ein 40,58 m hoher Stahlgitterturm sollte errichtet werden, um endlich Mobilfunk nach Wessin zu bringen. Der geplante Standort lag auf einer Anhöhe am Ortseingang – funktional durchdacht, topografisch sinnvoll. Und doch endete dieses Vorhaben, bevor es je sichtbar wurde. Warum? Weil die Ortsteilvertretung von Wessin nie aktuell informiert, nie richtig eingebunden, ja nicht einmal zeitgerecht gehört wurde. Ihre letzte Sitzung datierte auf den 15. Dezember 2020. Am 18. März 2021 entschied der Crivitzer Bauausschuss – ohne Rücksprache mit dem Ortsteil. Begründung im Protokoll: „Aus der OTV-Wessin gibt es keine aktuellen Informationen.“ Eine Schutzbehauptung? Ein Trick? Oder schlicht politisches Kalkül?
Es folgte eine taktisch inszenierte Ablehnung des Projekts – nicht öffentlich beraten, wohl aber öffentlichkeitswirksam inszeniert. Man forderte vage Auflagen: eine Immissionsprognose, ein Nachweis über den Schutz von Zugvögeln, eine Prüfung der Zuwegung. Doch was wie Sacharbeit klang, entpuppte sich als Verzögerungstaktik. Der Radweg diente nur als symbolisches Hindernis, und keine der Forderungen mündete je in ein belastbares Gutachten. ATC-Germany zog sich zurück – das Funkloch blieb.
Im Frühjahr 2023 betrat ein neuer Akteur die Bühne: Vodafone GmbH. Diesmal unter gänzlich anderen Vorzeichen. Die Bundesnetzagentur hatte dem Konzern im Rahmen der bundesweiten Funklochschließung klare Ziele gesetzt: 2000 neue Mobilfunkstandorte bis Ende 2025. Einer davon: Crivitz-Wessin.
Doch statt aus alten Fehlern zu lernen, spielte der Crivitzer Bauausschuss dasselbe Spiel erneut – nur mit neuen Karten. Der neue Standort, südlich von Wessin, liegt keine 50 m von der Wohnbebauung entfernt. Ein Biotop – stark zurückgeschnitten, aber ökologisch sensibel – befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die Bürger? Wieder nicht rechtzeitig informiert. Die Unterlagen lagen der Stadt seit Januar 2023 vor, doch öffentlich wurden sie nur kurz am 11. März 2023.
Der Bauausschuss tagte am 16. März – die Ortsteilvertretung wurde erneut erst nachträglich am 22. März 2023 konsultiert. Eine bewährte Dramaturgie: beraten, bevor andere mitreden können. Erneut wurde das gemeindliche Einvernehmen versagt, erneut wurden Auflagen gestellt – diesmal mit Verweis auf Gesundheitsfragen, Grundstückswerte und Umweltschutz. Und erneut: alles im nichtöffentlichen Teil.
Ein Déjà-vu, nun unter neuen Akteuren. Die Rollen waren neu verteilt, das Spiel aber blieb gleich. Alles verschwand wieder in den nicht öffentlichen Bereich bis 2025
Doch dann kippte die Lage.
Am 23. Mai 2025 beschloss der Bundesrat in Berlin, was in Crivitz die politische Statik erschütterte: Der Ausbau digitaler Infrastruktur – darunter Mobilfunk – wurde zum „uneingeschränkt überragenden öffentlichen Interesse“ erklärt. Ein Rechtsstatus, der lokales Einspruchsrecht massiv beschneidet. Der Gesetzgeber gab damit klar die Richtung vor: Schluss mit Funklöchern, Schluss mit Verzögerung.

Für die Stadt Crivitz bedeutete das: Die Karten waren ausgespielt, das Pokerspiel verloren. Alle Taktiken, alle Auflagen, alle Verfahrensumwege – ob aus Vorsicht, aus Machtinteresse oder aus echter Sorge – waren nun bedeutungslos. Der Kreis LUP drückt mächtig auf Tempo. Die zweite Bauausschusssitzung innerhalb weniger Wochen fand am 15. Mai 2025 statt, die nächste folgt schon am 19. Juni – erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jetzt steht das Projekt kurz vor der Realisierung, der Investor bereit, die rechtlichen Weichen gestellt. Und die Bürger? Wieder ausgeschlossen.
In seinem Bauantrag schrieb Vodafone lapidar: „Der gewählte Standort wurde unter Berücksichtigung aller Randbedingungen aus den möglichen Varianten ausgewählt.“ Dazu zählen: funktechnische Eignung, Anbindbarkeit an das Stromnetz, Realisierungskosten – und Vermietbereitschaft. Denn wer Grund und Boden besitzt, hat Einfluss. Der neue Standort wurde von Landwirtschaftliche Produktion und Absatz eG Wessin zur Verfügung gestellt, sowie auch die Standorte für die ca. 20 Windräder. Und plötzlich wurde er zum „einzig darstellbaren“.
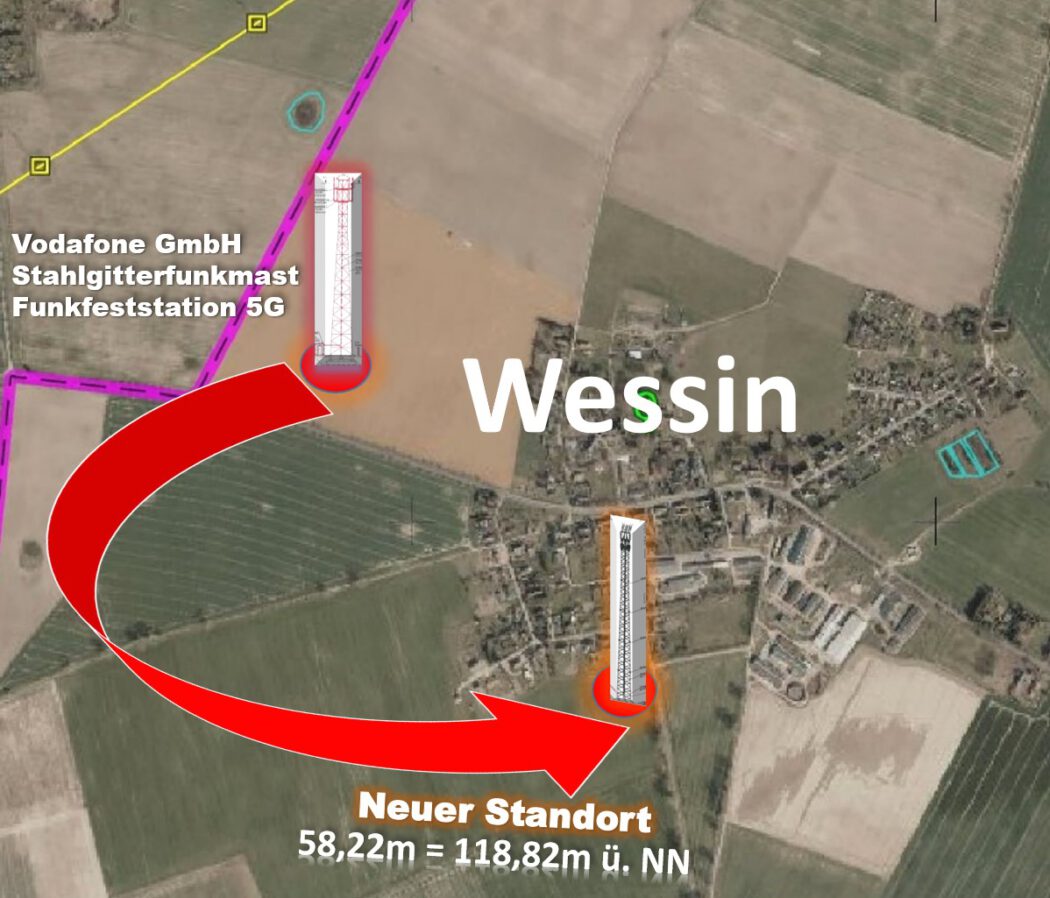
So wuchsen seit 2020 nicht nur Pläne und Paragrafen, sondern auch das Misstrauen. Der Funkmast wurde nie genehmigt – und doch nie wirklich verhindert. Jedes „Nein“ aus Crivitz war ein Flüstern, das im Rauschen der Verwaltung verhallte. Jeder Einwand war teilweise korrekt, aber zahnlos. Die Bürger wurden mit jedem Monat weniger gehört, bis am Ende nur noch Schweigen blieb. Die Folgen für Crivitz sind dramatisch. Die Stadt hat sich jahrelang auf ein politisches Pokerspiel eingelassen – taktiert, verzögert, verschleppt. Die handelnden Personen sind bestens bekannt:
Was bleibt? Eine Chronik politischer Ausflüchte. Eine Geschichte voller Sitzungen ohne Öffentlichkeit, Entscheidungen ohne Beteiligung – und ein Gefühl, das schwerer wiegt als jedes Funkloch: Abgehängt worden zu sein!
Fazit:
Die Geschichte des Funkmasts in Wessin ist keine technische Auseinandersetzung, sondern ein Paradebeispiel für politisches Versagen durch Intransparenz, Machtspiele und fehlende Bürgerbeteiligung. Über fünf Jahre hinweg wurde das Projekt verschleppt, vertagt und im Verborgenen diskutiert – bis das Bundesrecht Fakten schuf.
Der Bauausschuss von Crivitz pokerte mit Investoren, verlor den Anschluss an die Realität und schließlich jede Entscheidungsgewalt. Zurück bleibt ein Mast – und ein tiefes Misstrauen der Bürger gegenüber ihrer Stadtpolitik.
15.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./451[163(38-22)]/CLA-287/26-2025
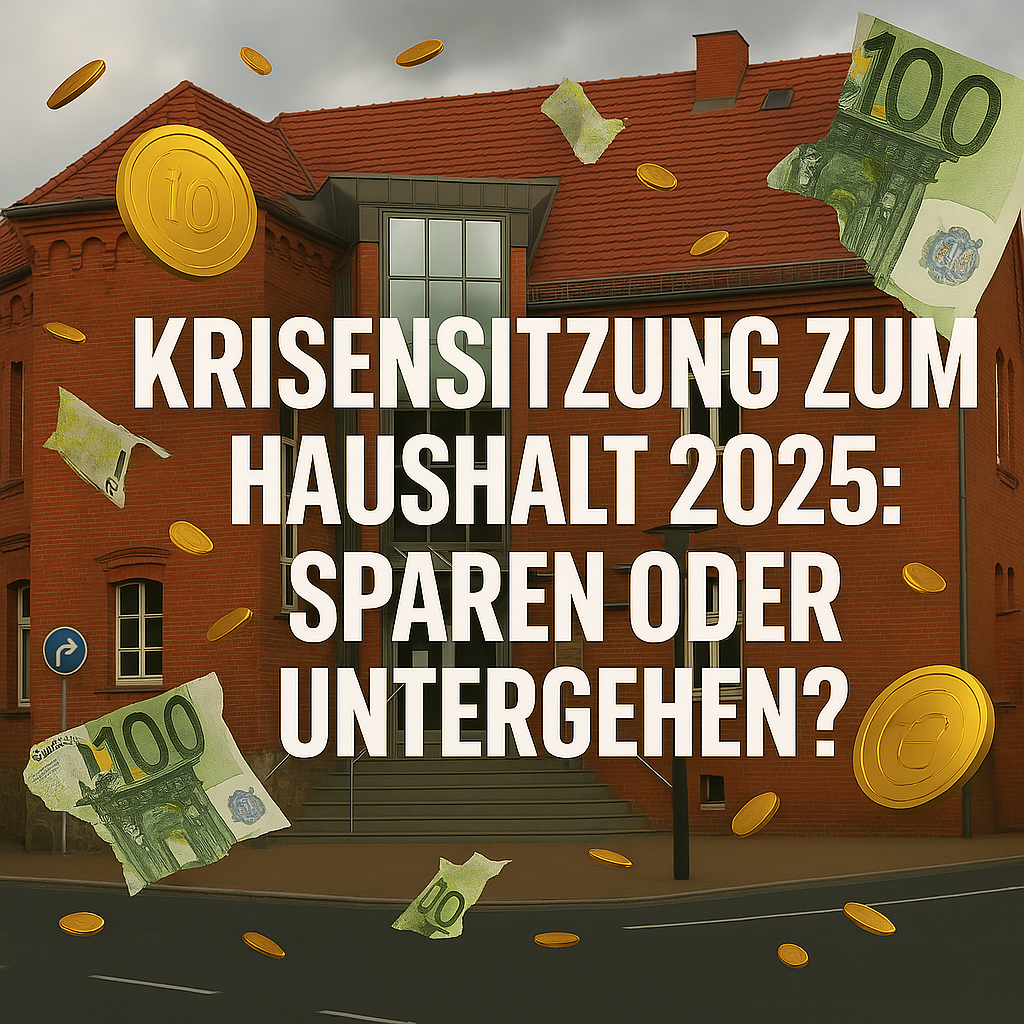
Krisensitzung in Crivitz: Geldprobleme und die große Frage nach Lösungen
Am 16. Juni 2025 findet die dritte Krisensitzung des Jahres statt. Der Sitzungssaal wird erfüllt sein von angespannter Stille und nervösem Gemurmel. Stadtvertreter, Ausschussmitglieder und Ortsteilvertreter werden sich erneut versammeln – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Der Grund? Eine finanzielle Krise, die sich längst nicht mehr abwenden, sondern nur noch verwalten lässt. Es geht um Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen, verzweifelte Rettungsversuche.
1. Das Problem: Kein Geld, nur Schulden
Crivitz hat kein Einnahmeproblem – die Stadt erwirtschaftet weiterhin Geld. Aber die Ausgaben sind außer Kontrolle geraten. Das Jahresergebnis 2025 zeigt ein Minus von 2.020.800 Euro, und die liquiden Mittel werden bis Ende des Jahres auf -1.658.127,38 Euro fallen. In den Folgejahren droht eine noch düsterere Entwicklung: Bis 2028 steigt das Defizit der laufenden Ein- und Auszahlungen auf -4.395.027,38 Euro.
Sparmaßnahmen allein werden nicht helfen. Jede Kürzung, jede Verschiebung von Investitionen in die Jahre 2026 oder 2027 ist nur ein verzweifelter Versuch, die Symptome zu behandeln – die Ursachen bleiben bestehen. Die Finanzreserven der Stadt sind komplett erschöpft. Ohne drastische Maßnahmen wird Crivitz in wenigen Jahren finanziell handlungsunfähig sein.

2. Der Rettungsplan: Kredit oder Sparhammer?
Ein Kassenkredit über 2,5 Millionen Euro soll die Stadt zahlungsfähig halten. Doch dieser Kredit ist genehmigungspflichtig, denn er übersteigt den genehmigungsfreien Rahmen von 1.200.270 € um mehr als das Doppelte. Wenn die Genehmigung nicht kommt, muss die Stadt sich auf massive Einschnitte vorbereiten.
Doch das ist nicht alles: Gleichzeitig stehen neue Investitionen im Raum. 1,1 Millionen € für 2025, ca. 1,0 Millionen € für 2026. Dazu kommen große Projekte wie den stadteigenen ebenerdigen Umbau des Marktplatzes und die Erschließung eines neuen Eigenheimgebiets für das sog. Vogelviertel mit einer eigens errichteten Erschließungsstraße über die Bahnlinie – mit zusätzlichen Millionenbeträgen für die Infrastruktur. Wie sollen diese Vorhaben2028/2029 finanziert werden, wenn nicht einmal Geld für die laufenden Kosten vorhanden sind?
Die Stadt taumelt zwischen ambitionierten Projekten und einem Finanzloch, das tiefer wird. Der Schuldenberg wächst: 774.000 Euro neuer Investitionskredit für die Regionale Schule bis 2047, 1.346.589 Euro für die Kita „Uns Lütten“ bis 2040, 502.091 Euro für die Feuerwehr bis 2045 – die Belastungen erstrecken sich über Jahrzehnte.
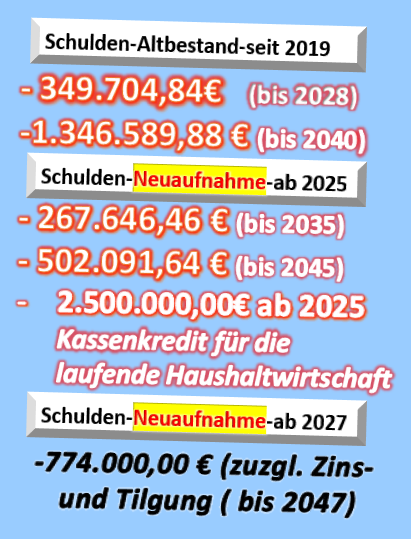
3. Die Steuererhöhung: Rettungsanker oder Bürgerzorn?
Die Stadt muss ihre Einnahmen steigern – also werden die Hebesätze der Grundsteuer angepasst. Grundsteuer A steigt von 261 % auf 283 %, Grundsteuer B auf 543 %. Doch diese Maßnahmen allein reichen nicht aus. Die Stadt braucht mehr Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben.
Die Bürger müssen jetzt doppelt zahlen: Höhere Steuern und gleichzeitig eine Kürzung von Leistungen. Die Stimmung ist gereizt. Die Menschen fragen sich: Wie konnte es so weit kommen?
4. Die Schuldfrage: Wer trägt die Verantwortung?
Die CWG – Crivitz gerät zunehmend in den Fokus der Kritik. Gemeinsam mit der CDU und den Umland-Vertretungen hat sie in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich die finanzielle Entwicklung der Stadt gesteuert – durch Entscheidungen, genehmigte Ausgaben und Investitionen. Doch nun, inmitten der schwersten Haushaltskrise seit Jahren, rückt ihr Handeln in ein neues Licht. Wurde zu sorglos gewirtschaftet? Wurden finanzielle Risiken unterschätzt oder verdrängt? Kritiker werfen insbesondere der CWG – Crivitz vor, stets aus dem Vollen geschöpft zu haben – ohne Weitblick, ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit und aufkommende Generationen.
Seit Februar 2025 war es einzig die AfD-Fraktion, die immer wieder konkrete Sparvorschläge einbrachte. Doch statt konstruktivem Dialog wurde sie – insbesondere von der CWG – Crivitz – ausgelacht, abgewiesen und ins Abseits gestellt.
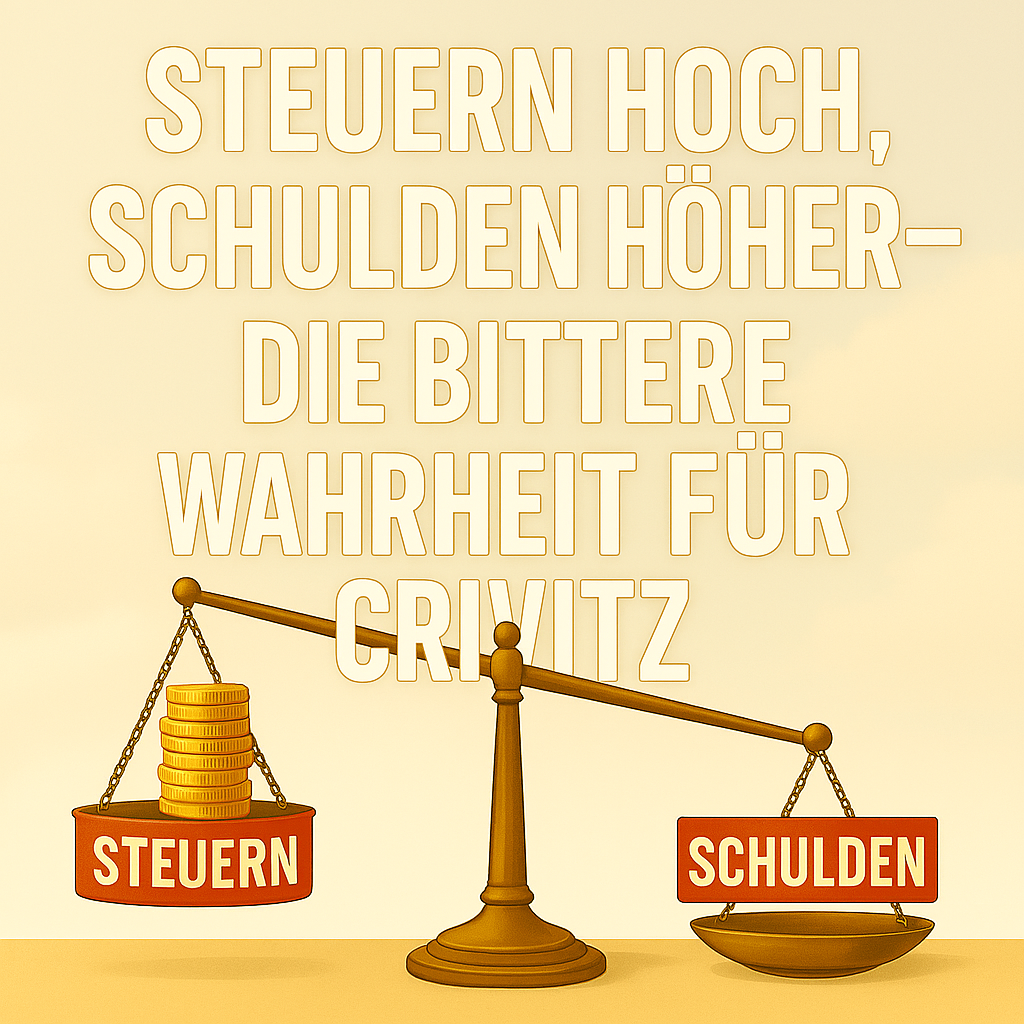
Heute jedoch lacht niemand mehr. Denn was damals belächelt wurde, trifft jetzt mit voller Wucht: Der Haushalt ist in Schieflage. Wer letztlich die Hauptverantwortung trägt, bleibt Gegenstand politischer Debatten. Doch eines ist unumstritten: Diese Fraktionen der CWG – Crivitz und die CDU – Fraktion haben die finanzielle Schieflage über Jahre hinweg mitverursacht. Und nun gibt es keine einfachen Auswege mehr – nur noch schmerzhafte Entscheidungen.
Heute fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger: Wie konnte es so weit kommen? Und wer trägt die Verantwortung für das finanzielle Desaster?
5. Die bittere Realität: Der Abgrund rückt näher
Die Stadt steht vor einer Wahl: Noch mehr Kredite aufnehmen und Steuern erhöhen – mit der Gefahr, dass die Schuldenlast in den kommenden Jahren erdrückend wird. Investitionen radikal kürzen – und damit wichtige Projekte, die für die Stadtentwicklung notwendig sind, auf unbestimmte Zeit verschieben oder ganz streichen.
Beides hat Konsequenzen. Die finanziellen Probleme sind nicht mehr zu ignorieren. Wenn Crivitz nicht sofort handelt, wird die Stadt ihre Haushaltsfähigkeit verlieren – und dann könnte ein Haushaltssicherungskonzept notwendig werden, das vom Landkreis genehmigt werden muss.
6. Die Zukunft: Ein steiniger Weg
Die nächsten Sitzungen werden darüber entscheiden, wie Crivitz aus dieser Krise herauskommt. Einsparungen, Steuererhöhungen, Kreditverhandlungen – all das muss jetzt mit maximaler Präzision geplant werden. Ein Fehler, eine falsche Entscheidung, könnte fatale Folgen haben.
Fazit:
Crivitz steht vor einer finanziellen Zerreißprobe, die keinen einfachen Ausweg bietet. Die Stadt kämpft mit einem dramatischen Haushaltsdefizit, steigenden Schulden und fehlenden liquiden Mitteln, während Investitionen und laufende Ausgaben weiterhin enorme Summen verschlingen.
Steuererhöhungen allein reichen nicht mehr aus – drastische Einsparungen oder neue Kredite sind unausweichlich. Jetzt ist entschlossenes Handeln gefragt, um einen endgültigen finanziellen Kollaps zu verhindern und die Zukunft der Stadt zu sichern.
11.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./450[163(38-22)]/CLA-286/25-2025
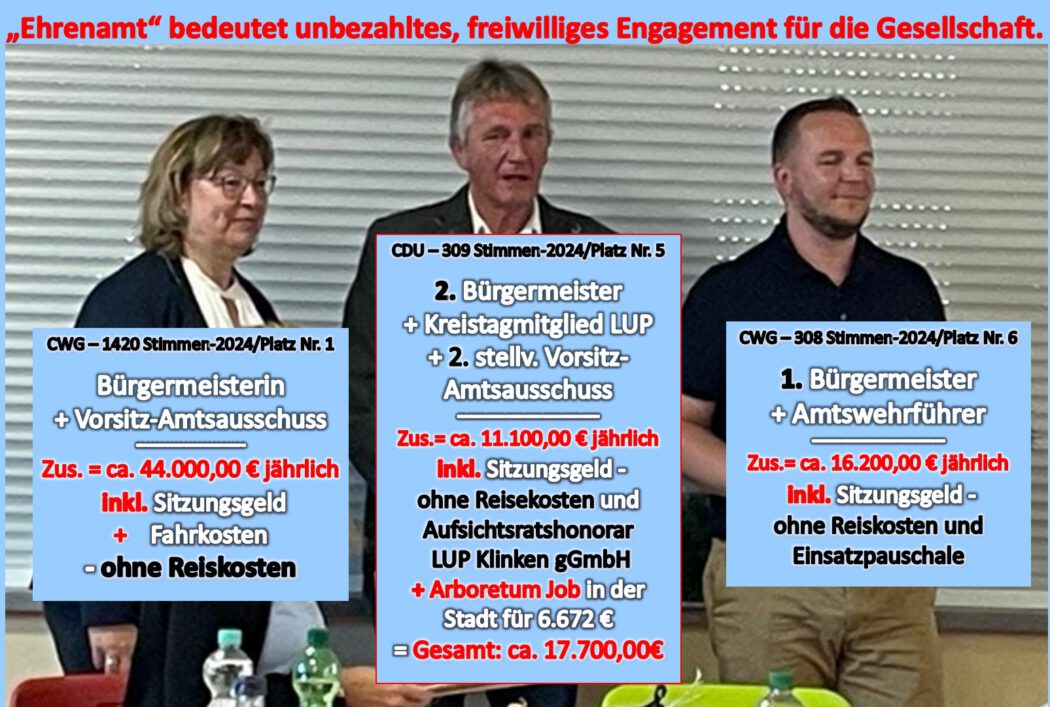
Die Stadt Crivitz – einst ein Ort der Gemeinschaft, des ehrenamtlichen Engagements und des solidarischen Miteinanders. Doch die jüngsten Ereignisse haben dieses Bild ins Wanken gebracht. Während Bürger, ehrenamtliche Helfer und soziale Einrichtungen unter Finanzierungslücken leiden, genehmigen sich die Spitzen der Stadt eine üppige Aufwandsentschädigung – abgabenfrei (außer der Job im Arboretum) mit einer Selbstverständlichkeit, die Fragen aufwirft.
Doch was bedeutet Ehrenamt überhaupt?
Ehrenamt ist der freiwillige und unbezahlte Einsatz für das Gemeinwohl. Es ist eine Arbeit, die aus Überzeugung, sozialem Verantwortungsbewusstsein und dem Wunsch, anderen zu helfen entsteht. Menschen engagieren sich unermüdlich in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Sportvereinen oder sozialen Projekten – nicht aus finanziellen Interessen, sondern weil sie sich für ihre Mitmenschen einsetzen wollen. Und genau hier entsteht das Dilemma. Während Pflegekräfte, Helfer in Behinderteneinrichtungen oder Freiwillige in der Altenpflege oft keinerlei finanzielle Anerkennung für ihr Engagement erhalten, genehmigen sich die Bürgermeister der Stadt Crivitz eine erhebliche Erhöhung ihrer abgabenfreien Aufwandsentschädigungen (außer der Job im Arboretum) – mitten in einer Finanzkrise, die die Stadt schwer belastet.
Frau Brusch-Gamm, die Bürgermeisterin (CWG – Crivitz), kassiert nun bis zu 44.000 € jährlich für alle ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ihr Stellvertreter, Hartmut Paulsen (CDU), kann sich insgesamt + Job im Arboretum über 17.700 € freuen, und der erste Bürgermeister, Markus Eichwitz (CWG – Crivitz), erhält immerhin indgesamt 16.200 €. Eine Erhöhung, beschlossen von der CWG-Crivitz und der CDU sowie BFC vor sechs Monaten. Vor zehn Jahren kündigte die Stadtverwaltung an, während finanzieller Schwierigkeiten freiwillig auf 50 bis 100 € pro Monat zu verzichten – ein Zeichen der Solidarität. Doch 2025 ist dieses Engagement anscheinend vergessen.
Doch wer zahlt die Rechnung?
Die traurige Wahrheit: Der Haushalt der Stadt ist längst in eine wirtschaftliche Sackgasse geraten. Während Bürger und soziale Einrichtungen jeden Euro umdrehen müssen, verschärft sich die Liquiditätslage der Stadt unaufhaltsam. Ende 2024 waren noch 805.000 € verfügbar – doch dieser Betrag wird bereits 2025 vollständig aufgebraucht sein. Die Prognosen sind düster: Bis 2028 klafft ein Defizit von -4,88 Millionen Euro, allein 2025 fehlen bereits über 1,65 Millionen Euro, die durch Kassenkredite gedeckt werden müssen. Doch statt gegenzusteuern, werden teure Eigenlösungen verteidigt und die Selbstversorgung fortgeführt. Dabei liegt die Lösung eigentlich auf der Hand: Warum gibt es keine Einsparungen bei den Bürgermeisterentschädigungen?
Die moralische Frage ist unübersehbar:
Was bedeutet Ehrenamt in Crivitz wirklich? Es soll ein Dienst für das Gemeinwohl sein – freiwillig und ohne Gewinnabsicht. Die aktuellen Entscheidungen der Stadtspitze vermitteln jedoch ein anderes Bild: Statt Verantwortung zu zeigen und Einschnitte in Zeiten der Krise vorzunehmen, werden Eigeninteressen über das Gemeinwohl gestellt. Wenn sich Ehrenamtliche aus Überzeugung und ohne finanzielle Vorteile engagieren – warum sollten Stadtvertreter großzügige Summen erhalten, ohne dass sie abgabenfrei (außer der Job im Arboretum) erfasst werden? Warum nicht die Erhöhungen für gemeinnützige Zwecke einsetzen, etwa zur Unterstützung von Vereinen oder zur finanziellen Entlastung der Eltern bei den gestiegenen Essenskosten in Kitas und Schulen?
Dies könnte eine fatale Fehlentscheidung sein, die langfristige Folgen für die Stadt haben wird. Das Vertrauen der Bürger in die politische Führung könnte nachhaltig beschädigt werden, denn viele Ehrenamtliche leisten ihre Arbeit ohne große Entschädigungen und dürfen dennoch keinerlei finanzielle Unterstützung erwarten. Während die Stadt auf Einsparungen und Haushaltsdisziplin pocht, wird an anderer Stelle ohne Zurückhaltung zugegriffen.
Die Bürger werden genau hinschauen, denn die Steuerlast ist hoch, die Kosten explodieren, und doch scheint dies für manche keine Rolle zu spielen – solange das eigene Konto weiter wächst.Crivitz steht an einem Wendepunkt. Die Bürger sind in der Lage, ihre Vertreter genau zu beobachten – und letztendlich auch darüber zu entscheiden, welche Werte in ihrer Stadt zukünftig im Vordergrund stehen sollen.
Fazit:
Die Diskussion um die Bürgermeisterentschädigungen in Crivitz zeigt einen Widerspruch: Während Ehrenamt eigentlich freiwilliges und unbezahltes Engagement bedeutet, profitieren politische Amtsträger von erheblichen steuerfreien Zahlungen – mitten in einer Haushaltskrise. Während soziale Einrichtungen und Bürger sparen müssen, steigen die Entschädigungen der Stadtspitze deutlich.
Die zentrale Frage bleibt: Sollte das Geld nicht besser direkt in die Gemeinschaft fließen, statt privilegierte Posten zu stärken? Die kommenden Entscheidungen werden zeigen, ob Solidarität oder Eigennutz überwiegt.
08.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./449[163(38-22)]/CLA-285/24-2025

Eigentlich sollte nach einer Wahl Klarheit herrschen: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihre Vertreter, die sich an die Arbeit machen, um ihre Ortsteile zu gestalten. Doch in Crivitz ist die Realität eine andere. Seit einem Jahr gibt es keine neue Ortsteilvertretung – ein Rekord in Sachen politischem Stillstand. Doch woran liegt es wirklich?
Der Ursprung des Chaos
Alles beginnt mit der Kommunalwahl 2024. Die Ortsteile Wessin und Gädebehn sollen endlich ihre eigenen Vertreter direkt wählen können – eine Errungenschaft der Modernisierung des Kommunalverfassungsrechts. Doch schon früh deutet sich an, dass die Umsetzung komplizierter wird als gedacht. CWG-Fraktionschef Andreas Rüß schlägt eine direkte Neuwahl vor, doch erst nach der Wahl wird dieser Vorschlag publik. Warum so spät? War es politisches Kalkül oder eine versäumte Chance?
Die erste Verzögerung ist da. Dann kommen die nächsten Hürden: Das Amt Crivitz ist nicht in der Lage, die Briefwahlergebnisse korrekt für die Ortsteile auszuwerten. Die Wähler haben ihre Stimme abgegeben – doch nun kann nicht einmal sichergestellt werden, wie diese Stimmen lokal zugeordnet werden. Ein demokratisches Fiasko. Man war einfach auf die neue Kommunalverfassung nicht vorbereitet, die wiederum war aber schon seit März 2024 bekannt und trat genau am 01.06.2024 in Kraft! Ein demokratisches Fiasko.

Die Rolle der AfD – Ein radikaler Gegenvorschlag: Während CWG weiter Druck machte, schlug die AfD-Fraktion eine ganz andere Lösung vor: Die Sitze in den Ortsteilvertretungen sollten nicht gewählt, sondern einfach benannt werden – eine Methode, die deutlich weniger Aufwand bedeutet, aber gleichzeitig den direkten Wählerwillen untergräbt. Doch dieser Vorschlag stieß auf heftigen Widerstand. CDU, CWG und BFC lehnten ihn entschieden ab, weil er keine demokratische Wahl vorsah und stattdessen die Besetzung der Ortsteilvertretungen durch eine Art Ernennung regelte. Damit wurde der Vorschlag rasch verworfen – aber die eigentliche Lösung blieb weiterhin aus.
Die Blockade hält an:Doch selbst als die neue Hauptsatzung im Dezember 2024 verabschiedet wird, geht die Verzögerung weiter. Es dauert drei Monate bis März 2025 und erst dann wurde sie veröffentlicht.
Der nächste Rückschlag: Fehler in der Satzung! Gädebehn und Wessin sollen jeweils ihre eigene Ortsteilvertretung bekommen – doch die Wahlmethoden sind völlig unterschiedlich. Eine handwerkliche Panne?
Zwei Ortsteilvertretungen – Zwei völlig unterschiedliche Methoden!
Die neue Hauptsatzung wurde verabschiedet, aber sie enthält einen gravierenden Konstruktionsfehler: Während die Ortsteilvertretung Gädebehn nach einem festen Quoten-Prinzip gewählt werden soll, gilt für Wessin ein völlig anderes Verfahren.
Auf den ersten Blick erscheinen beide Methoden demokratisch. Doch die Folgen könnten gravierend sein: Während in Gädebehn sichergestellt ist, dass jedes einzelne Dorf einen Vertreter erhält, könnten in Wessin ganze Ortsteile unberücksichtigt bleiben. Das Verfahren ist nicht einheitlich – und genau das sorgt für Kopfschütteln und Chaos.
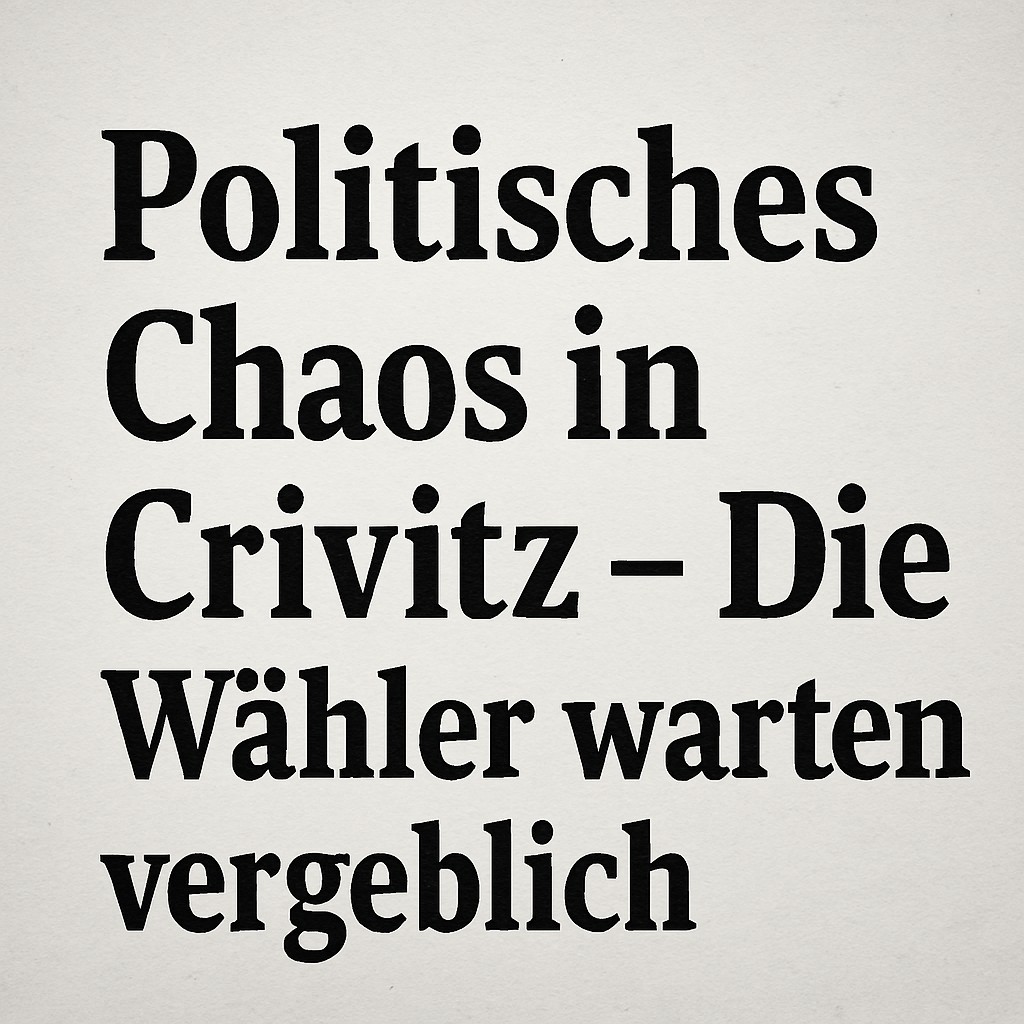
Die Frage bleibt: Warum wird dieses Verfahren nicht einheitlich für alle Ortsteile angewendet? Diese Unklarheit trägt weiter dazu bei, dass die Ortsteilvertretungen bis heute nicht gewählt werden konnten.
Fazit:
365 Tage Stillstand – Wann endet das politische Chaos?
In Crivitz hat sich eine politische Posse entwickelt, die kaum zu fassen ist. Die Parteien sind uneins, das Amt überfordert, und die Bürger warten vergeblich darauf, dass die Demokratie endlich funktioniert. Die CDU und BFC als Opposition schauen zu, während CWG weiter Druck macht – doch ohne Ergebnis.Ein Jahr voller Bürokratie, Pannen und Verzögerungen hat gezeigt: Wenn die Verwaltung nicht vorbereitet ist und sich niemand für eine echte Lösung einsetzt, kann selbst eine scheinbar einfache Wahl zum politischen Desaster werden.
Doch die große Frage bleibt: Wie lange soll dieser Eiertanz noch weitergehen?
04.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./448[163(38-22)]/CLA-284/23-2025

Amt Crivitz. Eine Verwaltung im Stillstand, ein Rechnungsprüfungsamt in permanenter Überforderung und Kommunen, die Millionen-Investitionen planen – basierend auf Zahlen, die nie offiziell bestätigt wurden. Ein Amt, in dem Gesetzestreue offenbar eine optionale Fußnote ist, während Fristen Jahr für Jahr unbeachtet verstreichen. Doch niemand fragt nach. Niemand greift ein. Es ist, als hätten sich alle damit abgefunden, dass in Crivitz das Haushaltsrecht nur eine Empfehlung ist – aber keine Verpflichtung!
Seit 2021 häufen sich die offenen Jahresabschlüsse. 35 finanzielle Bilanzen, die geprüft und bestätigt sein müssten, fehlen – und mit ihnen die Grundlage für jegliche strategische Planung. Während Bürger auf verlässliche Kalkulationen hoffen und Fördermittel für dringend benötigte Investitionen auf nachvollziehbare Finanzdaten angewiesen sind, bleibt die Verwaltung in einem endlosen Strudel aus Verzögerung und Vernachlässigung gefangen.
Die Erfüllungsquote der Jahresabschlüsse? Einst hoch, mittlerweile im freien Fall:
• 2021: 94,7 %;• 2022: 84,7 %;• 2023: 31,6 %;• 2024: Lächerliche 10,5 %
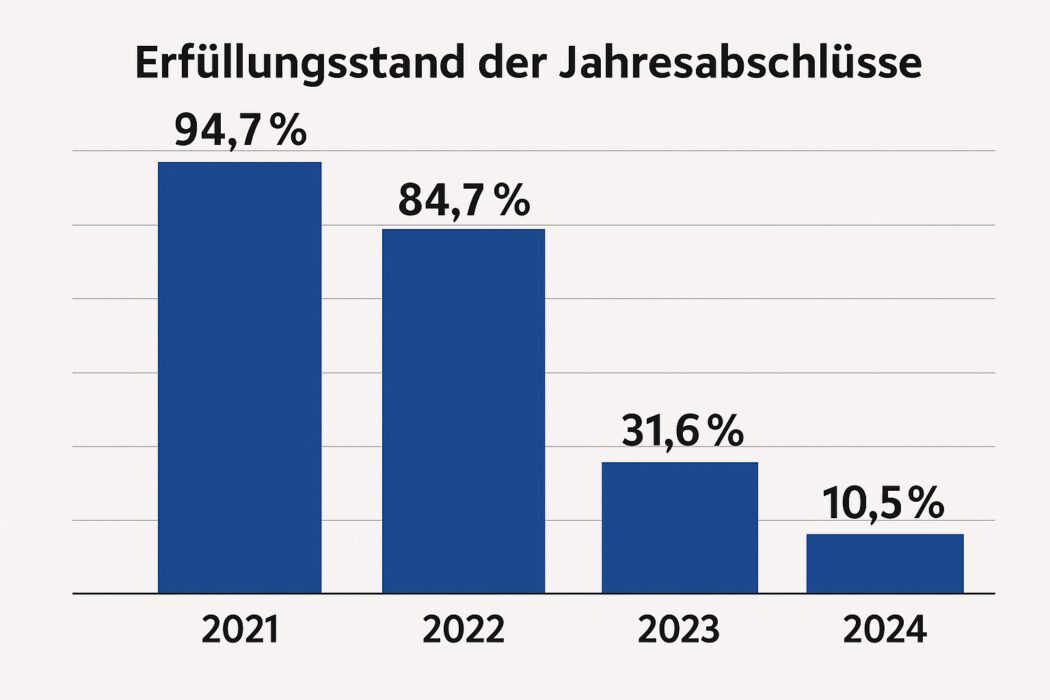
Erfüllungsquote im freien Fall – Was bleibt von finanzieller Kontrolle?“
Es gibt kaum noch eine ernsthafte Bemühung, die gesetzliche Verpflichtung einzuhalten. Gemeinden wie Banzkow, Plate und die Stadt Crivitz, die längst aktuelle Jahresabschlüsse haben sollten, besitzen Abschlüsse nur bis 2021 – und dennoch planen sie Millionen-Investitionen in Schulen und Kitas, ohne auch nur annähernd verlässliche Zahlen. Es ist, als würde man blind in eine Zukunft investieren, deren Fundament reines Wunschdenken ist.
Ein Rechnungsprüfungsamt ohne Kontrolle?
Und dann gibt es das Rechnungsprüfungsamt – Fachbereichsleiter Michael Rachau – jene Institution, die eigentlich Ordnung in das Chaos bringen sollte. Doch statt Klarheit zu schaffen, entstehen weitere Fragezeichen. Seit 10 Monaten verteilt das Rechnungsprüfungsamt nur noch „eingeschränkte“ Bestätigungsvermerke, eine Bankrotterklärung der eigenen Qualitätssicherung in der Arbeit des Amtes für Finanzen (Kämmerei) unter Fachbereichsleiter Rene Witkowski.
Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk bedeutet, dass die Finanzen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, dass Fehler oder Unklarheiten existieren – und dass Bürger, Kommunen und Fördergeber auf wackeligen Zahlen ihre Zukunft bauen. Erklärungen gibt es dazu keine.
Aber das ist nicht einmal das Schlimmste. Seit März 2025 wird der öffentliche Jahresbericht des Rechnungsprüfungsamtes für 2024 nicht mehr veröffentlicht. Geheime Rechenschaftsberichte, versteckt vor den Augen der Bürger, verborgen vor denen, die eigentlich ein Recht darauf haben, zu wissen, wie das Rechnungsprüfungsamt und Amt Crivitz seiner Prüfpflicht nachkommt.
Die Amtsvorsteherin von Crivitz, Iris Brincker, scheint darauf bedacht zu sein, dass niemand erfährt, wie tief die Probleme wirklich reichen. Schon 2024 wurden Rechenschaftsberichte erst auf Nachfrage teilweise veröffentlicht – und selbst diese stimmten nicht mit den aktuellen Ergebnissen überein. Denn Transparenz könnte unbequeme Fragen aufwerfen. Fragen, die unbequem für diejenigen sind, die dieses System aufrechterhalten – und davon profitieren.
Ein System, das sich selbst überschätzt?
Das Rechnungsprüfungsamt wurde geschaffen, um Effizienz zu steigern, sich finanziell zu rechnen und Prüfleistungen durch Kooperationen mit anderen Ämtern auszuweiten. Doch eine entscheidende Rechnung wurde nicht gemacht: Ein Prüfungsamt benötigt ausreichende Mittel und kompetentes Personal, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Stattdessen wurde groß geplant, aber klein besetzt.
Mit einem Minimalteam von drei Mitarbeitern. Doch seit März 2024 ist neben dem Amt Crivitz und Amt hagenow – Land noch das Amt Zarrentin hinzugekommen – 5 weitere Kommunen mit eigenen Haushaltsabschlüssen. Nun müssen jedes Jahr ca. 45 Jahresabschlüsse insgesamt geprüft werden und zusätzlich die Altlasten der Vorjahre von 2022 bis 2024 abgearbeitet werden.Ein naiver Ansatz, der darauf setzt, dass das System irgendwie funktionieren wird – doch die Realität zeigt: Die Aufgabenerfüllung hinkt hinterher.
Während die Karrierechancen bis zum Amtsleiter steigen und damit die Gehaltsstufen A11–A12 mit bis zu 5.000,00 € brutto monatlich, bleibt die eigentliche Kernaufgabe auf der Strecke. Ein Rechnungsprüfungsamt darf nicht nur feststellen – es muss auch aktiv darauf drängen, dass erkannte Mängel im Amt für Finanzen nachhaltig beseitigt werden. Nur Prüfberichte schreiben und erwarten, dass andere die Probleme lösen, funktioniert nicht im Amt Crivitz. Wer für solche Gehälter Verantwortung trägt, muss auch Ergebnisse liefern.

Das Haushaltsrecht als Farce?
Ein Jahresabschluss ist kein bloßes bürokratisches Detail. Er bestimmt:
• Welche Mittel verfügbar sind
• Welche Investitionen getätigt werden können
• Welche Fördergelder genehmigt werden
Ohne ihn gibt es keine transparente Haushaltsplanung – nur Spekulation.
Seit der Einführung der kommunalen Doppik 2012, die eigentlich für mehr Transparenz sorgen sollte, hat es das Amt Crivitz nicht geschafft, eine solide Haushaltsführung umzusetzen. Seit 2021 fehlen aktuelle, geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse – eine Krise, die nicht länger ignoriert werden kann.
Doch wer greift ein?
Der Landesrechnungshof hat mehrfach gemahnt. Die Gesetze sind klar, die Fristen unumstößlich. Doch niemand unternimmt etwas. Wie lange kann dieses System noch bestehen, bevor Bürger, Gemeinden oder Aufsichtsbehörden das Schweigen brechen?
Ist es wirklich bloße Nachlässigkeit – oder steckt mehr dahinter?
Denn eines ist sicher: Irgendwann kommen selbst die bestgehüteten Geheimnisse ans Licht – auch wenn sie nur technischer Natur sind. Und dann wird sich zeigen, ob das Amt Crivitz nur mit strukturellen Problemen kämpft – oder ob hier über Jahre hinweg systematisch Missstände vertuscht wurden.
Fazit
Die entscheidende Frage lautet: Wie lange kann ein Amt seine gesetzlichen Verpflichtungen ignorieren, bevor jemand einschreitet? Die fehlende Transparenz und Geheimhaltung von Rechensachftsberichten sind keine bloßen Verwaltungsfehler – sie gefährden das Vertrauen in öffentliche Institutionen. Es braucht eine Kehrtwende. Kein weiteres Festhalten an überdimensionierten, aber unterfinanzierten Strukturen. Kein weiteres Verschweigen der eigentlichen Probleme. Es braucht eine Verwaltung, die ihre Aufgaben ernst nimmt – und endlich Verantwortung übernimmt.
02.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./447[163(38-22)]/CLA-283/22-2025

Seit mittlerweile 50 Monaten schwebt eine ungeklärte und brisante Frage über Crivitz: Warum gibt es immer noch keine angepasste Feuerwehrgebührensatzung? Die Stadt Crivitz, die CWG-Fraktion und einer ihrer führenden Vertreter Markus Eichwitz, der gleichzeitig aktuell ehrenamtlicher Amtswehrführer und erster Bürgermeister ist, stehen im Zentrum eines beispiellosen Verwaltungsversagens. Während Bürger seit Jahren auf eine überfällige Korrektur drängen, bleibt die CWG-geführte Stadtspitze inaktiv und ignoriert die offensichtlichen gesetzlichen Vorgaben.
Dabei wurde die Problematik bereits 2021 von der Opposition angesprochen. Die damalige Opposition forderte eine dringende Überarbeitung und wies klar auf die Gefahren einer überalterten Feuerwehrgebührensatzung hin. Doch die CWG – Crivitz und der damalige Stadtfeuerwehrchef Eichwitz blockierten die Diskussion, unterstützt durch den damaligen zweiten Bürgermeister Hans-Jürgen Heine und die Fraktion DIE LINKE/Heine. Der Antrag wurde mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt, unter anderem mit der Aussage der damaligen Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, dass „alle diesbezüglichen Satzungen im Amt Crivitz bereits in naher Zukunft überarbeitet werden“. Ein Versprechen, das – wie so viele vorher – gebrochen wurde.
Eines der größten Versprechen kam dabei von Amtsvorsteherin Iris Brincker, die im Jahr 2021 an einer Sitzung der Stadtvertretung teilnahm und betonte, dass die Satzung „in naher Zukunft überarbeitet“ werde. Eine klare Ansage – doch leider blieb es bei bloßen Worten. Seit dieser Zeit wurde weder eine Anpassung vorgenommen noch eine rechtssichere Kalkulation erstellt. Die Situation ist seitdem nicht nur unverändert, sondern hat sich aufgrund neuer Herausforderungen sogar verschlechtert.

Dabei ist die Feuerwehrgebührensatzung von zentraler Bedeutung. Feuerwehreinsätze sind nicht immer kostenlos. Während die Stadt selbstverständlich für Einsätze zur Brandbekämpfung und Rettung von Menschen aufkommt, gibt es viele Fälle, in denen Gebühren erhoben werden müssen. Beispielsweise bei Fehlalarmen, wenn ein automatischer Feuermelder grundlos auslöst, oder bei Einsätzen wie Türöffnungen, wenn sich jemand ausgesperrt hat. Auch bei der Beseitigung von Ölspuren, die eine Gefahr im Straßenverkehr darstellen, dürfen Kosten berechnet werden. Doch dafür braucht es eine rechtlich einwandfreie Feuerwehrgebührensatzung, die klar festlegt, welche Einsätze kostenpflichtig sind und wie hoch diese Kosten ausfallen dürfen.

Doch genau diese Satzung ist in Crivitz seit 16 Jahren nicht aktualisiert worden. Das stellt ein gewaltiges rechtliches Problem dar. Laut dem Kommunalabgabengesetz (§ 6 KAG M-V) müssen Gebühren spätestens alle drei Jahre überprüft und angepasst werden. Wird dies unterlassen, besteht die reale Gefahr, dass die gesamte Gebührensatzung ungültig wird. Damit könnte jeder Bürger Einspruch gegen Feuerwehrrechnungen einlegen – mit hoher Aussicht auf Erfolg. Sollte ein Verwaltungsgericht entscheiden, dass die Gebühren unrechtmäßig erhoben wurden, müsste das Amt Crivitz sämtliche Kosten zurückzahlen. Eine finanzielle Katastrophe für die Stadt und ihre Gemeinden.
Doch warum hält die Stadt Crivitz seit vier Jahren an dieser Untätigkeit fest? Warum ignoriert die CWG – Crivitz die gesetzlichen Vorschriften? Ist es eine bewusste Vermeidung unpopulärer Entscheidungen? Denn eine korrekte Kalkulation der Feuerwehrgebühren könnte für einige Bürger höhere Kosten bedeuten. Oder mangelt es schlicht an Fachkompetenz in der Verwaltung? Fakt ist: Die Stadt Crivitz verstößt seit Jahren gegen geltendes Recht.
Diese Problematik betrifft nicht nur die Stadt Crivitz, sondern den gesamten Amtsbereich. Von den 17 Gemeinden im Amtsbereich Crivitz im Amt der Zukunft, haben die meisten völlig überalterte Feuerwehrsatzungen. Zehn Kommunen arbeiten noch mit Satzungen aus dem Jahr 2005, weitere aus 2006, 2007 oder 2008. Sollte es zu einer rechtlichen Überprüfung kommen, drohen Rückerstattungen in großem Stil und erhebliche Kosten für die Stadtverwaltung.
Doch statt sich um dieses Problem zu kümmern, werden stattdessen hohe Summen für neue Fahrzeuge ausgegeben. Allein 180.000 EUR wurden für einen neuen Einsatzleitwagen für die Amtswehrführung im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Ein modernes Fahrzeug, sicherlich wichtig für die Feuerwehr – doch wie sollen diese Kosten gedeckt werden, wenn die Gebühren rechtlich gar nicht belastbar sind? Gleichzeitig erhalten hochrangige ehrenamtliche Amtsträger wie Markus Eichwitz (der als Amtswehrführer und als erster Bürgermeister der Stadt Crivitz) eine direkte Verantwortung mitträgt jährlich bis zu 15.000 EUR an Aufwandsentschädigungen, davon allein 8.000 EUR als Amtswehrführer – ohne Sitzungsgeld sowie Fahrkosten – aber dafür Abgabenfrei und dennoch gibt es bis heute keine einzige rechtssichere Anpassung der Satzung. Doch die Frage bleibt: Warum bleibt eine so grundlegende Verwaltungsaufgabe weiterhin liegen? Sind persönliche oder parteipolitische Interessen wichtiger als eine funktionierende Feuerwehrfinanzierung?
Nun müsste dringend gehandelt werden, um das Problem zu lösen. Doch die CWG – Crivitz und Markus Eichwitz scheinen sich der Brisanz nicht bewusst zu sein. Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand:
Doch die große Frage bleibt: Wird sich bis zur nächsten Wahl der Amtswehrführung in knapp 34 Monaten überhaupt etwas ändern? Wird Markus Eichwitz weiterhin gewählt, oder gibt es im Amt künftig eine neue Führung? Eine weitere Legislaturperiode von 6 Jahren ohne Anpassung der Feuerwehrgebühren könnte dem Amtsbereich Crivitz Millionen kosten und für Frust bei Feuerwehrleuten und Bürgern sorgen.
Fazit:
Bleibt alles wie bisher, könnten Feuerwehrrechnungen bald nicht mehr rechtskräftig sein – ein Problem, das sich leicht hätte verhindern lassen können. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den Verantwortlichen im Amt Crivitz und der Stadt Crivitz sowie der CWG – Crivitz. Wird das Chaos endlich beendet, oder ist dies nur der Auftakt zu weiteren Jahren der Ignoranz und Versäumnisse?
28.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./446[163(38-22)]/CLA-282/21-2025

Wärmeversorgung beginnt – aber nur dort, wo es passt!
Wer glaubt, große kommunale Entscheidungen würden mit Transparenz und Bürgerbeteiligung getroffen, sollte einmal einen Blick nach Crivitz werfen – hier wird nach ganz eigener Methodik gearbeitet. Statt offener Debatten gibt es Andeutungen, statt klarer Konzepte schrittweise Enthüllungen, bis am Ende niemand mehr überrascht ist, dass längst Fakten geschaffen wurden.
Den Startschuss für das Prestigeprojekt lieferte einst Herr Alexander Gamm, seines Zeichens „Experte“, am 12.12.2022, als er in einer Stadtvertretersitzung scheinbar beiläufig erwähnte, dass ein umfassendes Energiekonzept für die Neustadt und das Gewerbegebiet in Arbeit sei. Ganz harmlos klang es damals, als wäre es nur eine Idee – ein Mix aus Solar-, Wind- und Biomasseenergie, eine mögliche Biogasanlage zur Wärmeversorgung und vielleicht irgendwann sogar ein eigenes Stadtwerk. Keine konkreten Zahlen, keine festen Pläne, nur grobe Andeutungen.
Doch die Sache entwickelte sich in rasantem Tempo weiter – zumindest für die, die in die Verhandlungen eingebunden waren. Am 26.06.2023 verkündete der Fraktionsvorsitzende der Linken, Herr Alexander Gamm – Gatte der Bürgermeisterin, ganz offiziell, dass Crivitz gemeinsam mit Barnin und Zapel eine Wärme-GmbH mit der WEMAG AG gründen wolle. Die technische und kaufmännische Führung? Natürlich bei der WEMAG. Die Stadt Crivitz selbst? Eine kommunale Minderheitsbeteiligung – formal beteiligt, praktisch kaum entscheidend. Die letzten Absprachen sollten bis zum 30.06.2023 getroffen sein. Was hier als „Ankündigung“ verkauft wurde, war eigentlich schon fast eine endgültige Entscheidung.
Natürlich durfte ein wenig politischer Pathos nicht fehlen. Herr Hans-Jürgen Heine, offensichtlich begeistert von der Idee, ließ sich dazu hinreißen, das Crivitzer Wärmeprojekt als „Blaupause“ für andere Städte zu bezeichnen – so, als wäre es bereits ein bewährtes Erfolgsmodell. Dabei war es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als eine lose politische Vision mit viel gutem Willen und noch mehr ungeklärten Finanzierungsfragen.
Aber keine Sorge, die „öffentliche Information“ lief nach bewährtem Crivitzer Prinzip: Komplexe Zusammenhänge in Bruchstücken erklären, sodass jeder zwar glaubt, er sei informiert, aber niemand das Gesamtbild erkennt. Im September 2023 erschien das Crivitzer Stadtblatt, in dem Herr Alexander Gamm als Chef des Bauausschusses, erneut das Projekt präsentierte – selbstverständlich nicht als Entscheider, sondern nur als der Experte, der zufällig genau das propagierte, was ohnehin längst feststand.
Der endgültige Höhepunkt kam dann am 23.09.2024, als das Konzept für Wärme und Energie offiziell vorgestellt wurde. Herr Michael Renker, als Türöffner für Herrn Alexander Gamm als Chef der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, beantragte dessen Rederecht – als „Sachverständiger“ und dann begann die übliche Show: Zwei DIN-A4-Seiten voller technischer und wirtschaftlicher Details wurden in rasendem Tempo vorgetragen, sodass garantiert kein Bürger mehr eine Chance hatte, die Zusammenhänge zu hinterfragen. Die Stadtvertretung? Hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine echte Wahl mehr.
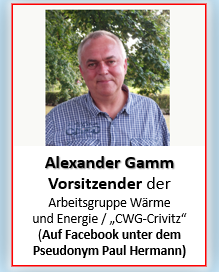
Natürlich steht die Stadt finanziell auf wackeligen Beinen – aber keine Sorge, statt lästigen Haushaltsdebatten wird einfach eine Wärmegesellschaft vorgesehen! Die WEMAG AG übernimmt die Planung und die Stadt Crivitz darf sich am Unternehmen beteiligen – was sicherlich genauso viel Einfluss bringt wie eine dekorative Vase auf einem Besprechungstisch. Die Kosten? Erst mal zahlt WEMAG, aber natürlich nicht umsonst. Wann die Rechnung präsentiert wird, bleibt ein Mysterium.
Die Wärmeversorgung startet mit einem neuen Heizwerk das mit Hochleistungswärmepumpen betrieben werden soll, wie könnte es anders sein, dort, wo es strategisch am besten passt: in der Crivitzer Neustadt. Ein großer Vermieter aus Schleswig-Holstein wird als verlässlicher Abnehmer eingeplant – ein sogenannter Referenzkunde, der die ganze Rechnung irgendwie wirtschaftlich mit machen soll. Die übrigen Bürger?

Nun ja, ihr Anschluss ist vorstellbar, aber finanziell lieber nicht mitkalkuliert – man will ja keine bösen Überraschungen erleben! Ein zentrales Thema bleibt die Energiequelle für die geplanten Hochleistungswärmepumpen. Sie werden in der Regel elektrisch betrieben, aber es gibt spezielle Varianten, die mit Dieselmotoren gekoppelt werden können. Das geschieht meist in Situationen, in denen kein stabiler Stromanschluss vorhanden ist oder eine unabhängige Energieversorgung erforderlich ist. Biogas fällt aus, Diesel und Gas stehen zur Debatte – das sind Lösungen, die nicht unbedingt dem Ideal einer nachhaltigen Wärmewende entsprechen.

Gleichzeitig soll bereits das Gewerbegebiet in die Pläne mit eingebunden werden, denn auch dort soll die Wärmeversorgung voranschreiten, entweder mit einem Biogasanlage und Blockheizkraftwerk mit der ansässigen Agrargenossenschaft, natürlich mit der gewohnten Mischung aus exklusiven Absprachen und politischer Akrobatik.
Natürlich wäre Transparenz in diesem Projekt zu erwarten – schließlich geht es um Millionenbeträge und die langfristige Versorgung der Stadt. Aber nicht mit Herrn Alexander Gamm- als CWG – Fraktionär und in Facebook als Paul Hermann unterwegs!
Öffentliche Diskussionen sind lästig, Ausschussberatungen überflüssig – stattdessen werden Fakten geschaffen, bevor jemand nachfragen kann.
Natürlich steht das gesamte Vorhaben unter dem Vorbehalt der Rechtsaufsicht – doch angesichts der finanziellen Lage der Stadt bleibt fraglich, wie belastbar diese Pläne wirklich sind. Schließlich müssen nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, sondern auch die Haushaltslage darf nicht ignoriert werden. Am Ende könnte die Crivitzer Wärme-GmbH weniger eine echte kommunale Errungenschaft sein, sondern eher ein finanzielles Abenteuer mit ungewisser Zukunft.
Fazit:
So bleibt am Ende festzuhalten: Die Crivitzer Wärmewende war nie eine offene Entscheidung, sondern wurde durch gezielte Andeutungen, clever platzierte Sitzungen und strategische Veröffentlichungen schrittweise zur Realität gemacht.
Die Bürger haben immer mal wieder davon gehört – aber nie mit der Möglichkeit, wirklich mitzureden. Die Wärme-GmbH kommt, die Verträge werden wohl bald unterschrieben, und Transparenz bleibt weiterhin optional.
25.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./445[163(38-22)]/CLA-281/20-2025
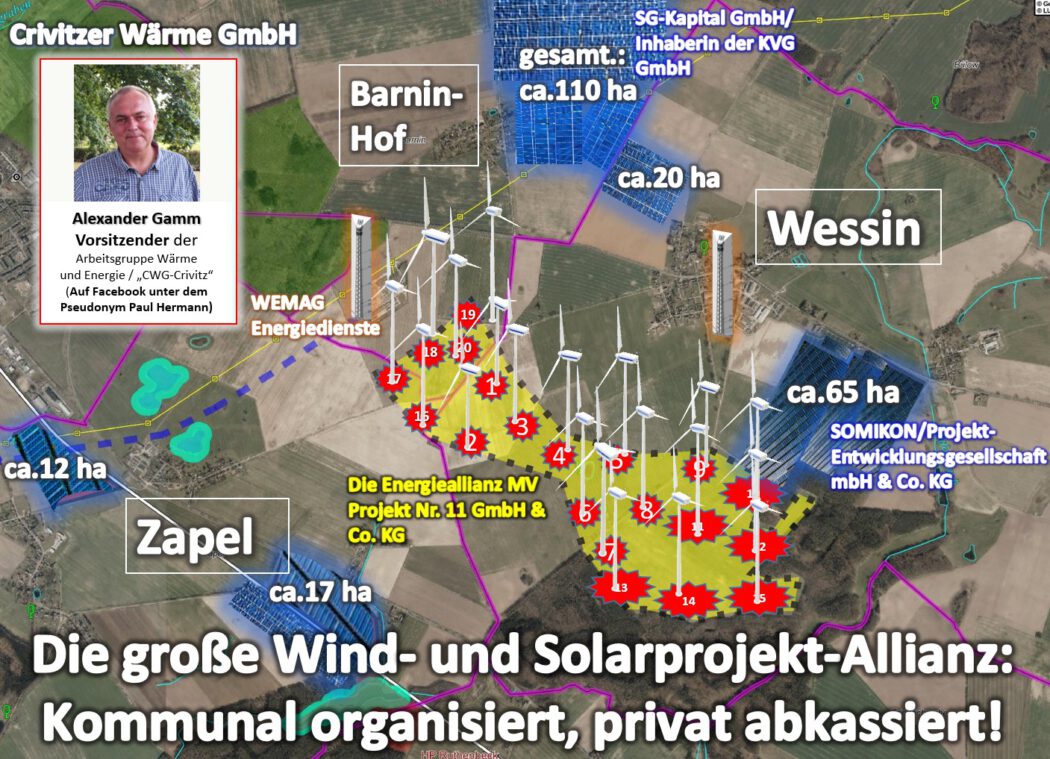
In dem kleinen Grundzentrum der Stadt Crivitz mit 4.614 Einwohner geschieht etwas Großes. Während die Bürger noch über steigende Steuern und Gebühren sowie einen maroden Haushalt 2025 grübeln, hat sich ein Mann längst ans Reißbrett im Jahr 2024 gesetzt, um eine Zukunft zu erschaffen, von der alle – oder besser gesagt, wenige Auserwählte – profitieren werden.
Alexander Gamm – der diskrete Strippenzieher hinter Crivitzer Energieprojekten, stets bedacht darauf, seine politische Aura mit der richtigen Inszenierung zu untermalen. Unter dem Namen Paul Hermann auf Facebook nicht als Fachmann für Stromkreisläufe und Windkraft, sondern vielmehr als geschickter Gestalter seiner eigenen politischen Bühne präsent, hat er sich als „sachkundiger Einwohner“ dank der CWG strategisch in die perfekte Position manövriert. Ganz nebenbei natürlich auch als neuer Fraktionär und Gatte der Bürgermeisterin. Eine Kombination, die nicht nur politisch praktisch ist, sondern auch hervorragend für den diskreten Ausbau einer ökologisch verpackten Machtsicherung taugt. Ein wahrer Visionär – wenn man Visionen nicht mit konkreten Plänen verwechselt, sondern sie lieber auf Papier und in versteckten Hinterzimmern hält.
Die Strategie? Windräder, Solarpanels, Energienetze – ein grünes Prestigeprojekt, das so geheim ist, dass selbst die Beteiligten manchmal nicht genau wissen, was als Nächstes passiert.
Die Bürger? Sie dürfen sich überraschen lassen! Während andere Städte auf Transparenz setzen, geht Crivitz lieber den bewährten Weg der Unsichtbarkeit. Keine öffentliche Diskussion, kein städtischer Ausschuss, keine Bürgerfragestunde – stattdessen wird die Energiezukunft in kleinen, verschwiegenen nicht öffentlichen Runden verhandelt.
Natürlich beginnt alles mit der Photovoltaikanlage in Wessin. 65 Hektar feinster Solarfläche, gepachtet vermutlich zu einem Schnäppchenpreis, während die Stadt ihre letzten Groschen zusammensucht, um irgendwie den Haushalt zu retten. Die WEMAG AG sitzt bereits mit am Tisch, ebenso wie diverse Investoren, die das große Geschäft wittern.
Und Herr Alexander Gamm? Der orchestriert die Zusammenarbeit mit Somikon und WEMAG Energiedienste, zwei Firmen, die sich die Entwicklungskosten schön aufteilen und im Hintergrund emsig an Vertragsmustern feilen. Denn eines ist klar: Je schneller die Sonnenkollektoren stehen, desto schneller fließt das Geld.
Doch warum auf Sonnenenergie allein setzen, wenn man auch den Wind ernten kann? Denn irgendwo muss schließlich das finanzielle Loch gestopft werden, das sich immer weiter im Haushalt 2025 auftut. Ein paar schicke Windräder so ungefähr zwanzig in Wessin oder alternativ auf stadteigenem Grund – Hauptsache, sie stehen und bringen ordentlich Rendite. Natürlich, die Stadt Crivitz hat kein Geld, aber das lässt sich wunderbar durch Gesellschafterdarlehen der Beteiligungsgesellschaften absichern.
Risiko? Ach, wen interessieren schon Risiken! Man könnte fast meinen, ein magischer Geldtopf stehe bereit, um jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen.
Die Finanzierung? Solange fremde Banken bereit sind, den Traum zu unterstützen, läuft alles nach Plan.
Die Bürger hören von den Projekten erst, wenn alles längst unterschrieben ist. Wer braucht schon Diskussionen? Wer braucht schon Transparenz? Crivitz geht neue Wege: Die Wind- und Solarstrategie wird direkt aus den Hinterzimmern in die Realität katapultiert, und wer sich wundert, warum seine Grundsteuer sowie Gewerbesteuer und Strompreis plötzlich nach oben schießt, sollte sich nicht beschweren – schließlich geht es hier um Zukunft! Und Zukunft kostet nun mal viel Geld.
Alexander Gamm, inzwischen unangefochtener Chef der Arbeitsgruppe „Wärme & Energie“, zieht die Fäden mit einer Präzision, die fast künstlerisch anmutet. Ein Mann, der es schafft, sich mit allen Fraktionen so geschickt zu arrangieren, dass es fast wie Zauberei wirkt. Die CWG – Crivitz, die BFC- Fraktion, die CDU- Fraktion, die WEMAG Energiedienste, Somikon – alles läuft nach Plan. Die Windräder sollen aufgestellt werden, die Solarflächen werden oder sind bald verpachtet, der Haushalt taumelt dem Abgrund entgegen, aber hey – Crivitz ist auf dem besten Weg zur grünen Vorzeigestadt!
Ob das alles tatsächlich funktioniert? Ob sich die Bürger eines Tages auf günstigere Energie freuen dürfen? Oder ob sie am Ende nur die Rechnung tragen, während die großen Drahtzieher ihre strategischen Sitze in den Aufsichtsräten genießen? Die Antwort kennt nur das politische Schachbrett, auf dem die Crivitzer – CWG gerade seinen wohl gewagtesten Zug macht.
Eines steht fest: Wenn die Windräder sich drehen, dann nicht nur für die Nachhaltigkeit – sondern auch für die große Crivitzer Karriereplanung.
Fazit:
Crivitz revolutioniert die Energiewende – aber bitte ohne lästige öffentliche Diskussionen!
Während die Stadt finanziell taumelt, basteln einige klammheimlich an Solarparks und Windrädern, die das große Wirtschaftswunder bringen sollen. Transparenz? Überbewertet. Bürgerbeteiligung? Stört nur.
Stattdessen wird die Zukunft diskret in strategischen Hinterzimmergesprächen geplant, während die Steuerzahler brav die Rechnung begleichen. Am Ende steht fest: Die Windräder drehen sich – die politischen Karrieren gleich mit.
Und ob Crivitz wirklich profitiert? Nun, zumindest einige gut platzierte Akteure
21.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./444[163(38-22)]/CLA-280/19-2025

Seit mittlerweile 43 Monaten wartet Crivitz auf das große Versprechen der CWG-Wählergemeinschaft und die LINKE: den Bürgerhaushalt. Eine Idee, die Transparenz und Beteiligung versprach, eine echte Revolution der Demokratie! Doch wer hätte ahnen können, dass dieses großartige Vorhaben letztlich zur größten politischen Inszenierung der letzten Jahre werden würde?
Im Oktober 2021 war die Euphorie groß. Die Mehrheitsfraktionen (CWG – Crivitz und Heine) verkündeten stolz: „Wir beschließen einen Bürgerhaushalt für 2022!“ Ein historischer Moment, begleitet von zustimmendem Nicken, warmen Worten und wohlüberlegten Pressemitteilungen. Dann passierte – nichts.
24 Monate später wurde die Idee überraschend aus dem politischen Tiefschlaf geweckt. Eine Sitzung! Geladene Gäste! Die Bürgermeisterin in feierlicher Pose! Doch dann stellte man verwundert fest: „Moment mal, wir brauchen ja eine Satzung!“ Ein Detail, das man großzügig übersehen hatte. Aber keine Sorge! Der November 2023 brachte die nächste bahnbrechende Errungenschaft – einen Satzungsentwurf! Begeisterung machte sich breit, Zustimmung wurde gegeben, man klopfte sich auf die Schulter. Und dann? Nichts. Wieder verschwand das ambitionierte Projekt dort, wo politische Ideen sich besonders wohlfühlen: In der Schublade für Vergessenes.
Die CWG-Wählergemeinschaft und die LINKE konnten sich aber nicht vorwerfen lassen, untätig gewesen zu sein. Nein, nein – sie hatten eine Meisterleistung der politischen Inszenierung hingelegt! Man predigte Bürgerbeteiligung, man versprach Einfluss, man präsentierte große Pläne. Doch in Wahrheit war alles nur eine Wahlkampfinszenierung, ein liebevoll gestaltetes Schaufenster, hinter dem sich kein einziger Cent versteckte.
Ein stolzes Budget von 15.000 Euro sollte den Bürgern zur Verfügung stehen. Aber Vorsicht: Vorschläge durften bloß nicht mehr als 10.000 Euro kosten – eine kreative Einschränkung, die sicherstellte, dass niemand wirklich etwas verändern konnte. Doch während Crivitz weiter auf die Umsetzung wartete, waren die Finanzen der Stadt bereits so marode, dass jeder Cent dringend anderswo gebraucht wurde. Die Bürger fragten sich: Wo ist das Geld hin? Nun ja, die CWG und die LINKE hatten bereits genug Prestigeprojekte, die finanziert werden mussten – der Bürgerhaushalt wurde dabei einfach zur Nebensache degradiert.
Aber damit nicht genug! Die CWG – Crivitz und die LINKE hatten eine geniale Lösung gefunden: Noch mehr Bürokratie! Statt den Bürgerhaushalt tatsächlich einzuführen, beschloss man, eine neue Vollzeitstelle einführen zu wollen, um Papier zu bedrucken und Vorschläge zu prüfen. Eine einfache Maßnahme, die sicherstellte, dass noch mehr Steuergelder für Verwaltungsaufwand verschwendet wurden – anstatt für echte Bürgerprojekte.
Das bittere Fazit? Crivitz hat in den letzten 43 Monaten eine politische Inszenierung erlebt, die ihresgleichen sucht. Die CWG-Wählergemeinschaft und die LINKE haben bewiesen, dass politische Versprechen eine Halbwertszeit von wenigen Sitzungen haben. Demokratie wurde elegant als Kulisse genutzt, während hinter den Kulissen die Kreative Budgetillusion – jetzt mit Extra-Schulden betrieben wurde.
Und die Bürger? Sie dürfen sich glücklich schätzen! Denn sie haben gelernt, dass ein Bürgerhaushalt in Crivitz nicht etwa eine Form der Teilhabe ist – sondern nur ein weiteres Schaufensterprojekt für den Wahlkampf.
Aber keine Sorge: Vielleicht kommt er ja 2035, wenn Crivitz den Schuldenberg erklommen hat und man endlich genug Geld hat, um sich eine weitere Beratungsrunde leisten zu können. Bis dahin bleibt alles beim Alten: Versprechen, beschlossen, gebrochen und wieder vergessen – die wahre Kunst der Kommunalpolitik!
18.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./443[163(38-22)]/CLA-279/18-2025
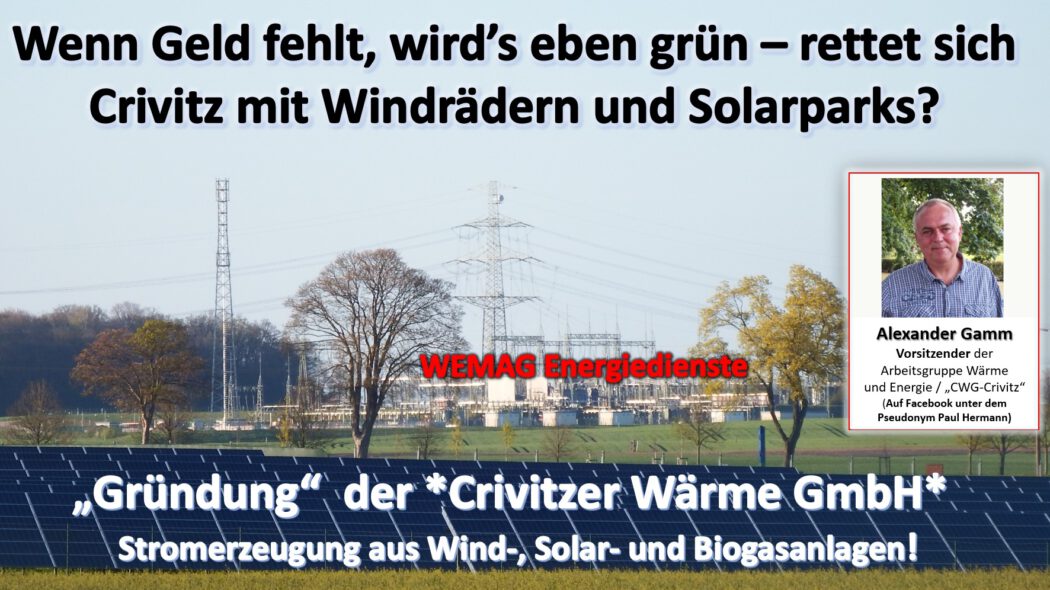
Crivitz und die Geheimakte „Wärme & Energie“ – Ein Meisterwerk der Intransparenz!
Transparenz? Bürgerbeteiligung? Ausschussberatungen? Nicht in Crivitz! Während die Stadt sich klammheimlich mit der WEMAG AG zusammentut, um eine eigene Wärmegesellschaft zu gründen, bleibt die Öffentlichkeit – mal wieder – komplett außen vor. Natürlich gibt es einen Letter of Intent (LoI), eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der WEMAG – aber wer hätte gedacht, dass dieser Vertrag im Geheimen abgeschlossen wurde? Keine öffentliche Diskussion, keine Ausschussberatung, keine Bürgerinformation.
Und wer zieht hier wieder die Fäden in diesem Projekt? Alexander Gamm, einst Bauausschussvorsitzender der LINKEN, heute bequem in die CWG-Crivitz eingegliedert und dank ihr neuer Fraktionär –und auf Facebook unterwegs als Paul Hermann. Ein wahrer Meister der politischen Akrobatik – immer geschickt darin, genau dort zu landen, wo es gerade am meisten nützt. Egal welches Lager, egal welche Ideologie – Hauptsache, die richtige Bühne für den nächsten großen Auftritt ist bereit. Nun hat er sich erneut an die Spitze gesetzt – mit strategischer Unterstützung seiner Ehefrau Frau Brusch-Gamm, die ebenfalls fest in der CWG-Fraktion verankert ist. Und so gelingt der nächste Coup: Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme & Energie!
Im September 2024 ließ er sich Herr Alexander Gamm nicht lumpen und spendierte der Öffentlichkeit großzügige sechs Minuten – auf zwei DIN-A4-Seiten verteilt. Ein kurzer, aber erlesener Einblick in das Konzept, der gerade so ausreichte, um den Schein der Öffentlichkeit zu wahren! Eine geradezu bemerkenswerte Geste, wenn man bedenkt, dass sämtliche vorherigen und zukünftigen Sitzungen sowie Beschlüsse ausschließlich im Verborgenen abgehandelt wurden und weiterhin werden.
Doch worum geht es eigentlich? Crivitz setzt neue Maßstäbe in der Energieversorgung! Gemeinsam mit der WEMAG plant die Stadt die Gründung einer zukunftsweisenden Gesellschaft, die nicht nur ein eigenes Heizwerk und leistungsstarke Solaranlagen betreibt, sondern auch weitere Projektgesellschaften auf den Weg bringt. Doch damit nicht genug: Crivitz steigt aktiv in die Windkraft ein und beteiligt sich an Windrädern in Wessin sowie weiteren strategischen Standorten der Stadt. Klingt ambitioniert – wäre da nicht das kleine Detail, dass Crivitz keinen Goldesel hat, der unermüdlich Scheine ausspuckt. Oder doch?
Denn hinter dieser Entscheidung steckt mehr als nur der Wunsch nach nachhaltiger Energie. Die große Rettungsmission: Crivitz erfindet sich neu! Wer glaubt, es ginge nur um nachhaltige Energie, hat die wahre Meisterleistung verpasst! Hier wird Zukunft gestaltet – mit strategisch verteilten Posten in prestigeträchtigen Aufsichtsräten, gezielten Einflussnahmen auf bahnbrechende Energieprojekte und natürlich der heldenhaften Rettung eines Haushalts, der längst auf der Intensivstation liegt. Haushalt 2025? Ein finanzielles Wunderwerk im freien Fall! Doch keine Sorge – mit den richtigen Hebeln und den passenden Netzwerken wird aus der Krise eine einmalige Karrierechance.
Die Wahrheit ist: Crivitz steckt finanziell tief in der Krise. Der Haushalt für 2025 ist ein einziges Desaster, die Stadt steht mit dem Rücken zur Wand. Die Kassen sind leer, die Schulden wachsen, und die einzige Lösung scheint zu sein: Sich irgendwie in ein lukratives Energieprojekt zu retten.
Die WEMAG AG übt Druck aus – schließlich sind es nur noch 6 Monate bis die Absichtserklärung ausläuft, und man will sichergehen, dass der Goldesel nicht davonläuft. Also wird jetzt alles durchgepeitscht, 3 Monate vor dem Beginn der Haushaltsverhandlungen des Haushaltsplans für 2026.
Und die Bürger? Die dürfen sich auf höhere Steuern freuen, um die Kosten für Solar- und Windenergieprojekte zu tragen. Denn während Crivitz sich eine neue Wärmegesellschaft bastelt, haben die Ortsteile Wessin und Gädebehn sowie die Crivitzer Altstadt nichts davon – außer der finanziellen Belastung.
Die Pläne sind längst gemacht:
Während Crivitz sich mit der WEMAG AG verbündet und euphorisch die Zukunft der nachhaltigen Energie beschwört, schließen sich auch andere Gemeinden der „grünen Mission“ an: Zapel plant 12 Hektar Solarpanels, Barnin setzt noch einen drauf mit 110 Hektar, und in Wessin sollen weitere 20 Hektar hinzukommen – beeindruckende Zahlen für ein Prestigeprojekt! Doch halt, die Windkraft soll natürlich nicht zu kurz kommen – und wird selbstverständlich nach geheimen Regeln verteilt, die keiner so richtig kennt! Auch andere Ortsteile von Crivitz dürfen sich voller Vorfreude auf die Teilnahme am großen Windrad-Bingo nun freuen.
Die Idee eines Strom-Bilanz-Kreismodells, bei dem die Gemeinden ihren eigenen Strom günstiger nutzen könnten, klingt vielversprechend – aber ob das wirklich passiert? Fraglich. Die Unterlagen sind längst fertig, die Gespräche laufen – und das Energieministerium ist informiert. Doch die Bürger? Die erfahren es erst, wenn alles längst beschlossen ist.
Fazit:
Crivitz setzt auf die bewährte Augen-zu-und-durch-Mentalität. Entscheidungen werden im Geheimen getroffen, Verträge hinter verschlossenen Türen unterzeichnet, und die Bürger? Die dürfen zahlen, aber nicht mitreden.Während die Stadt finanziell vor die Wand fährt, klammert sich die CWG – Wählergemeinschaft an ein Energieprojekt, das mehr nach politischer Machtsicherung als nach echter Zukunftsplanung aussieht.
Ein echter Wärme-Sektor-Deal – aber nicht für die Bürger, sondern für die Postenjäger der CWG, die verzweifelt versuchen, ihre Stadt aus dem finanziellen Abgrund zu retten. Ob es gelingt? Das bleibt fraglich.
15.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./442[163(38-22)]/CLA-278/17-2025
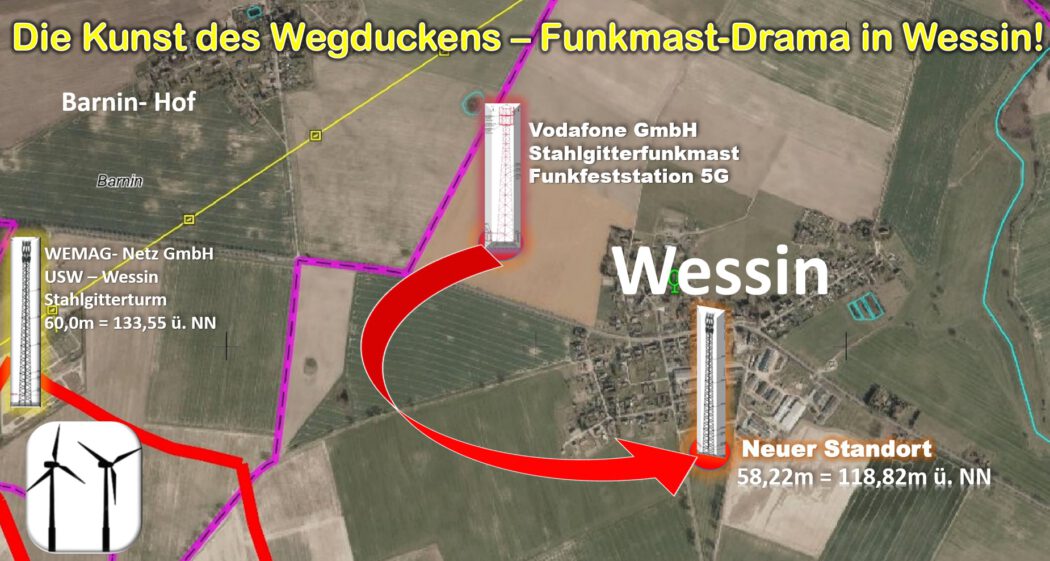
„Die große Funkmast-Posse – ein Lehrstück in Intransparenz“
Nach 26 Monaten ist es wieder soweit: Das Thema „Funkmast“ taucht im Bauausschuss auf – natürlich im nicht öffentlichen Teil, denn Transparenz ist in Crivitz ungefähr so verbreitet wie Sonnenschein im November.
Und wer hält sich wie gewohnt raus? Ortsteilvorsitzender Daniel Itze, ein Meister des Wegduckens. Unpopuläre Themen wie Windräder, Solaranlagen und Funkmasten? Nicht sein Metier. In Wessin wird ohnehin seit sieben Monaten nicht mehr beraten – warum auch? Die alte Ortsteilvertretung sitzt immer noch im Amt, eine Wahl gab es seit 340 Tagen nicht, aber die monatliche Aufwandsentschädigung fließt natürlich weiter.
Doch jetzt wird es ernst: Neue gesetzliche Vorgaben stehen an, der Landkreis wird ungeduldig, und eine weitere Verschleppung hilft nicht mehr. Die Pachtverträge? Angeblich längst unterzeichnet. Das politische Pokerspiel ist verloren – und das wusste auch die CWG-Crivitz schon vor der Wahl.
Und wer mischt natürlich wieder mit? Alexander Gamm, einst Bauausschussvorsitzender (Die LINKE), Gatte der Bürgermeisterin Frau Brusch-Gamm, heute dank der CWG-Crivitz ihr neuer Fraktionär mit erneutem Sitz im Bauausschuss – und immer noch auf Facebook als Paul Hermann unterwegs mit seinen politischen Kommentaren. Die Kunst des Verzögerns, Verschleppens und Vergessens beim Funkmast hat er als ehemaliger Bauausschussvorsitzender quasi erfunden – doch jetzt ist Schluss damit. Die Zustimmung im Ausschuss gilt zwar nicht als sicher, aber ist verwaltungsrechtlich nicht mehr zu verhindern – auch ohne die Ortsteilvertretung Wessin!
Natürlich wird das Ganze als „gesunder Kompromiss“ verkauft, während man sich hinter dem Landkreis LUP versteckt. Die CDU-Opposition? Abwartend, enthaltend – oder plötzlich doch positiv gestimmt. Schließlich geht es um ein ansässiges Unternehmen und Aufträge, und man pflegt ja ein gutes Miteinander mit CWG-Crivitz und dem Bündnis für Crivitz.
Seit Jahren wurde um den Standort des 5G-Funkmastes gerungen, doch ernsthafte Gegenargumente? Untersuchungen? Fehlanzeige! Jetzt wird die Verantwortung einfach auf den Landkreis abgewälzt. Bereits am 07.12.2022 verkündete Herr Itze in Wessin lapidar: „Wir können dagegen nichts machen!“ – oder genauer: „Der Landkreis erteilt die Genehmigung!“ Wusste er da schon vom neuen Standort? Antwort: Höchstwahrscheinlich JA.
Die Bauprojektierung war am 12.10.2022 abgeschlossen, die Antragsunterlagen gingen am 12.12.2022 in Bearbeitung. Die Vorverträge für die Pacht? Vermutlich längst unterschrieben. Und das Fatale: Die Stadt Crivitz wusste seit Januar 2023 Bescheid. Doch bis zum Ablauf der Frist am 31.03.2023 musste plötzlich alles rasant gehen. Der Hauptausschuss tagt erst im April, die Stadtvertretung Ende April – und die Bürger? Die bekamen die Unterlagen erst am 11.03.2023 kurz zu Gesicht. Viel zu spät! Heimlichkeit in der Fastenzeit? Nein, das ist gewohnte Praxis in Crivitz.
Die Kommunalverfassung fordert eigentlich frühzeitige öffentliche Informationen, doch wer glaubt, dass sich daran in den letzten zwölf Monaten nach der Kommunalwahl 2024 in Crivitz noch etwas ändern wird, glaubt auch an Märchen.
Baurechtlich liegt das Vorhaben im Außenbereich und fällt unter § 35 BauGB. Öffentliche Belange dürfen nicht entgegenstehen, die Erschließung muss gesichert sein – und natürlich dient es der öffentlichen Versorgung. Also: Alles passt!
Und Überraschung:
Plötzlich ist alles geregelt. Fehlt nur noch der Beschluss und das Siegel.
Die technische Standortbegründung? Ein Meisterwerk der Beruhigungstaktik:
Jeder Diplom-Ingenieur der Hochfrequenztechnik dürfte darüber entweder lachen oder weinen.
Und weiter geht’s mit der Standortwahl:
Natürlich! Denn wenn man privilegiert ist, kann man das einfach so schreiben.
Fazit: Alles schon vorher besprochen? Natürlich! Alles möglich? Selbstverständlich! Geschichte wiederholt sich – und wird es auch in Zukunft tun. Handwerkliche Fehler im Antrag? Vielleicht. Aber keine weiteren Unterlagen werden verlangt – nur die Zustimmung. Die Stadtspitze setzt sich wieder unter Zeitdruck, sodass eine intensive Diskussion kaum möglich ist – oder nicht gewollt wird.
Doch Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit? Fehlanzeige. Glaubwürdigkeit? Fraglich. Die Stadt Crivitz kann keine rechtlichen Gründe gegen die Privilegierung vorbringen – und will es vielleicht auch gar nicht.
Denn eines ist sicher: Es scheint alles klar zu sein!
12.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./441[163(38-22)]/CLA-277/16-2025

Jahr für Jahr steigen die Ausgaben der Stadt, während die Einnahmen nicht Schritt halten können. Eine finanzielle Schieflage, die längst nicht mehr zu übersehen ist, und doch verharrt die Stadtspitze und die CWG – Wählergemeinschaft weiterhin in ihrem Kurs – unbeirrt, ignorant und mit einer geradezu erschreckenden Sturheit. Der Haushalt 2025 offenbart schonungslos, wie tief Crivitz in eine wirtschaftliche Sackgasse geraten ist. Doch statt gegenzusteuern, werden Fehlentscheidungen verteidigt und teure Eigenlösungen aufrechterhalten – koste es, was es wolle.
Ein besonders drastisches Beispiel ist die Rekommunalisierung der Gebäudereinigung ab Juli 2019. Damals entschied sich die Stadt, die Reinigung öffentlicher Gebäude wieder in Eigenregie zu übernehmen, anstatt sie an private Unternehmen zu vergeben. Die Maßnahme sollte eigentlich helfen, Kosten besser zu kontrollieren, die Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte zu verbessern und die Qualität zu sichern. Seit fast fünf Jahren verteidigt die Stadtspitze – allen voran die CWG – Crivitz (Wählergemeinschaft) – die Eigenreinigung öffentlicher Gebäude, obwohl die Zahlen eine glasklare Sprache sprechen, denn die Realität sieht anders aus: Die Kosten explodierten! Waren es im Jahr 2020 noch 264.000 €, so sind es im Jahr 2025 unglaubliche 665.000 € – ein Anstieg von über 150 % in nur fünf Jahren! Während andere Städte wirtschaftlich handeln, wird in Crivitz unbeirrt weiter ausgegeben, als gäbe es keine finanziellen Grenzen. Der angebliche Qualitätsvorteil? Objektiv nicht nachweisbar. Einsparpotenziale? Ignoriert. Statt effizient zu agieren, treibt die Stadt ihre eigenen Kosten in ungeahnte Höhen – eine Strategie, die direkt in den finanziellen Abgrund führt.
Der Bauhof – ein Fass ohne Boden! Eine nahezu Verdoppelung der Kosten in nur 11 Jahren – von 339.000 € in 2014 auf sagenhafte 779.000 € in 2025! Als wäre die Kostenexplosion im Bauhof nicht schon alarmierend genug, zeigt sich ein weiteres Problem: Der Fuhrpark wächst ungebremst weiter – auf inzwischen fast 18 Fahrzeuge! Während die Stadt bereits mit enormen Haushaltsproblemen kämpft, scheint sie keine Grenzen zu kennen, wenn es um immer neue Anschaffungen geht. Neue Fahrzeuge für den Bauhof – ein Multicar für 150.000 €, ein Iveco Transporter für 75.000 €, ein Dreiseitenkippanhänger für 13.500 €, ein Hangmulcher für 11.000 €, zwei Aufsitzrasenmäher für insgesamt über 50.000 €. Die Liste geht weiter, und mit jedem neuen Fahrzeug steigen auch die Nachfolgekosten, die Wartungs- und Betriebsausgaben – eine Belastung, die den Haushalt langfristig zermürbt. Die Stadtspitze sieht tatenlos zu, wie die Belastungen wachsen, während gleichzeitig das Geld an allen Ecken und Enden fehlt. So Während andere Städte ihre Haushaltsstrategien überdenken, bleibt Crivitz bei seinem Kurs: Teuer, ineffizient und ohne Rücksicht auf die Zukunft.
Seit 12 Jahren läuft in Crivitz das gleiche Schauspiel – eine Inszenierung voller Ignoranz und Chaos, aufgeführt von der CWG-Crivitz. Die kommunalen Bauhöfe sollen wirtschaftlich geführt werden, doch eine Kosten-Leistungs-Rechnung? Fehlanzeige! Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, Bürgerhäuser, öffentliche Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze, Festwiesen und Friedhöfe – überall werden Leistungen erbracht, doch niemand kann genau sagen, wer wann was getan hat oder welche Ressourcen dafür draufgingen. Maschinenstunden? Arbeitsstunden? Alles bleibt im Nebel der Unklarheit verborgen.
2015 betrat dann der selbsternannte Meister der absoluten Kontrolle, Alexander Gamm, die Bühne – damals noch als unerschütterlicher Fraktionsvorsitzender -die LINKE-, heute als stolzer CWG-Fraktionär und Gatte der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Auf Facebook wandelt er unter dem klangvollen Pseudonym Paul Hermann. Mit gewohnt großspurigen markigen Worten versprach er – selbstverständlich mit maximaler Überzeugung – die ultimative Ordnung durch eine revolutionäre Kalkulationssoftware.Ein wahrhaft epochaler Moment!
3.000 Euro Steuergelder wurden sinnlos verpulvert – für eine Software, die nie wirklich genutzt wurde. Die handschriftlichen Stundenlisten der Mitarbeiter? Unberührt. Die Rechnungsprüfer mahnen Jahr für Jahr, doch die CWG-Crivitz bleibt standhaft in ihrer Meisterklasse der Ignoranz. Steuergelder versenkt, Probleme ignoriert, Verantwortung abgeschoben – und die Bauhöfe? Sie bleiben ein Mysterium. Oder besser gesagt: ein Phänomen, das wohl nur die CWG selbst versteht.
Ein Haushalt, der keine Luft mehr zum Atmen hat! Die Personalkosten verschlingen mittlerweile über die Hälfte der gesamten Einnahmen der Stadt. Die Liquidität sinkt unaufhaltsam. Die Schulden wachsen – bis 2040 wird Crivitz eine Schuldenlast von 5 Millionen Euro angehäuft haben! Und trotzdem hält die Stadtführung unbeirrt an ihren kostspieligen Konzepten fest, während die Bürger zusehen müssen, wie ihr Geld immer weiter versickert.
Die bittere Wahrheit ist: Crivitz fährt blindlings in die finanzielle Katastrophe. Es geht längst nicht mehr um einzelne Projekte – es geht um eine gesamtwirtschaftliche Ignoranz, die der Stadt ihre Zukunft raubt. Jede verpasste Chance zur Einsparung, jede verschleppte Entscheidung und jede neue unbeirrte Kreditaufnahme verschärft das Problem weiter.
Fazit: Während sich die Zahlen immer weiter ins Negative entwickeln, bleibt eine Erkenntnis klar: Die Verantwortlichen haben versagt. Die Bürger werden die Zeche zahlen, ob sie wollen oder nicht. Die große Frage ist nicht mehr, ob Crivitz sich diese Ignoranz noch leisten kann – sondern wann die Realität endlich anerkannt wird!
09.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./440[163(38-22)]/CLA-276/15-2025
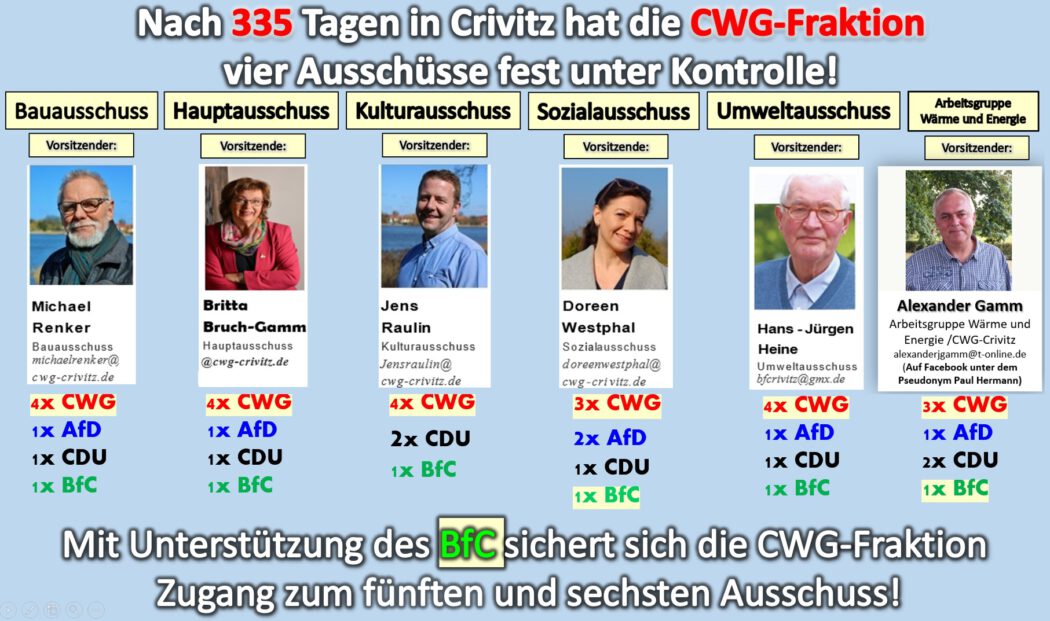
Die CWG-Crivitz (Wählergemeinschaft) hat ihre Macht erfolgreich gesichert, während die Opposition weiterhin mit sich selbst kämpft – trotz theoretischer Mehrheit. Aber dann geschah ein politisches Wunder: Einigkeit! Beim Thema Hundesportverein waren CDU, BFC und AfD plötzlich einer Meinung. Ein historischer Moment, der bei der CWG-Fraktion für helle Aufregung sorgte. Der 1. Bürgermeister Eichwitz und Fraktionschef der CWG Rüß reagierten auf diesen unerwarteten Widerstand mit einer beeindruckenden Demonstration politischer Selbstbeherrschung: erst verwunderte Mienen, dann ein Schwenk in die altbewährte Strategie – zynische Angriffslust gepaart mit ironischer und kompromissloser Härte.
Ein wahres Schauspiel in Sachen politischer Verteidigungsstrategie. Die ersten Beschlüsse zur Pachtkündigung? Selbstverständlich gescheitert – nicht etwa wegen kluger Argumente, sondern weil die Opposition schlicht nicht vollständig erschien. Aber keine Sorge, irgendwann könnte sie entdecken, dass politische Erfolge Anwesenheit voraussetzen. Kurz gesagt: Das Stadtparlament nimmt Fahrt auf – und liefert genau das, was man erwarten konnte: Drama, Stillstand und gelegentlich ein kleines Spektakel.
-Kulturausschuss: Wenn Selbstbeweihräucherung eine Kunstform wäre-
Währenddessen zeigte sich der Kulturausschuss gewohnt kreativ. Die Reparaturen der Spielplätze, eigentlich eine Aufgabe des Bauausschusses, wurden enthusiastisch übernommen – wahrscheinlich aus reiner Freude am Multitasking. Natürlich durfte auch die jährliche Forderung nach einem höheren Budget für Kulturveranstaltungen nicht fehlen. Dass das Bürgerhaus bereits üppig mit Finanzen ausgestattet ist? Ein unwichtiger Nebenaspekt.Besonders spannend ist die geplante Änderung der Sportstätten- und Bibliothekssatzung – vermutlich eine charmante Umschreibung für bevorstehende Gebührenerhöhungen im Jahr 2025. Das Arbeitsprogramm des Kulturausschusses liest sich wie immer wie die Planung eines gigantischen Festspiels, endet pünktlich im Juni und mündet in eine monatelange Selbstbeweihräucherung bis zum Jahreswechsel.
Eine revolutionäre Neuigkeit gibt es aber doch: Ein Tag der offenen Tür erst im Jahr 2026. Wieso? Nun ja, Transparenz braucht ihre Zeit… oder ein ordentliches Budget, letzteres wird in der Zukunft schwierig sein.
-Bauausschuss: Geheimhaltung als oberste Priorität-
Der Bauausschuss glänzt einmal mehr mit seiner bewährten Methode: möglichst wenig sagen, möglichst viel verschweigen. Öffentliche Informationen zu Baufragen? Natürlich gut verschlossen in der politischen Schatztruhe. Schließlich lebt es sich entspannter, wenn die Öffentlichkeit einfach erraten muss, was passiert. Doch während draußen die große Stille herrscht, wird drinnen fleißig gearbeitet: Die Crivitzer Wärme GmbH nimmt Gestalt an – eine wahre Karriere-Oase für alle, die sich bisher politisch nicht wirklich glänzen konnten. Endlich eine Chance, sich strategisch neu zu positionieren. Wer hätte gedacht, dass Stadtentwicklung nicht nur Häuser betrifft, sondern auch Karrieren? Klingt nach einer Win-Win-Situation für ausgewählte Insider!
-Umweltausschuss: Naturliebe in Dauerschleife-
Der Umweltausschuss arbeitet pflichtbewusst seine Standardthemen ab: Baumbegehungen, Stadtpark, Arboretum und – Trommelwirbel – die Vergabe der Umweltpreise. Die Kandidaten dafür stehen selbstverständlich lange vorher fest. Eine echte Überraschung wäre wohl nur, wenn sich an diesem Ritual jemals etwas ändern würde.
-Sozialausschuss: Noch in der Orientierungsphase-
Der Sozialausschuss bereits eifrig die regionale Schule, den Sportplatz und die Diakonie, hat jedoch ein kleines Problem: Ein eigenes Arbeitsprogramm scheint ihm noch nicht ganz aufgegangen zu sein. Vielleicht findet er es ja in einem der nächsten Sitzungen im Jahr 2026.
-Hauptausschuss: Genehmigungsstelle für bereits getroffene Entscheidungen-
Der Hauptausschuss genehmigt wie gewohnt nachträglich alle finanziellen Vergaben, die die Stadtspitze bereits eigenmächtig entschieden hat – schließlich wäre eine vorausschauende Prüfung viel zu langweilig. Die wirklich relevanten Debatten laufen ohnehin im nicht-öffentlichen Bereich. Wozu sich mit unangenehmen Fragen herumschlagen, wenn man sie einfach hinter verschlossenen Türen vermeiden kann?
-Arbeitsgruppe Wärme & Energie: Geldmaschinen bauen leicht gemacht-
Die Arbeitsgruppe Wärme und Energie [Vorsitzender Alexander Gamm – auf Facebook unter dem Pseudonym Paul Hermann unterwegs] verfolgt ihr ganz eigenes Zukunftsprojekt: Eine gemeinsame GmbH mit dem Energieversorger WEMAG, die mit Windrädern und Solaranlagen in Wessin und Zapel ein lukratives Geschäft abwerfen soll. Sogar die physische Beteiligung an einem Windrad steht zur Diskussion – vielleicht als Symbol der innigen Verbindung zum schnellen, großen Geld.Die geplante Wärmeversorgung für die Neustadt ist ebenfalls in Arbeit, während die Ortsteile und die Altstadt natürlich leer ausgehen. Aber keine Sorge, das aufwendige Projektmanagement wird sich lohnen! Natürlich braucht es ausreichend neue Stühle im Aufsichtsrat und in der Leitung – schließlich müssen ja auch jene unterkommen, die bislang politisch eher am Rand standen und dringend eine Plattform für ihre längst überfällige Karriere suchen. Ein wahrer Glücksfall für alle, die bisher eher Zuschauer als Akteure waren!
Fazit: Willkommen in der politischen Komfortzone
Und so bleibt es dabei: Weiter so! Wer Veränderung erwartet hat, wird bitter enttäuscht. Wer jedoch die Kunst des Aussitzens zu schätzen weiß, ist hier genau richtig. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Spektakel. Ein Besuch, der sich lohnt – wenn Sie schon immer wissen wollten, wie Geduld auf die Probe gestellt wird!
04.Mai 2025 /P-headli.-cont.-red./439[163(38-22)]/CLA-275/14-2025
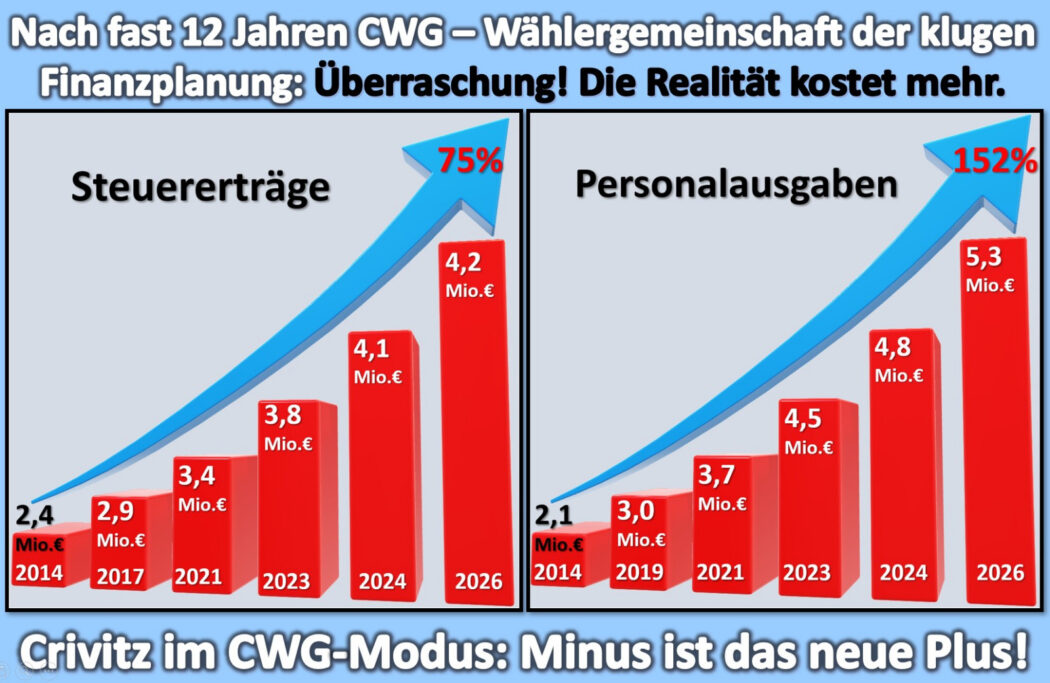
Während die Kassen so leer sind wie ein frisch geplündertes Sparschwein, hält die Begeisterung an – schließlich lässt sich mit Optimismus vieles überdecken. Die Steuereinnahmen? Nun ja, sie reichen inzwischen nicht einmal mehr aus, um die Personalkosten der Stadt Crivitz zu decken.
Crivitz erlebt das große finanzielle Erwachen: Nach fast zwölf Jahren CWG-Strategie klafft im Haushalt ein Loch, das selbst mit optimistischen Berechnungen nicht mehr schöngerechnet werden kann.
Und trotz kontinuierlicher Steuererhöhungen in den letzten zwölf Jahren gibt es immerhin einen echten Wachstumsschlager: Die Mitarbeiterzahl der Stadtverwaltung ist von 47 im Jahr 2014 auf stolze 127 im Jahr 2026 gestiegen! Wer hätte gedacht, dass Bürokratie sich schneller vermehrt als die Einnahmen?
Doch damit nicht genug! Satte 52 % der Gesamteinnahmen der Stadt – darunter Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen vom Land MV – sind bereits fest für die Personalkosten reserviert. Wer braucht schon Spielraum für Infrastruktur oder Investitionen, wenn man stattdessen eine florierende Verwaltung unterhalten kann? Kein Wunder, dass die Liquidität stetig sinkt und die Schulden der Stadt bis 2040 auf geschmeidige 5 Millionen Euro anwachsen werden. Eine Finanzstrategie mit Weitblick – allerdings wohl eher in Richtung Abgrund.
Bleibt nur die spannende Frage: Wie lange sieht die Finanzaufsicht noch zu? Wann kommt endlich die Einsicht, dass sich wirtschaftliche Realität nicht einfach wegdiskutieren lässt? Ein Haushalt ist keine Wunschliste, und Steuergeld kein unendlich sprudelnder Brunnen.
Die Steuerzahler und die kommende Generation dürfen sich jedenfalls auf eine überraschende Erbschaft freuen – in Form von Schulden, die mit Sicherheit beständig bleiben. Ein Haushalt ist keine Wunschliste, und Steuergeld kein unendlich sprudelnder Brunnen.
Fazit: Fast 12 Jahre CWG – eine Ära der großartigen Visionen und noch großartigeren Rechnungen!
30.April 2025 /P-headli.-cont.-red./438[163(38-22)]/CLA-274/13-2025
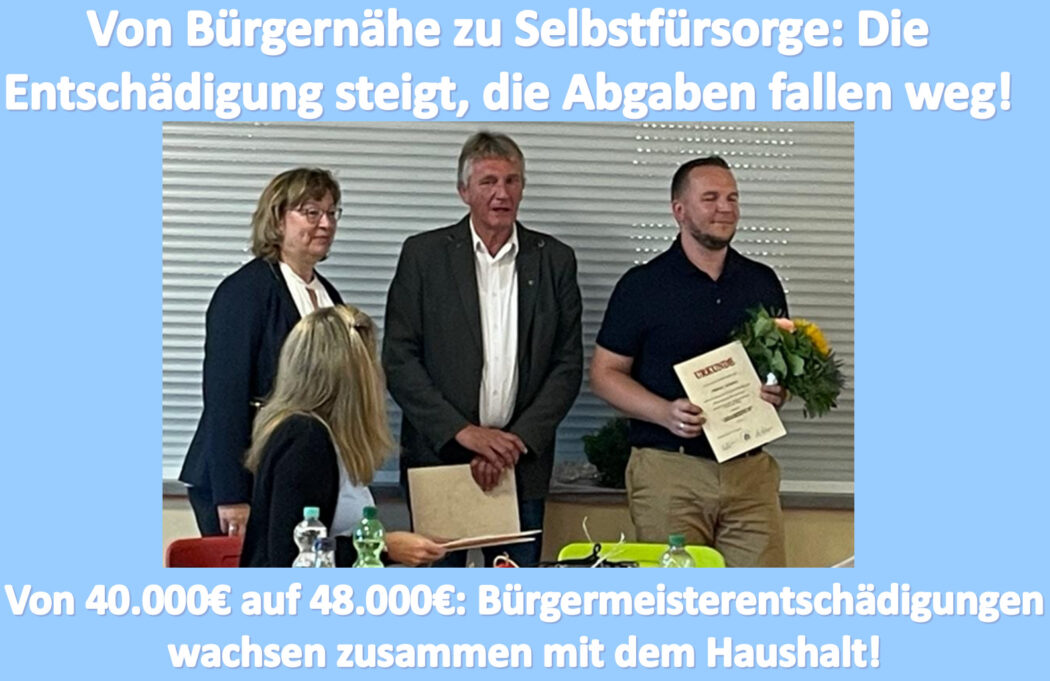
Die finanzielle Lage der Stadt Crivitz ist angespannt – Haushaltsdefizite, steigende Kosten und eingeschränkte Mittel bestimmen die kommunale Finanzpolitik. Dennoch sieht der Haushaltsplan für 2025 eine deutliche Erhöhung der Bürgermeisterentschädigungen vor. Statt der bisherigen rund 40.000€ pro Jahr steigen die Bezüge auf etwa 48.000€, und das Abgabenfrei.
Diese Entscheidung wirft Fragen auf: Während öffentliche Ausgaben gekürzt werden und zahlreiche kommunale Projekte unter Finanzierungslücken leiden, genehmigt man sich eine spürbare Gehaltserhöhung. Wie lässt sich eine solche Maßnahme rechtfertigen, wenn gleichzeitig über Sparzwänge und wirtschaftliche Engpässe diskutiert wird?
Befürworter könnten argumentieren, dass die Bürgermeister eine angemessene Vergütung für ihre Arbeit erhalten müssen. Doch angesichts der finanziellen Schwierigkeiten der Stadt stellt sich die Frage, ob eine Gehaltserhöhung in dieser Größenordnung das richtige Zeichen setzt. Kritiker sehen darin eher eine Prioritätensetzung zugunsten der Amtsinhaber – und auf Kosten anderer notwendiger kommunaler Investitionen.
Während Bürger und örtliche Einrichtungen mit reduzierten Mitteln wirtschaften müssen, stellt sich die Frage, warum gerade bei den Bürgermeisterentschädigungen nicht dieselbe Haushaltsdisziplin angewandt wird. Ist diese Erhöhung vertretbar, oder zeigt sie vielmehr, dass politische Verantwortung zunehmend mit finanziellen Vorteilen für Amtsträger verknüpft wird?
22.April 2025 /P-headli.-cont.-red./437[163(38-22)]/CLA-273/12-2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 28.04.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen die Haushaltssatzung erlassen.
Am 28.4.2025 werden die Stadtvertreter eine schwere Entscheidung treffen müssen,eineEntscheidung und ein Beschluss die weit in die Zukunft reicht. Seine Einwohnern, deren Kinder und Enkelkinder werden es ausbaden müssen, sollten die falschen Entscheidung getroffen werden.
Mit dieser zu bestätigenden Haushaltssatzung durch die Stadtvertreter wird ab 2026 ein Haushaltsausgleich trotz Rücklagen unmöglich werden und die Kapitalreserven sind dann vollständig aufgebraucht. Die liquiden Mittel verfallen bis 2028 in ein Defizit von fast 5.000 000,00€, was die Zahlungsfähigkeit der Stadt unmgänglich macht.Riesige Kredite werden sich auftürmen und überschreiten die genehmigungsfreien Grenzwerte und bringen die Stadt in eine Schuldenspirale. Investitionen werden ohne drastische Gegenmaßnahmen nicht mehr möglich werden und damit wird am Ende der Verlust der finanziellen Selbständigkeit drohen und das zu erwartende Haushaltssicherungskonzept.
Die Stadt wird dann kaum in der Lage sein, notwendige Investitionen zu tätigen, was die Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen beeinträchtigen könnte. Die Aufnahme weiterer Kredite erhöht die langfristige finanzielle Belastung und könnte zu einer Überschuldung führen und die
Aufsichtsbehörde könnte Maßnahmen wie eine Haushaltssperre oder die Einsetzung eines Beauftragten anordnen. Die finanzielle Krise könnte die Handlungsfähigkeit der Stadt erheblich einschränken. Crivitz steht vor der dringenden Aufgabe, eine umfassende Konsolidierungsstrategie zu entwickeln, um die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. Das die finanzielle Situation der Stadt alarmierend ist und zeigt eine deutliche Schieflage in der Haushaltswirtschaft.
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 prognostiziert bereits ein erhebliches Defizit von -2.020.800,00 Euro. Während im Planjahr 2025 ein Haushaltsausgleich noch gerade so möglich ist, wird ab dem Jahr 2026 dieser trotz der Entnahme aus Rücklagen und des Einsatzes von Ergebnisvorträgen nicht mehr erreicht. Es zeichnet sich ab, dass die Stadt ohne externe Unterstützung oder grundlegende Veränderungen dauerhaft keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen kann.
Ein weiteres kritisches Problem stellt die Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage dar, die gemäß § 16 FAG ab 2025 vollständig aufgebraucht ist. Damit fehlen der Stadt wichtige Mittel für investive Projekte und übergemeindliche Aufgaben. Gleichzeitig wird die allgemeine Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik bis Ende 2025 ebenfalls vollständig entnommen, sodass keine finanziellen Reserven mehr vorhanden sind.
Die Liquiditätslage verschärft sich zusätzlich: Der Bestand an liquiden Mitteln von etwa 805.000,00 Euro Ende 2024 wird bereits im Folgejahr aufgebraucht sein. Bis 2028 entsteht ein massives Defizit der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.880.850,73 Euro. Besonders beunruhigend ist, dass die laufenden Ausgaben bereits im Jahr 2025 eine Deckungslücke von -1.658.127,38 Euro aufweisen, die durch Kassenkredite ausgeglichen werden muss. Die geplanten Kassenkredite in Höhe von 2.500.000,00 Euro übersteigen jedoch die genehmigungsfreie Grenze nach § 53 Abs. 3 KV M-V, da sie rund 21 % der laufenden Einzahlungen ausmachen.
Zusätzlich erhöht sich die Belastung durch Investitionskredite. Neben bestehenden Zusätzlich erhöht sich die Belastung durch Investitionskredite. Neben bestehenden Krediten für den Umbau der Grundschule und der Kindertagesstätte plant die Stadt die Aufnahme weiterer Schulden, einschließlich eines Kredits für die Sanierung der regionalen Schule ab 2027 in Höhe von 774.000,00 Euro. Diese steigende Verschuldung könnte langfristig die finanzielle Stabilität der Stadt beeinträchtigen.
Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wird mit einer Punktzahl von -70,0 als gefährdet eingestuft, was die Notwendigkeit drastischer Konsolidierungsmaßnahmen verdeutlicht.
Ohne eine grundlegende Restrukturierung der Haushaltsplanung steht die Stadt Crivitz vor der Gefahr, ihre finanzielle Selbstständigkeit zu verlieren und unter die Aufsicht externer Behörden zu geraten.Dringendes Handeln ist erforderlich, um die finanzielle Situation zu stabilisieren und die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen.
14.April 2025 /P-headli.-cont.-red./436[163(38-22)]/CLA-272/11-2025

Hier im Anschluss die wichtigsten Änderungen und Neuerungen aus der Hauptsatzung vom März 2025
In den Ortsteilen der Stadt Crivitz gibt es bald mehr Mitbestimmung: Für die Ortsteile Gädebehn, Kladow, Basthorst, Augustenhof und Muchelwitz wird eine gemeinsame Ortsteilvertretung Gädebehn gewählt. Jeder Ortsteil soll durch ein Mitglied vertreten sein. Falls sich in einem Ortsteil keine Kandidatin oder kein Kandidat findet, kann die Vertretung auch durch Personen aus den anderen Ortsteilen ergänzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger wählen diese fünf Mitglieder direkt – die Wahl findet im September 2025 statt. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende wird aus der Mitte der Vertretung gewählt.
Auch für Wessin, Badegow und Radepohl entsteht eine gemeinsame Ortsteilvertretung Wessin mit ebenfalls fünf direkt gewählten Mitgliedern aus diesen drei Ortsteilen. Die Wahl läuft nach den gleichen Regeln und findet ebenfalls im September 2025 statt.
Die Vorsitzenden dieser Ortsteilvertretungen – oder von ihnen bestimmte Vertreterinnen und Vertreter – erhalten ein Rederecht und dürfen Anträge in der Stadtvertretung und deren Ausschüssen stellen, sofern es um Themen ihrer Ortsteile geht. Die Sitzungen sind öffentlich, und die Vorsitzenden können zudem Einwohnerversammlungen einberufen. Auch dürfen die Ortsteilvertretungen Einspruch einlegen, wenn Entscheidungen der Stadtvertretung das Wohl ihrer Ortsteile negativ beeinflussen.
Die Stadtvertretung arbeitet mit verschiedenen Ausschüssen, die sich aus sieben Personen zusammensetzen – vier Stadtvertreterinnen oder Stadtvertreter sowie bis zu drei sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner. Es gibt keinen Ersatz für diese Mitglieder. Die Stadt hat unter anderem Ausschüsse für Bau, Soziales, Umwelt sowie einen Hauptausschuss.
Darüber hinaus gibt es den Senioren- und Behindertenbeirat, der bis zu zehn engagierte Einwohnerinnen und Einwohner versammelt, die sich für die Belange älterer Menschen und Menschen mit Behinderung einsetzen. Dieser Beirat wird von der Stadtvertretung gewählt und berät zu relevanten Themen. Der oder die Vorsitzende – oder ein bestimmtes Mitglied – nimmt an Stadtratssitzungen teil und hat dort Rederecht und Antragsrecht. Der Beirat tagt mindestens dreimal im Jahr öffentlich.
Für ihr Engagement erhalten die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirats ein Sitzungsgeld von 40 Euro pro Sitzung, die oder der Vorsitzende sogar 60 Euro. Die Bürgermeisterin bekommt eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.000 Euro. Ihre beiden Stellvertretenden erhalten monatlich 600 bzw. 300 Euro.
Die neue Satzung der Stadt Crivitz tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft – das ist der 13. März 2025. Sie wurde ordnungsgemäß dem Landkreis Ludwigslust-Parchim vorgelegt. Sollte es dabei zu Verfahrensfehlern gekommen sein, können diese innerhalb eines Jahres beanstandet werden.
08.April 2025 /P-headli.-cont.-red./435[163(38-22)]/CLA-271/10-2025

Gestern zum 18.00 Uhr hatte die Bürgermeisterin zur Stadtvertretersitzung geladen. Sie selbst war nicht anwesend, dafür leitete die Sitzung ihr Stellvertreter Marcus Eichwitz.
Im TOP 8 der vorliegenden Tagesordnung ging es um die neue Hebesatzsatzung gültig ab 2025 für Crivitz. Die angeregte Gesprächsrunde mit lebhafter Diskussion hatte zum Ziel den Hebesatz gerecht, ausgewogen und verhältnismäßig festzulegen. Es ging vor allem um die bereits bestehen finanziellen Belastungen für Bürger und Unternehmen zu minimieren und auf ein vernünftiges Maß auszurichten.
Der Fraktionsvorsitzende der AfD Behning verlas vor der Abstimmung ein Statement seiner Partei zu der anstehenden Problematik, mit der Bitte dieses dem Protokoll beizufügen. Hier bat er um den Gleichmäßigkeitsgrundsatz aus dem Finanzausgleichsgesetz zu berücksichtigen. Er sagte ebenfalls „Wir sollten unserer Verantwortung gemäß, der Kommunalverfassung und dem Haushaltsgesetz gerecht werden, eine Erhöhung des Hebesatzes aussetzen, satt dessen auf langfristige und planbare Maßnahmen und nach sozialverträglichen Lösungen suchen.“
Naja, als es dann zur eigentlichen Abstimmung kam, war es wie schon vorher angenommen, es stimmten 12 von den 15 anwesenden Stadtvertretern für eine Erhöhung, die 7 aus der CWG, 3 von der CDU und 2 vom BfC. Lediglich die drei Abgeordneten der AfD Fraktion stimmten einheitlich gegen die Erhöhung.
Ob das genügen wird den desolaten Haushalt der Stadt wieder auf einen ausgewogenen Kurs zu bringen und ein zu erwartendes Haushaltssicherungskonzept zu verhindern.
06.04.April 2025 /P-headli.-cont.-red./434[163(38-22)]/CLA-270/09-2025
Erstmals wird auch die Stadt Crivitz in diesem Jahr die Grundsteuer B nach den neuen Regeln berechnet. Die endgültigen Zahlen gab’s noch nicht, da die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Die neuen Grundsteuer-Hebesätze für die Stadt sollen am 7.4.2025 in der Stadtvertretung beschlossen werden, aber es gibt Zweifel an der Aufkommensneutralität. Darüber soll am Montag nochmals in der Stadtvertretung gesprochen werden. Die Ortsteilvertretung Gädebehn hat bereits teilweise gegen eine Erhöhung gestimmt und einige Stadtvertreter wollen dem Antrag ebenfalls nicht zustimmen.
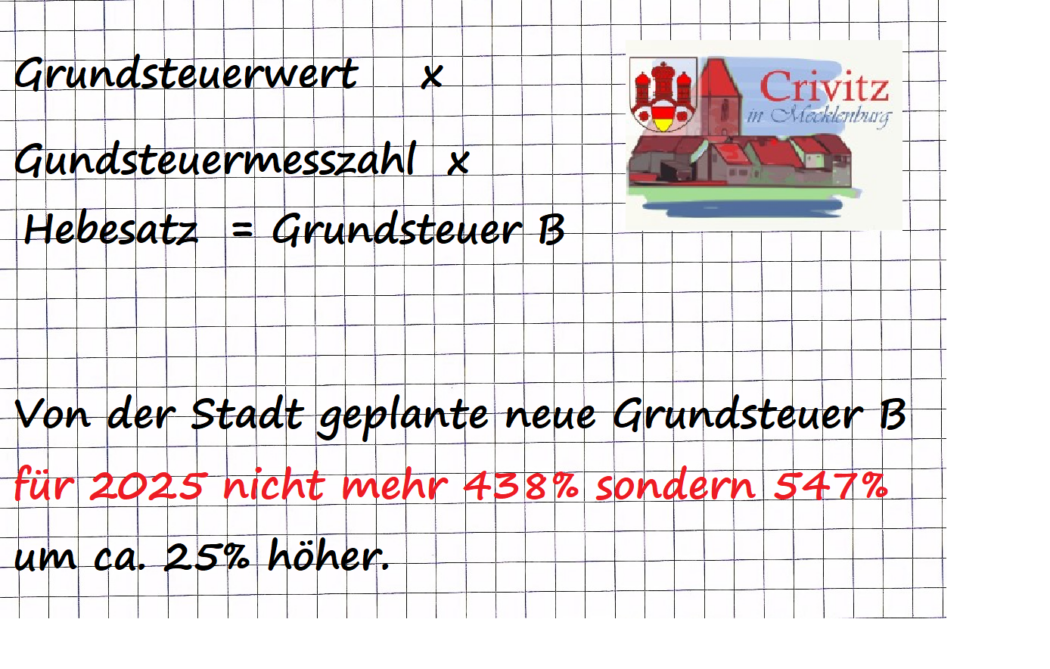
Seit 1.Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage neuer Regeln und neuer Hebesätze erhoben. Die neu berechnete Grundsteuer hat zu vielen Diskussionen und auch zu Verunsicherung geführt.
Stichwort Aufkommensneutralität: Bei der Aufkommensneutralität handelt es sich um eine Empfehlung des Bundes. Das heißt: Städte und Gemeinde müssen sich nicht an diese Empfehlung halten.Die Steuerpflichtigen dürfen nicht übermäßig belastet werden und dabei dürfen ihre Vermögensverhältnisse nicht grundlegend beeinträchtigt werden. „Die Grundsteuer darf nicht zu einer Erdrosselungssteuer werden“, formulierte es das Bundesfinanzministerium. Den Gemeinden sind bei einer Erhöhung der Hebesätze also verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt.
Auch in Crivitz hat man sich Aufkommensneutralität auf die Fahne geschrieben und es soll wegen des klammen Haushalts eine Erhöhung des Hebesatzes von 438% auf 547% geben, wobei der Nivellierungshebesatz bei 438% liegt.
Bei den Messbeträgen aber ist die Stadt außen vor, hier ist das Finanzamt am Zug, da müsste ein Einspruch beim Finanzamt eingelegt werden.
Der Hebesatz wird nach dem Votum der Stadtvertretung festgesetzt. Härtefälle aber kann es gleichwohl geben, Fälle eben, in denen die Grundsteuer deutlich höher ist als in der Vergangenheit.
Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz im Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 7 FAG M-V) verpflichtet die Kommunen, eine gerechte und ausgewogene Verteilung der finanziellen Mittel sicherzustellen. Eine kurzfristige Anpassung der Grundsteuer B würde diesen Grundsatz untergraben, da sie die Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig belastet und die finanzielle Stabilität gefährdet. Die Kommunen sollten sich stattdessen auf langfristige und planbare Maßnahmen konzentrieren, um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern.
Das Haushaltsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 2) fordert eine verantwortungsvolle und sozialverträgliche Gestaltung der öffentlichen Finanzen. Eine kurzfristige Erhöhung der Grundsteuer würde die Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig belasten, insbesondere in einer Zeit, in der viele Haushalte bereits mit steigenden Lebenshaltungskosten und wirtschaftlichen Unsicherheiten kämpfen. Dies könnte den sozialen Frieden gefährden und das Vertrauen in die kommunale Verwaltung nachhaltig beeinträchtigen.
Angesichts der genannten rechtlichen und sozialen Aspekte sollten die Kommunen von einer kurzfristigen Anpassung der Grundsteuer abzusehen. Stattdessen sollten nachhaltige und langfristige Maßnahmen ergriffen werden, um die finanzielle Stabilität zu sichern und die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu minimieren. Die Kommunen müssen ihrer Verantwortung gemäß der Kommunalverfassung, dem Haushaltsgesetz und dem Finanzausgleichsgesetz gerecht werden und transparente sowie sozialverträgliche Lösungen verfolgen.
03.April 2025 /P-headli.-cont.-red./433[163(38-22)]/CLA-269/08-2025
Er kann schon mit ein bischen Stolz auf seinen Erfolg zurück schauen – Dalijeet Singh der Besitzer des indischen Reataurants am Markt in Crivitz.
Bald jährt sich zum dritten mal die Gründung und es ist unschwer an der liebevollen Gestaltung der Außenansicht so wie der Innenräume die Liebe zum Detail zu erkennen. Mit seinem Team lässt er sich immer wieder was neues einfallen, dass den Gästewünschen ganz nahekommt. Jetzt die neue Mittagskarte ab 1.April 2025, da läuft einem das Wasser schon beim lesen zusammen.
Schauen sie rein und fangen an zu probieren . es lohnt sich.
https://www.tajmahal-crivitz.de

Teilansicht der Mittagskarte – mehr dazu auf der entsprechenden Homepage
15. März 2025 /P-headli.-cont.-red./432[163(38-22)]/CLA-268/07-2025

Eine Immobilie gilt seit langem als ein sicheres Anlagegut. Das sogenannte Betongold soll in guten wie in schlechten Zeiten seinen stabilen Wert behalten und über die Mieten einen regelmäßigen Zufluss an Geldern ermöglichen.
Das deutsche Nettoanlagevermögen in Wohn- und Nichtwohnbauten betrug 2022 rund 12,1 Billionen Euro. Davon entfielen 62 % auf Wohnbauten und 38 % auf Wirtschaftsimmobilien. Zusammen mit den Grundstückswerten (7,3 Billionen Euro), summiert sich das gesamte deutsche Immobilienvermögen auf knapp 19,4 Billionen Euro.
Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist im dritten Quartal 2024 um 197 Milliarden Euro gestiegen. Es erreichte somit zum Quartalsende ein neues Rekordniveau von 9.004Milliarden Euro. Damit setzt sich die seit Ende 2023 andauernde Wachstumsserie fort.
Bereits in den letzten Jahren und Monaten zeigt sich auch in Deutschland eine bedenklich Richtung. Die Verordnung von Höchstmieten oder eine deutliche Anhebung der Grundsteuer sind bereits Vorboten eines Wunsches nach Ausgleich. Vor allem in Zeiten in denen die Ungleichheit der Vermögen in einem Land sehr hoch ist, bringen die Immobilie regelmäßig in den Fokus der Politik.
Der Griff nach Maßnahmen wie der Zwangshypothek ist in normalen Zeiten eher unwahrscheinlich. Selbst eine „normale“ Rezession dürfte die Politik kaum verleiten diesen sehr unpopulären Weg zu gehen. Doch vor allem in Zeiten in denen es Probleme mit einer hohen Staatsverschuldung und Kreditaufnahmen in Billionensumme gibt ändert sich diese Wahrscheinlichkeit. Immerhin sind die Wertstabilität und die Unbeweglichkeit der Immobilie in Zeiten knapper Staatskassen durchaus vorstellbare Elemente der Rekapitalisierung eines Staates.
Dabei wirken Zwangshypotheken des Staates oftmals wie eine Art Steuer. Die letzte staatliche Zwangshypothek im Zuge der Währungsumstellung aus dem Jahre 1948 etwa, war eine Eintragung über 30 Jahre. Immobilienbesitzer waren gezwungen auf Ihren Grundbesitz in vierteljährlichen Raten diese „Sondersteuer“ abzutragen. Damals galt ein Freibetrag von 5.000 Mark. Die Höhe dieser Abgabe bemaß sich am Vermögen mit Stand vom 21. Juni 1948, dem Tag nach Einführung der D-Mark. Die Abgabe belief sich damals auf 50 % des berechneten Vermögenswertes.
In wirklich schlechten Zeiten kommt es regelmäßig zu Maßnahmen durch Staaten, um die eigenen Finanzen zu stabilisieren. Für die Besitzer von Vermögen bedeuten diese Jahre oftmals sehr schmerzhafte Einschnitte in die Souveränität ihres Vermögens. Neben Steuererhöhungen, Kapitalverkehrskontrollen oder auch dem viel gefürchteten Goldverbot gehören auch Zwangshypotheken zu diesen Maßnahmen. Auch in Deutschland wurden diese Zwangshypotheken bereits mehrfach in den letzten 100 Jahren als Mittel zur Aufbesserung der staatlichen Finanzen genutzt.
Die derzeitige aktuelle politische und wirtschaftliche Lage Deutschlands und die Aufnahme von Krediten in Billionenhöhe ( das so genannte Sondervermögen) lassen nichts Gutes diesbezüglich für die Zukunft erahnen.

06.März-2025/P-headli.-cont.-red./431[163(38-22)]/CLA-267/06-2025

Nr.B 10/25 | 10.02.2025 | StALU WM | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg.Die Energieallianz MV Projekt Nr. 11 GmbH & Co. KG (Meschendorfer Weg 12, 18230 Rerik) erhielt mit Datum vom 04.10.2024 die Genehmigung für oben genanntes Vorhaben (Gez.: 37/24).
Der verfügende Teil des Genehmigungsbescheids hat folgenden Wortlaut:
Die Genehmigung wurde mit Nebenbestimmungen verbunden.
Der Genehmigungsbescheid zu dem Verfahren zur Errichtung und dem Betrieb von 20 WKA wurde am 30. Dezember 2024 im Amtlichen Anzeiger M-V (AmtsBl. M-V/AAz. Nr. 55, S. 677) bekannt gegeben. Der Genehmigungsbescheid einschließlich seiner Begründung wurde vom 2. Januar 2025 bis einschließlich 16. Januar 2025 öffentlich im StALU WM ausgelegt. Die Auslegung erfolgte ebenfalls online auf dem UVP-Portal der Länder. Eine Bekanntmachung des Genehmigungsbescheids auf der Homepage des StALU WM erfolgte nicht. Dies wird hiermit nachgeholt. Die Auslegung des Genehmigungsbescheids im StALU WM sowie auf dem UVP-Portal erfolgt daher erneut. Die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das Vorhaben verschiebt sich entsprechend.
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschließlich seiner Begründung wird gemäß § 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG nach der Bekanntmachung für zwei Wochen zur Einsichtnahme ausgelegt. Die Auslegung erfolgt vom 18.02.2025 bis einschließlich 03.03.2025 zu den angegebenen Zeiten im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Bleicherufer 13, 19053 Schwerin), 1. Obergeschoss – Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
04.März-2025/P-headli.-cont.-red./430[163(38-22)]/CLA-266/05-2025
Ratten am „Haus für betreutes Wohnen“ in der Parchimer Straße. Schon mehrfach sind wir von Bewohnern des „betreuten Wohnens“ in der Parchimer Straße angesprochen worden und auf die Rattenplage des Gelände am Amtsbach hingewiesen.
Heute konnten wir uns von den angerichteten Schäden am Steinwall überzeugen und die gefährliche Situation mit Fotos dokumentieren. Mit einem Absperrband wird wohl keiner den Gefahren für die Bewohner gerecht. Hier ist schnelles handeln des Eigentümers angesagt, bevor etwas passiert.





24.Febr.-2025/P-headli.-cont.-red./429[163(38-22)]/CLA-265/04-2025
Es gibt sie nicht nur in Crivitz, wahrscheinlich auch in allen Städten diese vergessenen Häuser. Auf der gestrigen Stadtvertretersitzung im Kladower Gemeinschaftshaus wurde es nochmals deutlich, als sich ein Einwohner über den haltlosen Zustand des Hauses in seiner Nachbarschaft der Breiten Straße 45 beklagte.
Seit ewiger Zeit ist das Haus unbewohnt und bricht von Giebel her langsam zusammen. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen des Kreises versperren die Hälfte der Straße und kosten sicherlich auf Dauer richtig viel Steuergeld.
Lösungsansätze die für alle solche Gebäude gelten wurden diskutiert, wie die Einschaltung des Bürgerbeauftragten des Landes oder eine abschließende komplette Enteignung der oder des Eigentümers.
Es ist dramatisch zuschauen zu müssen, wie eine Stadt langsam verfällt an Attraktivität und kleinstädtischem Charme verliert. Die Schmutzecken und Baulücken sind nicht mehr zu übersehen und es bedarf dringend einer Veränderung der Handhabe und Einstellung in der Stadtpolitik.
Hier noch einige typische Beispiele des bestehenden Zustandes.






03.Febr.-2025/P-headli.-cont.-red./428[163(38-22)]/CLA-264/03-2025
Die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 hat einiges verändert: Die Stadtvertretung von Crivitz wurde neu zusammengesetzt, und dabei endete die bisherige Alleinmehrheit der CWG. Nach dem neuen Wahlergebnis verteilt sich die Sitzanzahl wie folgt: Die CWG stellt künftig 8 Mitglieder, CDU, AfD und BfC jeweils 3.
In der Stadtvertretersitzung am 9. Dezember 2024 wurde die überarbeitete Hauptsatzung der Stadt zur Beratung vorgelegt. Wenn die Kommunalaufsicht keine Änderungen verlangt, wird die Satzung in der aktuellen Fassung bestätigt und nach ihrer Veröffentlichung offiziell gültig.
Sobald die Rechtsaufsicht grünes Licht gegeben hat, schauen wir uns die geplanten Änderungen der Satzung ganz genau an. Eine Übersicht dieser Veränderungen finden Sie in der beigefügten PDF-Datei – dort sind alle Änderungen deutlich in Rot hervorgehoben. Es lohnt sich reinzulesen: Die Anpassungen sind spannend und geben einen Einblick in die möglichen neuen Anforderungen, die auf uns Bürgerinnen und Bürger zukommen könnten.

02.Febr.-2025/P-headli.-cont.-red./427[163(38-22)]/CLA-263/02-2025
Für alle die, die schon lange darauf gewartet haben. Es ist wieder so weit, die Zeit der Winterruhe und des Wartens ist nun auch für uns als Redaktion vorbei.
Wir werden ab Februar in alter Manier wieder Berichte, Artikel und Informationen aus und um Crivitz für euch vorbereiten und anbieten. Das Marerial wird zur Zeit noch redaktionell gesichtet und demnächst für alle Leser bereit gestellt.

01.Jan.-2025/P-headli.-cont.-red./426[163(38-22)]/CLA-262/01-2025
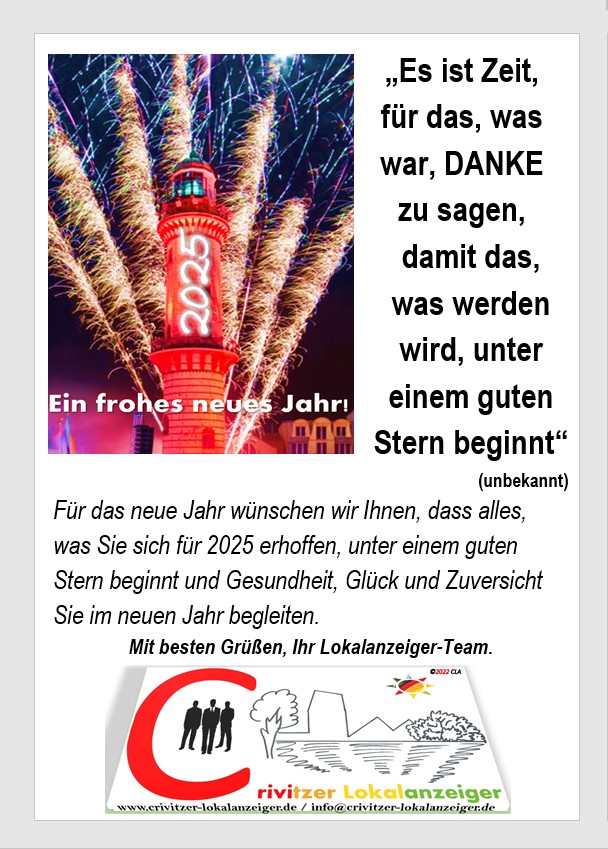
24.Dez.-2024/P-headli.-cont.-red./425[163(38-22)]/CLA-261/100-2024

14.Okt.-2024/P-headli.-cont.-red./424[163(38-22)]/CLA-260/99-2024
Das gleiche Prozedere wie jedes Jahr? Nur mit vereinzelten neuen Gesichtern nach der Wahl!

So oder ähnlich könnte man die Resonanz der Sitzung des Amtsausschusses im September 2024 bezeichnen und nach außen darstellen. Angesichts der Präsenz von nur 8 anwesenden Einwohnern, von denen allerdings vier noch Gemeindevertreter und ein Bediensteter des Amtes waren. Man kann sich also selbst ausrechnen, was da an Spontaneität und frischer Kreativität vom Amtsausschuss über die vergangene Wahlperiode hinweg freigesetzt wurde gegenüber den 25.000 Einwohnern im Amtsbereich von Crivitz.
Aufgrund der Modernisierung der Kommunalverfassung im Mai 2024 wurde ein Zuteilungs- und Benennungsverfahren eingeführt, bei dem die Fraktionen angesichts ihrer gewonnenen Prozente die eigenen Sitze in den Ausschüssen mit Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern ohne Wahl selbst benennen können. Dies gilt ebenso für den Amtsausschuss, in dem 17 Vertreter aus den Gremien der Gemeinden benannt wurden. So befinden sich nun unter den 34 Mitgliedern des Amtsausschusses im Amt Crivitz viele altbekannte Funktionsträger, die nicht von Ihren Gremien in den Gemeinden gewählt wurden, sondern von Ihrer Partei oder Wählergemeinschaft in den Amtsausschuss benannt wurden. Die soeben wiederum als Funktionsträger innerhalb des Amtsausschusses, in dessen Führung oder in die Ausschüsse oder für den eigenen Wirkungskreis (ureigenen Aufgabenbereich des Amtes) erneut gewählt wurden.
Von den 34 entsandten Mitgliedern aus den Kommunen stammen 41 % aus Parteien, 46 % aus Wählergemeinschaften und 12 % sind Einzelbewerber und gehören keiner Partei oder Wählergemeinschaft an. Von den 41 % der Parteien stammen 23 % aus der CDU, 3 % aus der AfD, 6 % aus der SPD und 9 % aus der Partei DIE LINKE. Der Frauenanteil im Amtsausschuss in Crivitz liegt bei ca. 24 %.
Alle Mitglieder des Amtsausschusses von Crivitz haben einen abgeschlossenen Berufsabschluss, wovon 12 % einen Meistertitel und nur 35 % einen Hochschulabschluss besitzen. Das Durchschnittsalter der auserwählten Kanditen aus den Kommunen für den Amtsausschuss beträgt etwa 60 Jahre in Crivitz. Demnach sind nur ca. 38 % der Mitglieder im Amtsausschuss in Crivitz in einem Alter von 33 bis 58 Jahren, aber ca. 56 % junge Alte (60- bis 74 Jahre) und 6 % sind sogar betagte und Hochbetagte (75- bis 89-Jährige) nach der Klassifizierung des Lebensalters der Weltgesundheitsorganisation. An dieser Stelle wird deutlich, wie stark die demografische Entwicklung im ländlichen Raum Einfluss nimmt.
Alle Bürgermeister (17) sind automatisch Mitglieder des Amtsausschusses und bilden somit die Basis für den Amtsausschuss sowie je nach Einwohnerzahl der Gemeinden weitere Mitglieder (17) aus den Gemeinden. So sind etwa 56 % der Mitglieder des Amtsausschusses bereits in der vergangenen Wahlperiode vertreten gewesen, was eine gewisse Kontinuität im kommunalpolitischen Alltag und in den vorhandenen Parteien- und Wählergemeinschaftsnetzwerken oder anderen Verknüpfungen darstellt, da man sich über Jahre hinweg kennt. Die *entspannte Debattenkultur* ist mit den altbewährten Funktionsträgern zurückgekehrt!
Folglich hat sich auch nichts an der Führungsspitze des Amtsausschusses verändert, wie bei der letzten Wahl im Jahr 2019. Frau Brusch Gamm (Wählergruppe CWG-Crivitz) welche von Herrn Eichwitz in voller Einmütigkeit, vorgeschlagen wurde, konnte sich nur ganz knapp ihrem Herausforderer gegenüber Herrn Ronald Radscheidt (ehemaliger Amtsausschussvorsitzenden von 2014 bis zum Rücktritt 14.12.2016 /CDU-Plate) durchsetzen, mit 18 zu 15 Stimmen. Herr Heinrich-Hermann Behr (Einzelbewerber) wurde zum 1. Stellvertreter des Amtsausschussvorsitzenden gewählt, während Herr Hartmut Paulsen (CDU-Crivitz/ trotz seines Rückzugs im Jahr 2021) zum 2. Stellvertreter gewählt wurde.
Es gibt erneut einen neuen beschließenden Hauptausschuss, der die wichtigsten Entscheidungen den Mitgliedern abnimmt, damit sie nicht so häufig zusammenkommen müssen. Dieser elitäre Kreis des Hauptausschusses wird viele Entscheidungen bereits vorab treffen, sodass nur noch einige marginale Restdiskussionen übrigbleiben werden. Durch diese Maßnahme wird die entspannte Debattenkultur im Amtsausschuss die nächsten Jahre erhalten bleiben. Eine Änderung der Kommunalverfassung machte das Unglaubliche möglich. Das Amt Crivitz hat eine Probieraktion in der vergangenen Wahlperiode durchgeführt und erhielt dafür eine Ausnahmegenehmigung. Nun ist also wieder der beschließende Hauptausschuss im Amtsausschuss in Crivitz gänzlich gesetzeskonform und sicherlich auch mit voller Unterstützung des Städte- und Gemeindetages, wo auch wieder seine Mitarbeiter im Amtsausschuss und im engeren Wirkungskreis im Geiste voll mitwirken dürfen.
Eigentlich sollten im Hauptausschuss vorrangig Bürgermeister gewählt werden, da sie auch über die nötige Reputation verfügen. Trotzdem wurden aus der Gemeinde Pinnow Herr Klaus-Michael Glaser (CDU) und aus der Gemeinde Plate Herr Ronald Radscheidt (CDU) in den Hauptausschuss gewählt, anstatt die Bürgermeister. Obwohl sie eigentlich keine Ehrenbeamten (1. oder 2. Stellvertreter) in der Gemeindevertretung sind, stammen sie nicht primär aus der jeweiligen Opposition der Gemeindevertretung. Ob dieser politische Schachzug jedoch von den Anwesenden selbst verstanden wurde, ist ungewiss, da die beiden Herren sicherlich nicht in ihren jeweiligen Gemeinden ausreichende Entscheidungskompetenz erlangen können. Es bleibt wohl eher ein politischer Akt mit persönlichen Hintergründen, der sicherlich noch bis 2029 für Unruhe sorgen wird.
Herr Torsten Lubatsch (CDU) wurde erneut nach 10 Jahren zum Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales, Tourismus, Partnerschaften u. Kultur gewählt, womit sich sicherlich Neuerungen oder Spontanität in dieser Wahlperiode bis 2029 auch in Grenzen halten werden. Alle Kandidaten für Ausschüsse und Führungsfunktionen wurden von altbekannten Teilnehmern und deren Netzwerken vorgeschlagen, mit Ausnahme des AfD-Vertreters. Folglich musste sich dieser selbst vorschlagen für die Wahlen in den Ausschüssen, da er in diesen Gremien keine Lobbynetzwerke hatte. Er schaffte es jedoch, sich in den Rechnungsprüfungsausschuss in einer offenen Wahl mehrheitlich wählen zu lassen. Bei einem erneuten Versuch für den Finanzausschuss wurde sofort eine geheime Wahl durchgeführt, bei der er aber anderen alten Gremienmitgliedern unterlegen war.
Kommentar/Resümee – die Redaktion!
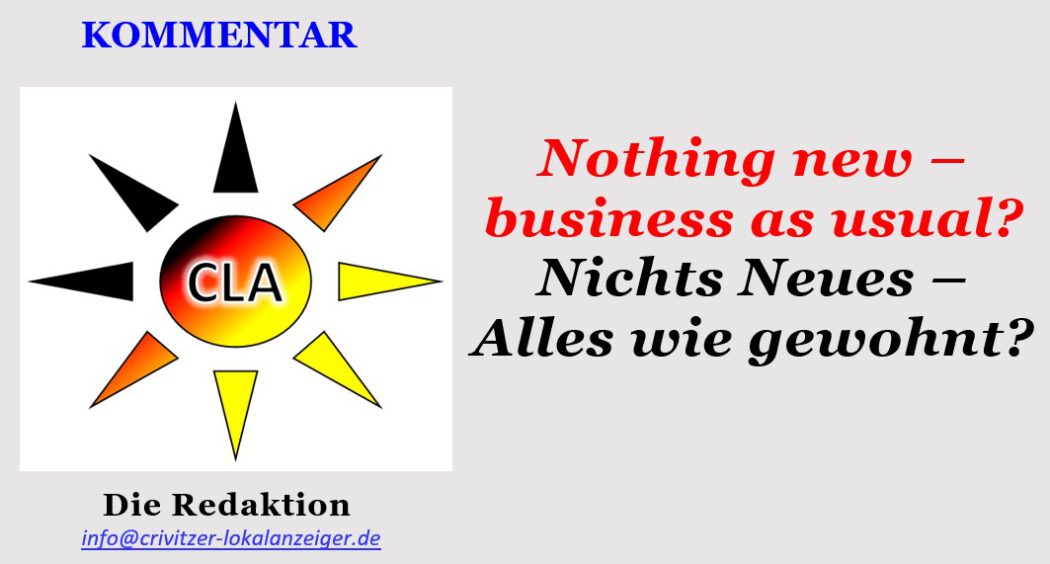
Nothing new – business as usual? Nichts Neues – Alles wie gewohnt?
Es ist schon erstaunlich, wie leicht man sich es macht, die modernisierte Kommunalverfassung zu interpretieren. Ob das jetzt alles wirklich im Sinne des wählenden Volkes ist, muss sich wirklich erst noch zeigen. Es bleibt abzuwarten, ob es sich hierbei tatsächlich um eine Modernisierung handelt, die in der kommunalpolitischen Realität erfolgreich sein wird. Viele Neuheiten müssen sich erst in der Praxis beweisen, da dies das Kriterium der Wahrheit bleibt.
Das mangelnde Interesse der Einwohner an den Sitzungen des Amtsausschusses ist nachvollziehbar. Die Sitzung des Amtsausschusses wurde zwar für die Bürger zugänglich gemacht, jedoch wurde streng darauf geachtet, dass die Bürger keine Äußerungen zu den anstehenden Tagesthemen tätigen durften. Andererseits packt den Amtsausschuss, genauer gesagt seine Führungsspitze, ständig eine sehr große Reiselust (die Entschädigung gemäß der Reisekostenverordnung macht es möglich). Und so sollen Bürger von Bülow oder Demen dieses Mal wieder im Oktober 2024 nach Liessow fahren, nur, um Ihr Anliegen vorzutragen, was auf keinen Fall der Tagesordnung entsprechen darf. Möglicherweise handelt es sich auch bloß um ein politisches Kalkül? Es ist nicht verwunderlich, dass dort möglicherweise wiederum nur wenige Einwohner auftauchen werden.
„Sei geduldig, wenn du im Dunkeln sitzt. Der Sonnenaufgang kommt.“ Rumi
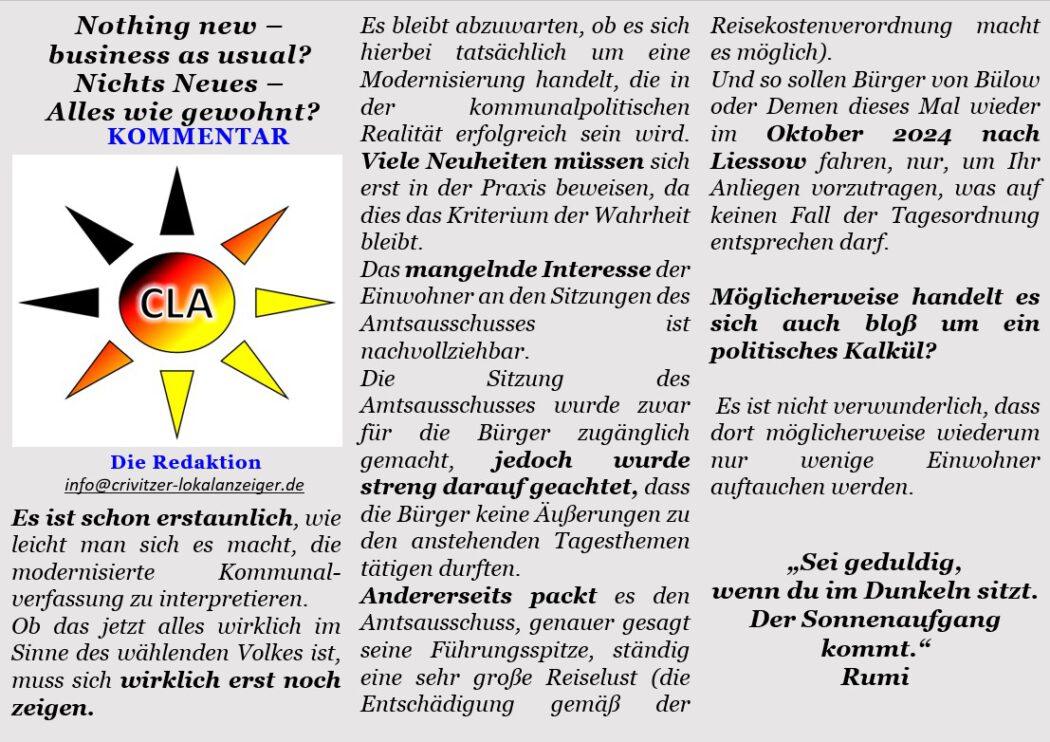
10.Okt.-2024/P-headli.-cont.-red./423[163(38-22)]/CLA-259/98-2024
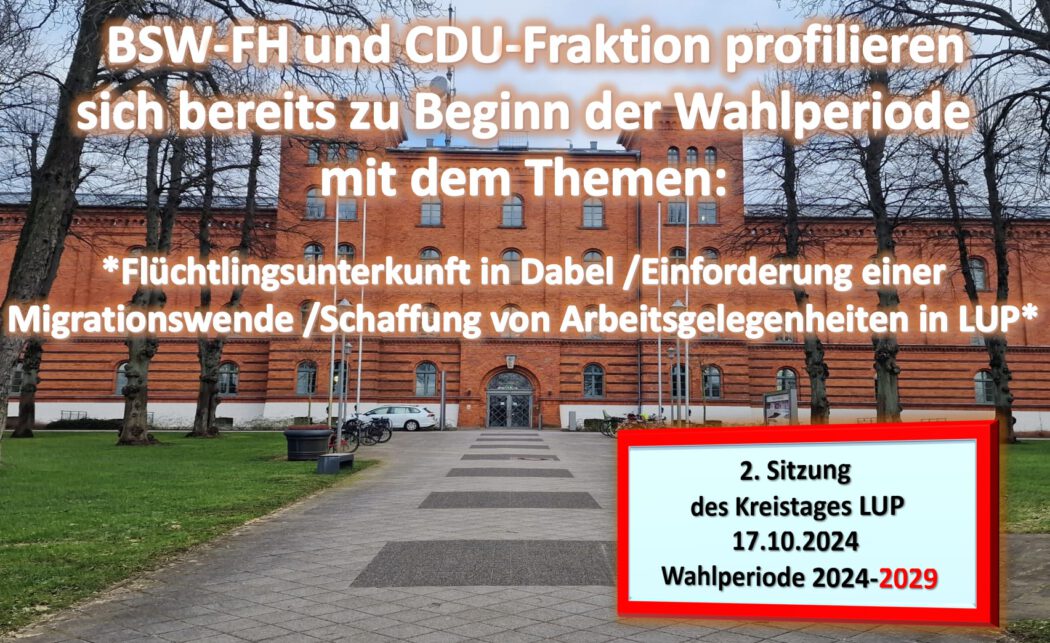
*Flüchtlingsunterkunft Dabel /Einforderung einer Migrationswende und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten im Landkreis LUP*.
Bei der AFD-Fraktion LUP herrscht Schweigen diesbezüglich sowie bei den eigenen Anträgen und man genießt wohl den Augenblick.
Nur noch zwei Sitzungen des Kreistages sind notwendig (Dez.2024 und März 2025), um einen neuen Landrat in LUP zu wählen. Unter diesem Aspekt stehen wahrscheinlich schon die Anträge der Fraktionen von *Zukunft* (SPD +Linke), der CDU sowie BSW und die Gruppe der Grünen, um keinen Moment in der öffentlichen Show im Kreistag zu verpassen. Die AFD-Fraktion ist noch mit sich selbst beschäftigt, da sie noch keinen Fraktionsgeschäftsführer hat und steckt zu den anstehenden Themen noch in einem intensiven Lernprozess.
Ganze zwei Sätze sind ausreichend, um das drängendste Thema der Gruppe der *Grünen*, drei Monate nach der Wahl, auf der Kreistagssitzung zu behandeln. Die Veröffentlichung der Naturdenkmale im Landkreis LUP im Geodaten-Portal. So soll es ermöglicht werden den Einwohnern und Touristen, diese Informationen abzurufen und dann vor Ort zu betrachten. Und das war alles! Hierzu ist alles im feinstenGenderdeutsch formuliert. Wahrscheinlich ist die Gruppe der Grünen nach der Wahl noch immer in Ihrer eigenen Schockstarre gefangen.
Für die neu gegründete Fraktion ZLP (Zukunft LUP), die sich aus der SPD und Teilen der Linksfraktion zusammensetzt, stellt sich dagegen das Thema der kritischen Betrachtung über die Finanzierung der Beratungslandschaft im Landkreis als zentrales Thema dar. Es scheint, dass dieses Thema für die Fraktion der Zukunft das wichtigste zurzeit darstellt und andere nicht von Bedeutung sind. Sie sind besorgt über die zu erbringende Kofinanzierung (Eigenanteil der Träger und auch des LK-LUP) sowie die Finanzierung der Sach- und Personalkosten (neue Tarifrunde 2025), aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung durch Inflation und erhöhte Anforderungen. Da das Land MV beabsichtigt, die Grundlagen der Finanzierungsanteile aller Beteiligten (Kreis +Träger) neu zu strukturieren ab 2025. Daher besteht die Gefahr, dass die Gemeinden bzw. der LK-LUP diese Mittel nicht aufbringen können, um die Existenz der Beratungsstellen über 2025 hinaus sicherzustellen.
So soll nun beschlossen werden, diese Mehrkosten im zukünftigen Haushalt des LK-LUP 2026 zu verankern. Also auch die Fraktion (ZLP) hat sich bereits mit dem heiklen Thema Haushalt 2026 auseinandergesetzt, welches in den kommenden 10 Monaten noch eine heiße Debatte auslösen wird. Dies verdeutlicht wahrscheinlich den verwaltungsrechtlichen Informationsfluss des Justizministeriums, da die Ministerin hier auch Co-Fraktionsvorsitzende der Fraktion ist.
Ganz anders klingt es dagegen aus den Reihen der Fraktion BSW-FH (Bündnis Sahra Wagenknecht – FREiER HORIZONT), die das Thema: Umsetzung der Flüchtlingsunterkunft in Dabel favorisieren. Sie haben sofort die Fraktionsgeschäftsführerin Frau Kathrin Lyhs übernommen, aus der ehemaligen Fraktion Freier Horizont / FREIE WÄHLER. Es ist nicht verwunderlich, dass der parlamentarische Newcomer BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) noch keine erfahrenen Mitglieder hat, was auch auf die lange überdimensionierte Überprüfung der eigenen neuen Mitglieder zurückzuführen ist. Sie fordern die Begrenzung der Flüchtlingszahlen auf 150 Personen in der Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Dabel sowie das Konzept des Inhouse-Unterrichts für schulpflichtige Kinder wie in Demen. Des Weiteren sollte die medizinische Versorgung vom LUP Klinikum am Crivitzer See übernommen und mit Planbetten der Gynäkologie/ Geburtshilfe ergänzt werden. Dies wird begründet mit der Verhältnismäßigkeit zur Anzahl der Einwohner der Gemeinde Dabel und den Herausforderungen der Versorgung durch Kinderbetreuung, Schule und der medizinischen Versorgung.
Die CDU setzt auf große Reden, wie man es von ihrem widergewählten Fraktionsvorsitzenden Herrn Cristian Geier gewohnt ist. Nun will man erneut mit Bundes- und Landesthemen für die zukünftigen Wahlen zum Bundestag 2025 und Landtag 2026 glänzen. Zunächst wird eine Migrationswende im Landkreis gefordert, um den unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen zu stoppen. Es soll untersucht werden, ob die geplante Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für 500 Migranten in Dabel sowohl für die Gemeinde selbst als auch für die umliegende Region und die dort lebenden Menschen akzeptabel und verträglich sind.
Überdies sollte der Landrat prüfen, ob die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auch für den Landkreis LUP von Nutzen sein könnte. Um ein Konzept für eine gemeinnützige Beschäftigung für Asylsuchende zu erarbeiten, welches von den Städten und Gemeinden des LK-LUP sowie sozialen Trägern unterstützt wird. Hierzu wird nicht beschrieben, wie das alles finanziert werden soll. Es heißt wie üblich lapidar: Die Refinanzierungsmöglichkeiten von Bund und Land sollten geprüft werden. Es ist anzunehmen, dass in der CDU-Fraktion zu wenige Taschenrechner verteilt wurden.
Ebenfalls strebt die CDU-Fraktion an, an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen des Landkreises teilzunehmen und fordert eine Präsenz von Vertretern der Fraktionen, um den wichtigen Austausch zwischen den Mitgliedern des Kreistages, den Ämtern und Gemeinden sowie den Bürgern vor Ort zu gewährleisten. Na ja, hier hat jemand große Angst vor dem Verlust seines Images und nutzt Termine schon seit fünf Jahren nicht mehr. Diese Forderung ist ein reines Wahlkampfgetöse einer Fraktion, die mehr Aufmerksamkeit verlangt!
Ach ja, und zum Schluss will die CDU-Fraktion Geld für die Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs haben. Einmal 8.000 €, dann noch einmal 3.800 € als Sockelbetrag + ca. 4.000 € Personalkosten für den Fraktionsgeschäftsführer + Büroausstattung und Reisekosten des Fraktionsvorsitzenden. (insgesamt schätzungsweise 20.000 €).
Vielleicht könnte man das Geld auch für die Erstellung eines eigenen Konzepts der CDU-Fraktion zur gemeinnützigen Beschäftigung von Asylsuchenden verwenden?
Kommentar/Resümee-die Redaktion!
„Ludi incipiant“ Lasst die Spiele beginnen!
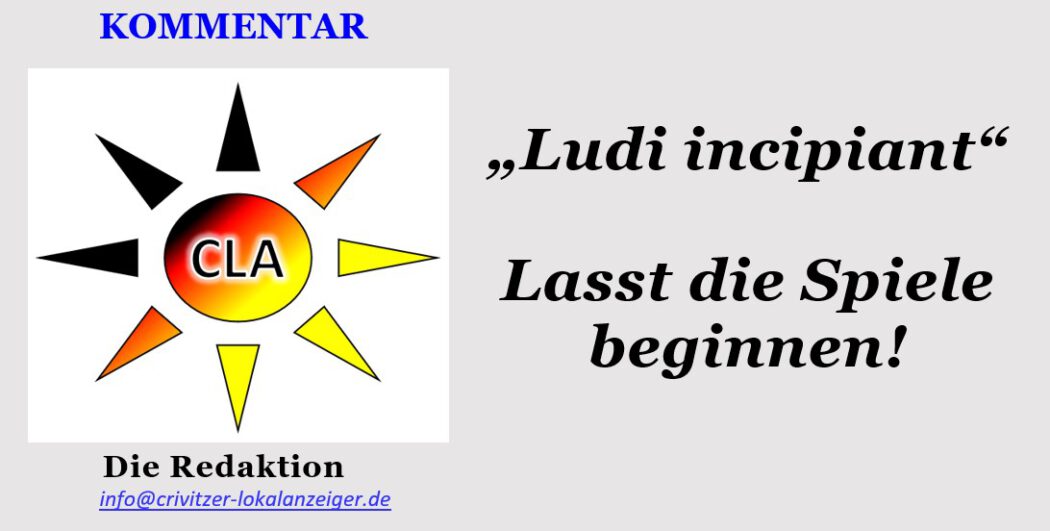
Die Fraktion BSW-FH (Bündnis Sahra Wagenknecht – FREiER HORIZONT), hat viele Forderungen für den Anfang und wie das alles vom Steuerzahler finanziert werden soll, diese Antworten bleibt die Fraktion leider schuldig. So heißt dazu lediglich lapidar: „Einsparungen können ausgearbeitet werden.“ Wie weit weg muss man von der Realität sein und im Überbau wandeln, wenn man bislang nicht einmal die eigenen Beschlüsse des Landkreises und des Haushalts kennt? Es darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde Demen bereits einen Schulkostenbeitrag für Kinder mit nicht deutscher Herkunftssprache aus Demen von jährlich 2.613,27 € pro Schüler an das Amt Crivitz zahlt.
Es ist anzunehmen, dass in dieser Fraktion bereits der Bundestagswahlkampf begonnen hat, jedoch ist es notwendig, zuerst die thematischen Schwerpunkte des Kreisentwicklungskonzepts 2030 zu verstehen und zu verinnerlichen. Möglicherweise ist es dem BSW auch möglich, mit seinen Millionenspenden aus MV zu helfen, aber dieses Mal nicht an die Parteizentrale ins Saarland, sondern direkt an den Landkreis LUP, um die selbst gestellten Forderungen auch finanziell umzusetzen?
Die CDU-Faktion im Landkreis LUP handelt bei diesen Themen ganz anders, sie setzt wie immer auf große Szenarien bei den Kreistagssitzungen, da diese letztendlich publikumswirksam live an das Wahlvolk übertragen werden. Seit den letzten 24 Monaten ist das Marketing von polarisierenden Themen immer mehr in den Vordergrund getreten, wie man es vom wiedergewählten Fraktionsvorsitzenden Cristian Geier seit Langem gewohnt war, seitdem er den Einzug in den Landtag 2021 schmerzlich verpasste.
So scheint sich bei den polarisierenden Anträgen um einen vorgezogenen parteiübergreifenden Wahlkampf für die Landratswahl im Mai 2025 zu handeln. Indem das große Dilemma über den Haushalt 2025 ausbleibt (aufgrund eines Doppelhaushaltes von 24/25), und so werden die unangenehmen Angelegenheiten, wie die Erhöhung der Kreisumlage ab 2026, erst den neuen Landrat 2026 betreffen.
Wie heißt es doch so schön: Die Flut kommt nach mir!

23.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./422[163(38-22)]/CLA-258/97-2024
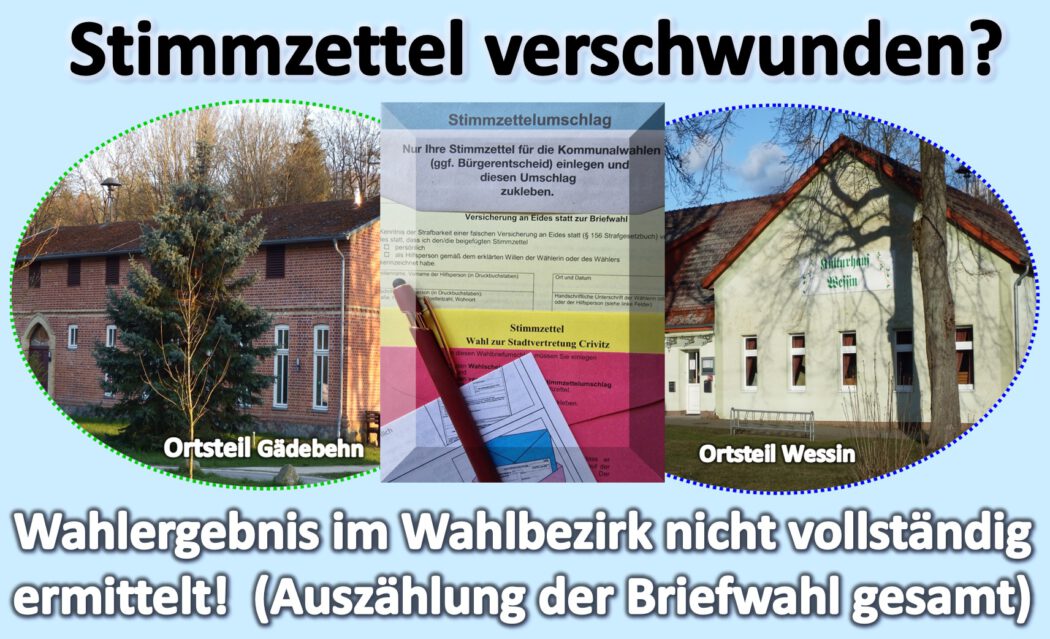
Es ist aber Realität und ein Skandal nach der Wahl!
Nach der neuen Kommunalverfassung ist es möglich, die Zuteilung und Benennung der Sitze für den Ortsteil (Wessin und Gädebehn) abweichend von dem Gesamtergebnis der Kommunalwahl in Crivitz nach den Ergebnissen in den Ortsteilen vorzunehmen. Die Wähler in den Ortsteilen Wessin und Gädebehn haben sich am 09.06.2024 in der Wahl entschieden und sollten nach diesen Ergebnissen auch ihre Ortsteilvertretungen besetzen, um das Ergebnis der Wahlen widerzuspiegeln.
Daher ist es wichtig, zuerst das Ergebnis der Wahl in den einzelnen Ortsteilen zu ermitteln, da es möglicherweise vom Gesamtergebnis abweichen kann. Selbstverständlich spiegelt es das lokale Wahlergebnis wider und erlaubt es, es realistischer darzustellen. Die Datenermittlung für die Stadt Crivitz und die Ortsteile ist eigentlich im 21. Jahrhundert im Jahr 2024 problemlos möglich, da diese in der Wahlleitung bzw. in der Wahlkommission ordentlich aufbewahrt wurden. Nachdem die Ergebnisse der Wahlen ermittelt wurden, werden die einzelnen Sitze in den Ortsteilen verteilt und es entsteht ein realistisches Bild der Ortsteilvertretung.
Jetzt kommt aber der Knall! Etwa 14 Wochen nach dem Wahl-Ergebnis in Crivitz!
So hat die Rechtsaufsichtsbehörde LUP festgestellt: Es ist nicht möglich, das Ergebnis der letzten Kommunalwahl als Grundlage für die Zuteilung der Sitze in der Ortsteilvertretung zu verwenden, da es nicht vollständig im jeweiligen Wahlbezirk ermittelt wurde (Auszählung der Briefwahl gesamt).
Die Tatsache, dass das Wahlergebnis im Wahlbezirk nicht vollständig ermittelt wurde, ist ein Skandal oder eine Nachlässigkeit? Eigentlich sollte man als Wähler erwarten, dass sämtliche Wahlunterlagen vorhanden sind und gut aufbewahrt werden! Wozu geben eigentlich die Briefwähler eine eidesstattliche Erklärung ab, wenn diese Ergebnisse hinterher nicht vollständig sind?
Die Frage ist: Sollen alle so geräuschlos weitermachen? Dann muss man sich einfach damit abfinden! Oder sollte man nicht hier einmal eine gründliche Untersuchung durchführen und klare Verantwortlichkeiten benennen für diese Vorgänge?
Der Fraktionschef der CWG-Crivitz, Herr Andreas Rüß, wittert bereits Morgenluft und verlangt sofortige Neuwahlen in den Ortsteilen (Wessin und Gädebehn). Die Ortsteilvertretungen sollen nun noch einmal von den Bürgern der Ortsteile gewählt werden, gemäß den Bestimmungen des Landes- und Kommunalwahlgesetzes. Daraus ergibt sich dann auch ein neuer Wahlkampf für die Ortsteile und eine lange Vorbereitungszeit. Falls es nicht genügend Kandidaten gibt oder diese nicht gewählt werden, besteht die Möglichkeit, Ergänzungswahlen durchzuführen, um die Mindestzahl der Mitglieder für die Ortsteilvertretungen zu erreichen. Zusätzlich verzögert sich der Prozess zur Konstituierung und Herstellung von Ortsteilvertretungen etwa bis März 2025.
Gleichzeitig fordert die CWG-Fraktion, dass die Informations-, Vorschlags- und Anhörungsrechte der Ortsteile gegenüber der Stadtvertretung deutlich eingeschränkt werden und das Recht zur Stellungnahme aus den Ortsteilen vollständig entfällt. Sind diese Maßnahmen jetzt der Stein der Weisen? Ist das wirklich der eigentliche Wählerwille und dient das wirklich dem Gemeinwohl?
Kommentar – Resümee der Redaktion
Nach der Wahl ist vor der Wahl? Solange wählen, bis es passt!
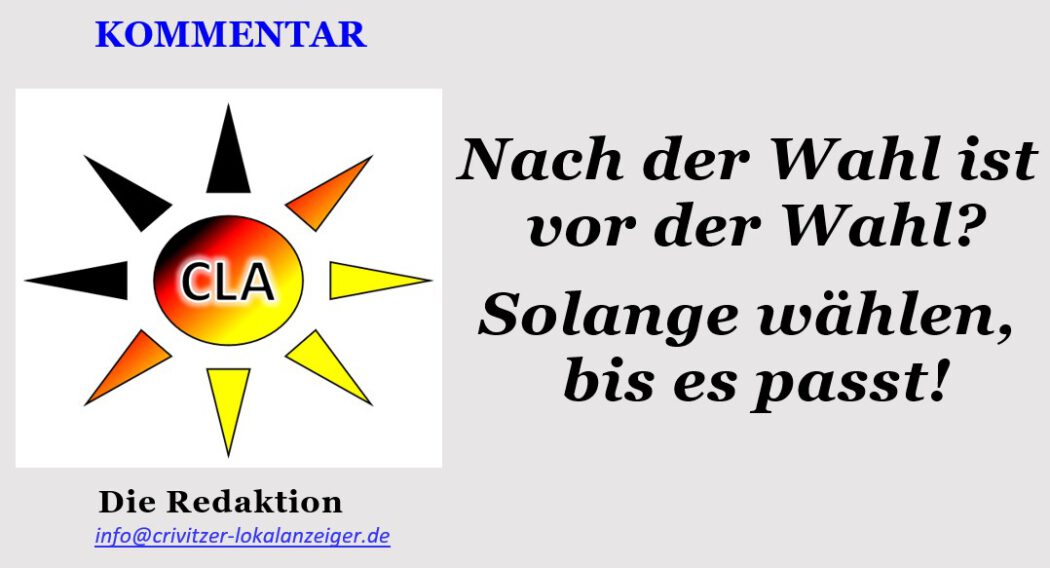
Der Wählerwille wird erneut auf die Probe gestellt sowie seine Geduld und die Glaubwürdigkeit in der Politik eingefordert.
Seit Anfang des Jahres wurde über die neue Modernisierung der Kommunalverfassung im Land diskutiert und beschlossen. Also gab es genügend Zeit, sich im Amt Crivitz und den Wahlvorständen vorzubereiten auf die unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten zu den Ortsteilvertretungen nach den Ergebnissen. Daher war auch gewissenhafte Sorgfalt bei der Auszählung nicht nur geboten, sondern auch gefordert! Dennoch ist es dem Amt Crivitz nicht möglich, alle Ergebnisse der Briefwahl im Wahlbezirk Crivitz zu ermitteln.
Wie hat man denn hier die Stimmzettel ausgezählt? Wurden dort etwa alle Stimmzettel in einen Haufen geworfen, der keine Unterscheidung mehr zwischen Direkt- und Briefwahl ermöglichte? Diese oder ähnliche Fragen müssen erst einmal für die Öffentlichkeit beantwortet werden.
Bevor man beantragt, dass die Rechte der künftigen Ortsteilvertretungen einzuschränken, so wie es die CWG-Fraktion vorbereitet hat. Grundsätzlich gilt für die Ortsteilvertretungen Wessin und Gädebehn, die sich vor Jahren freiwillig an die Stadt Crivitz angeschlossen haben, dass ihre Rechte nicht eingeschränkt werden sollten, sondern im Gegenteil ausgeweitet werden sollten.
Die Bürger in den Ortsteilvertretungen tragen schließlich die Belastungen für alle Wind- und Solarprojekte, die sich die CWG-Stadtspitze ausgedacht hat und in Zukunft bauen möchte, um sich dadurch einen finanziellen Vorteil für den Stadthaushalt zu verschaffen.

21.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./421[163(38-22)]/CLA-257/96-2024

Der Chef der CWG-Fraktion, Herr Andreas Rüß, will direkte Neuwahlen für die Ortsteile und die Informations- und Vorschlagrechte aus den Gebietsänderungsvereinbarungen für die Ortsteile unmissverständlich abschaffen, in einer Hauptsatzungsänderung. Laut seiner Ansicht soll das Anhörungsrecht und das Recht zur Stellungnahme aus den Ortsteilen vollständig entfallen. Alles, das wird erst nach der Wahl veröffentlicht? Warum wohl?
Die Modernisierung des Kommunalverfassungsrechts KV M-V seit Juni 2024 eröffnet neue Chancen bei der Wahl der Ortsteilvertretungen:
-1- Die Zuteilung und Benennung der Sitze für die Ortsteile (Wessin und Gädebehn) nach der neuen Kommunalverfassung ist nach den gesamten Wahlergebnissen von Crivitz möglich. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass vorrangig ein Losverfahren zur Besetzung der Sitze angewendet werden muss, da zwei Parteien und eine Wählergruppe die gleiche Höchstzahl aufweisen. Angesichts dessen birgt dieses Verfahren auch eine Reihe von Problemen bei der Verteilung der Sitze. Es ist und bleibt jedoch ein Aufdrücken oder Aufzwingen des gesamten Wahlergebnisses von Crivitz auf die beiden Ortsteile, obwohl diese möglicherweise andere Wahlergebnisse oder Wählerwillen widerspiegeln. Dieses Verfahren ist nicht geeignet, den Willen des Wählers in den Ortsteilen zu repräsentieren.
-2- So ist es auch möglich, die Zuteilung und Benennung der Sitze für die Ortsteile (Wessin und Gädebehn) abweichend von dem Gesamtergebnis der Kommunalwahl in Crivitz nur nach den Ergebnissen der Wahlen in den Ortsteilen vorzunehmen. (KV M-V § 32a Absatz 2 Satz 1). Die Wähler in den Ortsteilen Wessin und Gädebehn haben sich am 09.06.2024 in der Kommunalwahl entschieden und sollten nach diesen Ergebnissen auch die Besetzung ihrer Ortsteilvertretungen in den Ortsteilen von Crivitz vornehmen, um das Ergebnis der Wahl widerzuspiegeln.
Folglich ist es notwendig, zunächst das Ergebnis der Wahl in den einzelnen Ortsteilen zu ermitteln, da dieses möglicherweise vom Gesamtergebnis abweichen kann. Natürlich spiegelt es das lokale Wahlergebnis wider und lässt sich realistischer darstellen. Die Datenermittlung für die Stadt Crivitz und Ortsteile ist eigentlich kein Problem, da diese in der Wahlleitung bzw. in der Wahlkommission ordentlich sicher aufbewahrt wurden. Es entstehen natürlich Aufwendungen, um im Amt Crivitz die Wahlergebnisse für die Ortsteile herauszufiltern, diese halten sich allerdings in geringen Grenzen. Nachdem die Wahlergebnisse ermittelt wurden, werden die einzelnen Sitze in den Ortsteilen verteilt und es entsteht ein realistisches Bild für die Ortsteilvertretung.
Dies ist jedoch nicht der Fall, wie das Amt Crivitz festgestellt hat. Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde ist es nicht möglich, das Ergebnis der letzten Kommunalwahl als Grundlage für die Zuteilung der Sitze in der Ortsteilvertretung zu verwenden, da es nicht vollständig im jeweiligen Wahlbezirk ermittelt wurde. (Auszählung der Briefwahl gesamt).
Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen; das Wahlergebnis wurde im Wahlbezirk nicht vollständig ermittelt, ein Skandal oder eine Nachlässigkeit? Man kann doch als Wähler eigentlich verlangen, dass alle Wahlunterlagen vorhanden sind und gut aufbewahrt werden! Wozu geben denn eigentlich sonst die Briefwahlwähler eine eidesstattliche Erklärung ab für die Abgabe ihrer Stimme, wenn diese Ergebnisse hinterher nicht vollständig sind?
Die CWG – Crivitz beabsichtigt nun unmittelbar mit aller Kraft folgende Variante durchzusetzen:
-3- die Mitglieder der Ortsteilvertretung direkt von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile wählen zu lassen, gemäß den Bestimmungen des Landes- und Kommunalwahlgesetzes.
Also eine erneute Neuwahl nur für Ortsteilvertreter. Natürlich stellen direkte Wahlmöglichkeiten einen wesentlichen Bestandteil unserer parlamentarischen Demokratie dar und sollten grundsätzlich gefördert werden. Allerdings erfordert diese Option umfangreiche Vorbereitungen und eine gewisse Vorlaufzeit, da die Bürger bisher nicht über die neue Möglichkeit informiert wurden. Daraus ergibt sich dann auch ein neuer Wahlkampf in den Ortsteilen und eine lange Vorbereitungszeit. Es muss daran erinnert werden, dass möglicherweise nicht genügend Kandidaten zur Verfügung stehen oder nicht gewählt werden und dadurch auch Ergänzungswahlen in Betracht kommen, um die Mindestmitgliederzahl für die Ortsteilvertretungen zu erreichen. Auch sind zusätzliche Sitzungen des Wahlausschusses bei eventuellen Widersprüchen notwendig oder Nachwahlen.
Es entstehen auch direkte Kosten, die durch das Vorhandensein eines Wahlausschusses, die Besetzung von Wahllokalen sowie das Drucken von Wahlscheinen und Briefwahlen sowie Sitzungen zur Wahl. Es bleibt fraglich, ob das Amt Crivitz die notwendigen personellen Ressourcen besitzt, um an den Wahltagen alle Wahllokale für die Ortsteile Wessin und Gädebehn zu besetzen. Außerdem verzögert sich der Prozess zur Konstituierung und Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Ortsteilvertretungen bis zum zweiten Quartal 2025.
Die CWG – Crivitz will diesen Prozess der Wahl mit ihrer * Hauptsache: Augen zu und durch Mentalität* erzwingen, um ihre Position in den Ortsteilen zu erweitern und ihr Image zu verbessern. Ebenso sollen die Informations-, Vorschlags- und – Anhörungsrechte der Ortsteile deutlich eingeschränkt werden!
Kommentar – Resümee der Redaktion
„Man kann sich nicht darauf verlassen, daß das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt, und wir müssen damit rechnen, daß das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann.“ Angela Merkel.
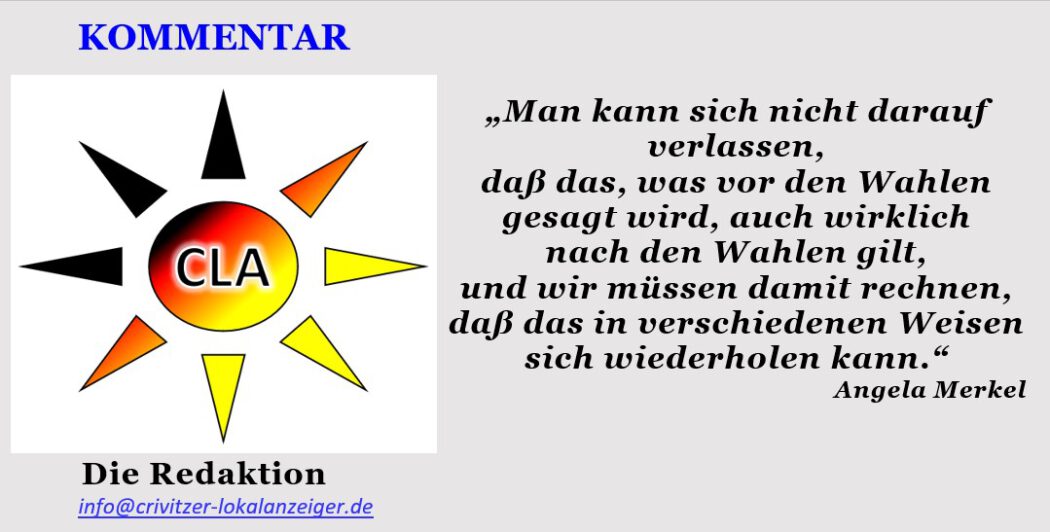
Der Wählerwille wird erneut auf die Probe gestellt sowie seine Geduld und die Glaubwürdigkeit in der Politik eingefordert.
Seit Beginn des Jahres wurde über die neue Modernisierung der Kommunalverfassung im Land diskutiert und beschlossen. Allerdings ist das Amt Crivitz nicht in der Lage, alle Ergebnisse der Briefwahl im Wahlbezirk Crivitz zu ermitteln. Obwohl man seit vier Monaten weiß, dass die Kommunalverfassung für die Ortsteilvertreterwahlen unterschiedliche Möglichkeiten vorsieht, ist man nicht vorbereitet oder leistet solch eine schlechte Leistung bei der Stimmenauszählung sowie Nachweisführung und Prüfung in der Wahlleitung.
Der Amtsausschuss des Amtes Crivitz hat auf seiner Sitzung am 06.12.2023 bereits auf der Grundlage Kommunalwahlgesetz M-V die Wahlleitung des Amtes Crivitz gewählt: Wahlleiterin des Amtes Crivitz: Frau Carmen Krooß. Stellvertreter – der Wahlleiterin des Amtes Crivitz: Herr Rene Witkowski. Alle Wahlvorstände im Amtsbereich Crivitz wurden möglichst mit acht Mitgliedern besetzt (Wahlvorsteher, Stellvertreter, Schriftführer, stellv. Schriftführer und vier Beisitzer). Es wurde von der Verwaltung empfohlen, eine Entschädigung von je 70 € für den Wahlvorsteher und den Schriftführer sowie 50 € für jedes weitere Mitglied der Wahlvorstände zu gewähren. Die Gesamtkosten für alle Wahlvorstände im Amtsbereich lagen bei ca. 18.920 € .
Wie viel Aufwand und Kosten sind für ein solches Ergebnis erforderlich? An dieser Stelle stellt sich die Frage, wo sich die restlichen Briefwahlergebnisse im Wahlbezirk Crivitz nun eigentlich befinden?
Sind sie vielleicht verschwunden?
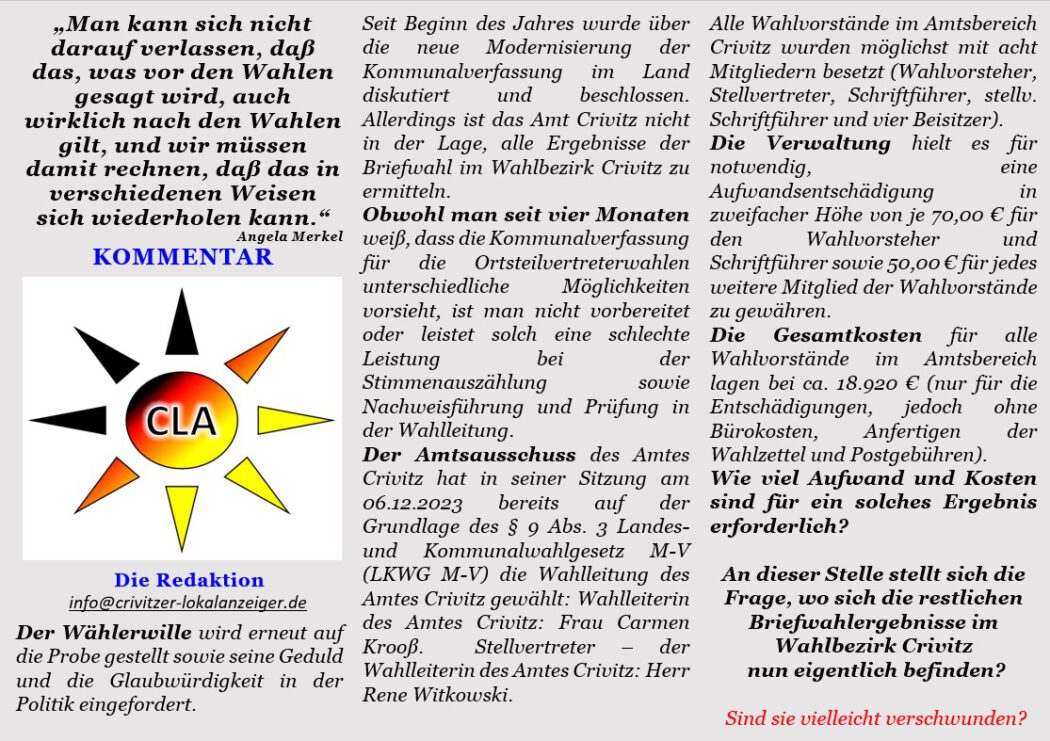
19.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./420[163(38-22)]/CLA-256/95-2024
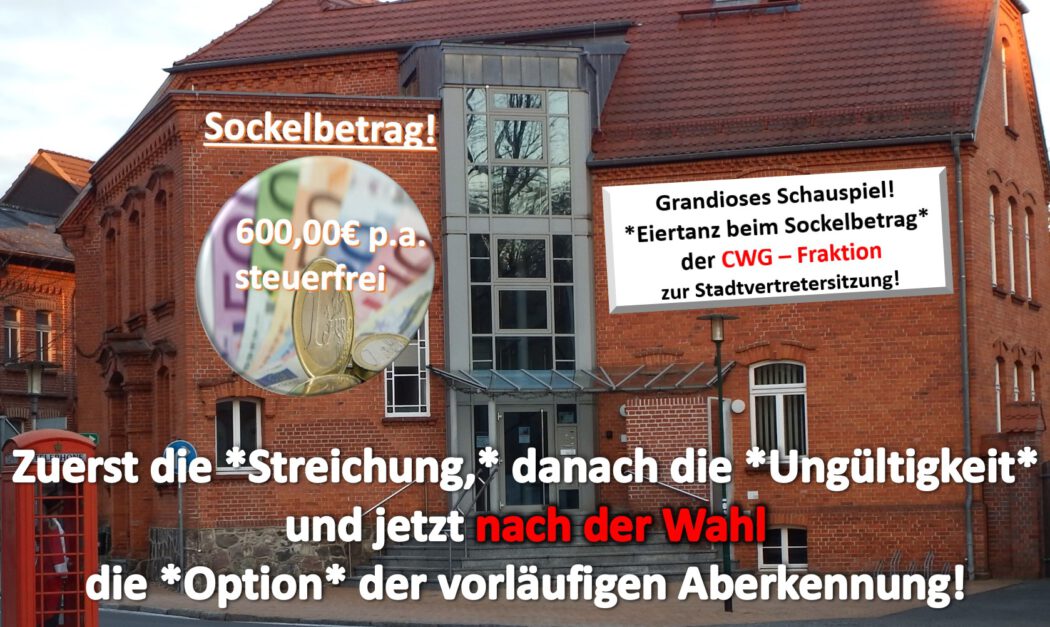
Die derzeitige Hauptsatzung der Stadt Crivitz basiert auf Ignoranz, Naivität und kläglichen Verwaltungsmethoden der CWG Stadtspitze. Ein Ereignis, welches seinesgleichen sucht! Es herrscht ein Kuddelmuddel und Verschleierung in der Änderung und Neufassung der Hauptsatzung für Crivitz bezüglich der Entschädigungen für die Stadtvertreter, welche keine Funktionsträger sind.
Es ist nicht verwunderlich, dass so wenige Bürger an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen und sich immer weniger bereit erklären, an Aktionen teilzunehmen, wenn man solche Ignoranz und Vertrauensverlust sofort nach der Wahl erlebt.
Die CWG Fraktion beantragte im Dez. 2023 als Mehrheitsfraktion in der damaligen Stadtvertretung eine Modifikation der Hauptsatzung, ohne dass diese vorher in den Ausschüssen diskutiert wurde. Vor der endgültigen Abstimmung über die neue Hauptsatzungsänderung zauberte die Bürgermeisterin in Vertretung des Chefs der Fraktion, Herrn Andreas Rüß eine unerwartete Tischvorlage hervor und überraschte alle Anwesenden. Aufgrund eines angeblichen Krankheitsstatus des Chefs der CWG – Fraktion brachte die Bürgermeisterin diese Vorlage nun persönlich in die Sitzung ein und verlas diese augenblicklich. Diese beinhaltete, dass der Sockelbeitrag (pauschale monatliche Entschädigung von 50 €) für die meisten Abgeordneten abgeschafft werden sollte. Die CWG – Crivitz begründete ihre Entscheidung mit einem zu erwartenden Haushaltsdefizit im Jahr 2024 und in den Folgejahren und forderte die Stadtvertreter auf, mit gutem Beispiel voranzugehen bei der Kürzung von Entschädigungen. Das Fatale an dieser neuen Regelung war, dass alle Funktionsträger innerhalb der Stadtvertretung, die ausschließlich aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE/Heine + CWG kamen, davon ausgeschlossen waren. Sie zeigten auch keinerlei Akzeptanz für eine freiwillige Reduzierung ihrer eigenen Entschädigungen, um ebenfalls einen Beitrag zu leisten!
Aufgrund mangelnden Präsenz in der Sitzung (von 12 der ursprünglich 17 Stadtvertreter) wurde diese sogenannte vierte Änderung der Hauptsatzung von den Mehrheitsfraktionen durchgefochten, mit einem Ergebnis von 7 Ja- und 5 Nein-Stimmen.Es wurde jedoch von niemandem der Anwesenden beachtet, dass die Kommunalverfassung M-V für Hauptsatzungsänderungen eigentlich eine Mehrheit der Stadtvertretung forderte, also 9 Ja-Stimmen. Das fiel keinem der Anwesenden auf, wo man doch so häufig selbsterklärte Spezialisten in den eigenen Reihen hatte, die angeblich die Kommunalverfassung kannten oder von ihr gehört hatten. Wie gewohnt fühlte man sich sicher, wenn man seine Beschlüsse durchsetzen konnte.
Die Ungültigkeit der vierten Änderungssatzung wurde sechs Monate lang bis nach der Wahl verschwiegen. Obwohl sie kurzzeitig zwischendurch veröffentlicht wurde, wurde sie sofort wieder zurückgezogen und gelöscht für die Öffentlichkeit, da es natürlich sonst hätte Wählerstimmen kosten können für dieses Unvermögen.
Einige ehemalige Abgeordnete erhielten plötzlich im Juni 2024 den verbleibenden finanziellen Betrag der letzten sechs Monate der Entschädigung, den fehlenden Sockelbetrag. Aber auf der konstituierenden Sitzung am 17.07.2024 wurde er jedoch für die neuen Abgeordneten wieder gestrichen, da niemand ihnen die Vorgeschichte für das Dilemma so richtig erklären konnte.
Es ist eigentlich ein Skandal, aber wie es vor Wahlen üblich ist, wurde alles totgeschwiegen.
Jetzt also ein erneuter Anlauf von Herrn Andreas Rüß nach der Wahl im Juni 2024, selbstverständlich für die Sitzung der Stadtvertretung am 23. 09.2024 mit einer erneuten Kürzung des Sockelbetrages bei einer sogenannten Innaktivität der Stadtvertreter. Nach seinen neuesten Ideen und den Vorschlägen der CWG-Fraktion soll indessen der Sockelbetrag bei Inaktivität rückwirkend oder vorläufig gestrichen werden. Eine vollkommen unlogische Auslegung, die über die Regeln von der Kommunalverfassung hinausgeht und Sanktionen für Stadtvertreter in M-V festlegt. Was für eine Farce man hier der Öffentlichkeit präsentiert, spottet jeder Beschreibung. Abgesehen von der rechtschreib- und formalrechtlichen Beschreibung der Anträge entsprechen sie in keinerlei Hinsicht den Bestimmungen der Kommunalverfassung und der eigenen Geschäftsordnung.
Wenn es um die Inaktivität der Stadtvertreter in den vergangenen fünf Jahren geht, müsste sich die CWG – Fraktion einmal ihre eigene Anwesenheitsliste bei Sitzungen ansehen und würde wahrscheinlich selbst blass werden und sich für diese Argumentation schämen. Es wäre denkbar, dass wir diese einmal veröffentlichen, um das Debakel zu illustrieren.
Und so dürfen wir uns erneut auf ein gigantisches Ereignis zur kommenden Sitzung freuen.
Kommentar – Resümee der Redaktion
Versuch und Irrtum Prinzip: Eine Methode zum Lernen? Bisher hat alles lediglich eine einzige Peinlichkeit!

Es handelt sich hierbei um ein desaströses Dilemma, das die alte und neue CWG – Stadtspitze wissentlich geschaffen haben. Man verschweigt bewusst über sechs Monate gegenüber den Bürgern, dass eine Satzungsänderung ungültig ist.
Einfach mal so, aus einer kurzen Hand beschließen. Es ist symptomatisch für das sporadische unkontrollierte Handeln der letzten fünf Jahre der herrschenden CWG-Fraktion, die stets alles verändern wollte, aufgrund ihrer absoluten Mehrheit. Aber oft wusste man nicht genau, wie es weitergehen sollte. Hauptsache, die Augen zu und durch.
Es ist bedauerlich, dass das Amt Crivitz nicht in der Lage war, die CWG-Stadtspitze in diesem fachlichen Handeln zu unterweisen oder die Transparenz zu fordern. Es ist wahrscheinlich, dass die Kommunalaufsicht LUP diese Unregelmäßigkeiten entdeckt hat und es ist anzunehmen, dass sie erst spät darüber informiert wurde. Erst nach der eigenen Vereidigung wird dann von der CWG – Stadtspitze die aktuelle Lage bekannt gegeben und man ist dann weiterhin nicht einmal in der Lage, eine ordentliche Hauptsatzung zu vollenden.
Seit Jahren ist zu beobachten, dass die CWG-Fraktion und Stadtspitze lieber großflächige Bauprojekte plant und diese mit Vergabeverfahren sowie Festveranstaltungen begleitet, anstatt sich auf Haushalts-, Verwaltungs- und Kommunalangelegenheiten zu konzentrieren.

15.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./419[163(38-22)]/CLA-255/94-2024
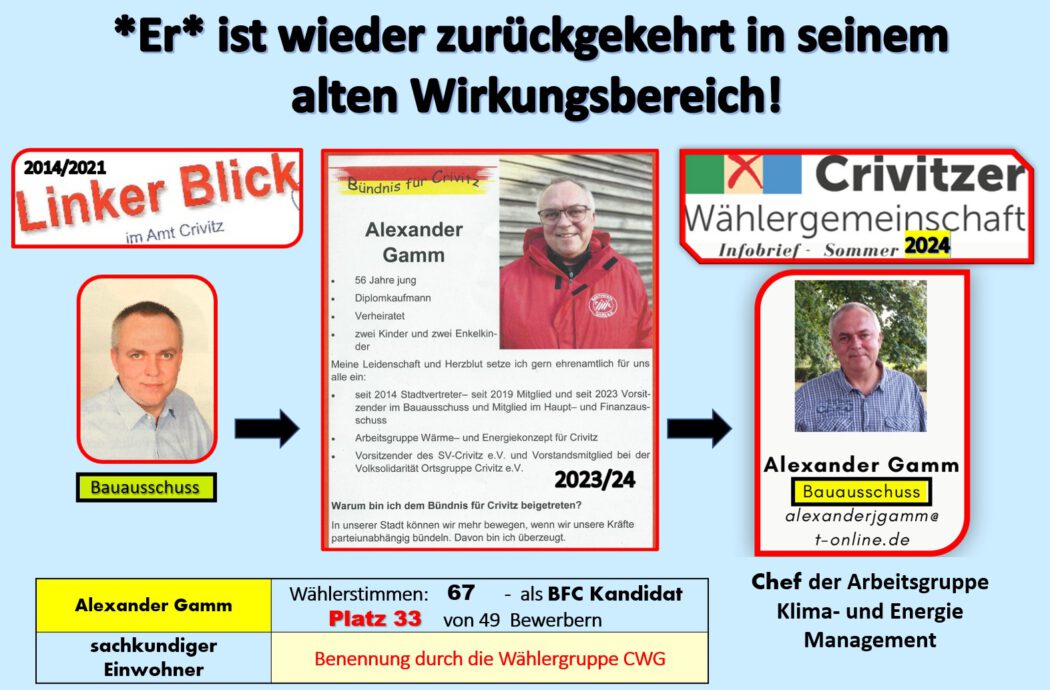
Was für ein Postengeschacher! Erneut dank der Wählergruppe CWG – Crivitz!
Es könnte im Volksmund auch als Vetternwirtschaft oder Familienkult angesehen werden? Die Wählergruppe der CWG schweigt dazu und möchte darüber nicht mehr sprechen. Punkt aus und vorbei! Offiziell heißt es hierzu, man nutze das neue Zuweisungs- und Benennungsverfahren, welches die neue Kommunalverfassung seit Juni 2024 vorsieht.
Wenn also Kandidaten, die bewusst vom Bürger nicht gewählt wurden, wieder in den derzeitigen Ausschüssen mitarbeiten, könnte der Eindruck beim Wähler entstehen, dass die Fraktion dieser Wählergruppe das Wahlergebnis 2024 nicht respektieren will. Somit wurde für die Bewertung der Fach- und Sachkenntnisse des jeweiligen sachkundigen Einwohners allein der Maßstab der Kandidatur für die eigene Wählergruppe angewendet. In diesem Fall handelt es sich jedoch um einen Bewerber aus einer konkurrierenden Wählergruppe, was eine kuriose Situation darstellt. Daher ist es wichtig, eine ausgewogene Balance zwischen Partei- und Wählergruppenfreunden sowie ausgewiesenen externen Fachexperten herzustellen, auch ohne Parteibuch und Wählergruppenmitgliedschaft.
Die Entscheidung, diese sachkundige Personalie für den Bauausschuss so zu benennen, seitens der Wählergruppe der CWG und ob es dazu noch moralisch vertretbar ist, den Wählerwillen in Crivitz so weit zu dehnen, ist kommunalpolitisch schon sehr mutig. Obwohl Herr Alexander Gamm als Bewerber für das Bündnis für Crivitz zur Wahl antrat und kläglich scheiterte, wurde er auch nicht benannt und nominiert als sachkundiger Einwohner vom Bündnis BFC in den Bauausschuss. Warum wohl nicht?
Einerseits waren zum damaligen Zeitpunkt scheinbar schon die Freundschaftsbande durchschnitten, mit dem Bündnis für Crivitz und Zerwürfnisse hörbar gewesen, andererseits war jedoch die Meldung der Kandidaten an die Wahlkommission bereits vollzogen worden. Also musste man gezwungenermaßen durch die Wahl kommen, um keine Stimmenverluste zu erleiden und sich anschließend komplett von alten Lasten zu trennen.
Folglich musste also erneut die Ehefrau helfen, damit der Haussegen nicht schief hängt. Daher hatte sie nun die große Aufgabe, ihre eigene Wählergruppe CWG – Crivitz davon zu überzeugen, dass diese ihren eigenen Ehemann in den Bauausschuss nominiert.Ganz so einfach war das bestimmt nicht für die Ehefrau, denn wer Herr Alexander Gamm kennt, mit seinen unkontrollierten verbalen kommunikativen öffentlichen Ausbrüchen, der weiß, wovon wir hier sprechen.
Die Wählergruppe CWG – Crivitz hat sich mit der Personalentscheidung, Herrn Alexander Gamm in den Bauausschuss zu berufen, keinen angemessenen Gefallen getan, um ihr Image zu verbessern. Natürlich, solange es keine unkontrollierten Ausbrüche von der Personalie gibt, aber die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre zeigt das Gegenteil. Dies wird voraussichtlich nur einige Wochen in Anspruch nehmen.
Herr Alexander Gamm (auch als Paul Hermann in Facebook unterwegs) wird sicherlich keine eigene Karriere im Bauausschuss mehr machen wollen. Da der Ausschuss in den kommenden Jahren keine einfachen Lösungen für Wind-, Solar-, Biogas-, Wärme- und Infrastrukturprojekte mehr präsentieren kann, wird die Stimmung im Gremium nicht mehr so fröhlich werden. Hinzu kommen noch Finanzierungsprobleme, die durch viele geplante Investitionen entstehen. Stattdessen wird Herr Gamm vielmehr in seiner eigenen Arbeitsgruppe für Klimaschutz und Energiemanagement als Vorreiter sich engagieren.
Das zeigte sich bereits auf der letzten Bauausschusssitzung am 10.09.2024, in der das Thema des Letter of Intent (LoI)-Absichtserklärung aus der Arbeitsgruppe für Klimaschutz und Energiemanagement zur Diskussion stand, selbstverständlich im nicht öffentlichen Teil. In Zukunft wird er voraussichtlich dort in der Arbeitsgruppe die Verantwortung für die Überwachung und Steuerung der vielen Transaktionsprozesse übernehmen.
Es handelt sich hierbei um umfangreiche Projekte und Beschlüsse, in denen auch neue Gremien wie Aufsichtsräte und neue Jobs entstehen können, die zudem vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bieten, bis man in Rente geht.
Die Politik der CWG – Crivitz hat bereits jetzt schon ihre Glaubwürdigkeit verloren, deshalb sind auch weitere Dankesflyer nach der Wahl nicht mehr hilfreich!
Kommentar/Resümee – der Redaktion
„Die Wirklichkeit eines anderen Menschen liegt nicht darin, was er dir offenbart, sondern in dem, was er dir nicht offenbaren kann. Wenn du ihn daher verstehen willst, höre nicht auf das, was er sagt, sondern vielmehr auf das, was er verschweigt.“ (Khalil Gibran)
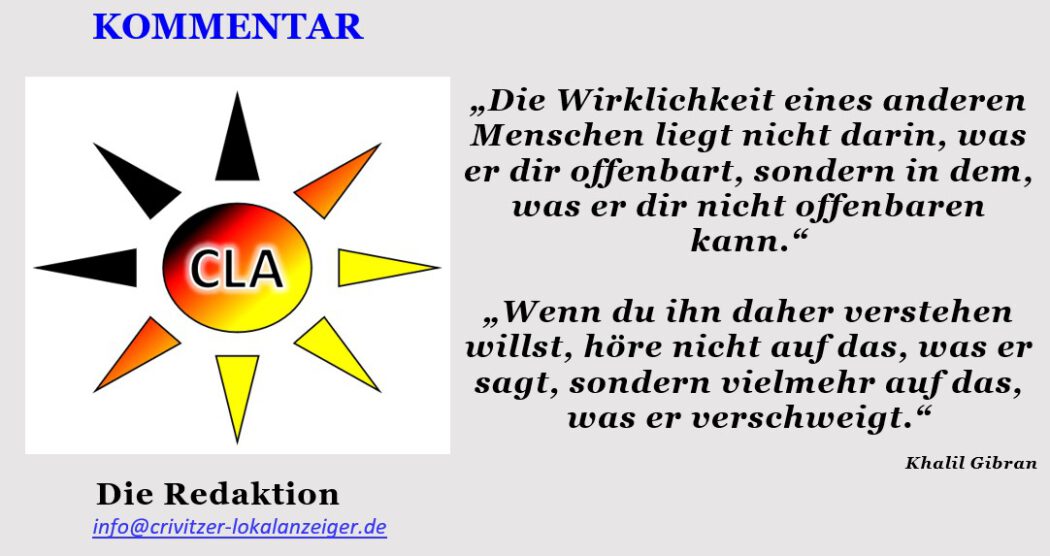
Als Bauausschussvorsitzender wurde Herr Michael Renker gewählt in der Konstituierung am 10.09.2024 (Nachgerückter – Stadtvertreter -gesetzt von CWG-Wählerstimmen: 114 / Platz 24 von 49 Bewerbern). In der vergangenen Wahlperiode war er als 1. Stellvertretender Bürgermeister tätig. Im Bauausschuss ist er kein Unbekannter, denn er war bereits vor ca. 30 Jahren (damals als CDU-Stadtvertreter) auch an der Umgestaltung des heutigen Marktplatzes (Höherlegung – mit den jetzigen Stufen und Baumgestaltung) beteiligt. Es ist zu erwarten, dass er die Umgestaltung nach den Vorstellungen der CWG-Fraktion sicherlich mit Freude wieder rückgängig machen wird.
Sein erster Stellvertreter ist Henryk Krüger (sachkundiger Einwohner-Benennung von CDU; Wählerstimmen: 126 / Platz 22 von 49 Bewerbern), auch er war schon in der letzten Wahlperiode im Bauausschuss, wenn er denn mal Zeit hatte. Seine Priorität seit 2021 galt der zweiten Feuerwehrausfahrt im Gewerbegebiet; alle anderen Themen blieben leider unbeachtet.
Herrn Alexander Gamm fiel es offensichtlich persönlich schwer, in der ersten Bauausschusssitzung am 10. 09.2024, von dem in der letzten Wahlperiode erworbenen und errungenen Amt als Vorsitzender und der damit verbundenen Aura eine persönliche Zurückhaltung bei den Debatten zu demonstrieren.
Allerdings ist es ihm jetzt scheinbar nicht mehr wichtig, Macht zu erlangen, sondern vielmehr an den nicht öffentlichen Sitzungen und Beschlüssen des Bauausschusses teilzunehmen, um dort einen direkten Einfluss ausüben zu können.
Die Hintergrundsteuerung ist die entscheidende Lösung für sein neues Profil.

12.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./418[163(38-22)]/CLA-254/93-2024
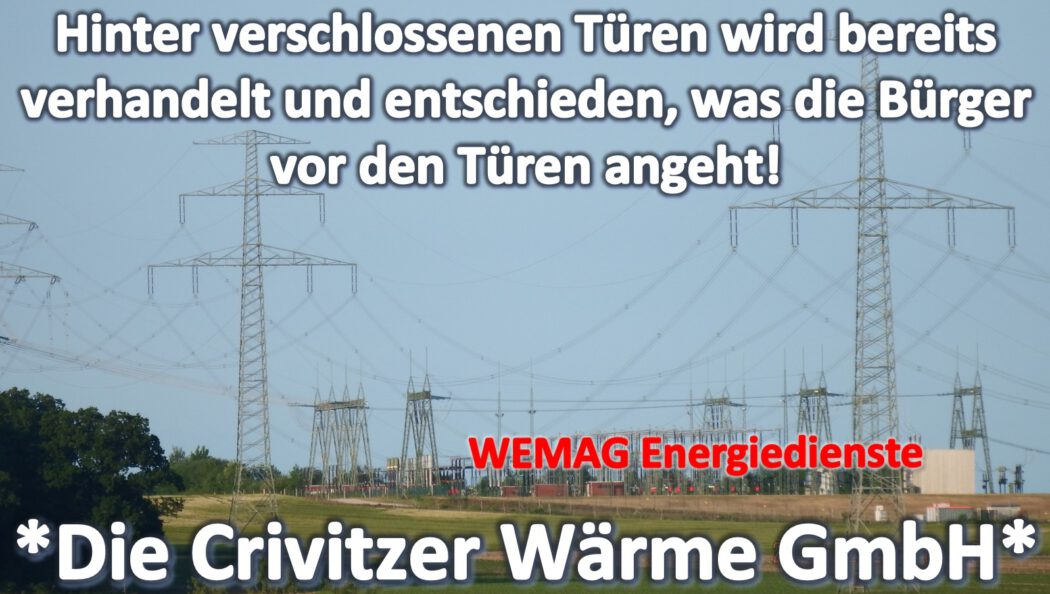
Die Crivitzer Wählergruppe *CWG* und ihre Funktionsträger haben das Ziel, eine „Absichtserklärung“ über die Eckpunkte von Transaktionsprozessen für das gesamte Stadtgebiet mit einer Tochtergesellschaft der WEMAG ohne Bürgerbeteiligung, Einwohnerversammlung und öffentliche Ausschusssitzungen innerhalb von 13 Tagen zu verabschieden. „Ein erster Schritt ist die Machbarkeitsstudie“ (Britta Brusch Gamm – Sitzung am 12.12.2022). Im September 2024 wird nun der dritte Schritt bereits vor dem ersten gemacht und eine Machbarkeitsstudie wird abgesagt.
In einer geheimen Debatte im Bauausschuss am 10.09.2024 wurden bereits die Eckpunkte der Transaktionen für das gesamte Stadtgebiet mit einer Tochtergesellschaft der WEMAG diskutiert. Es ist angeblich vorgesehen, dass die Stadtvertretung nur 13 Tage später ebenfalls sicherlich in einer geheimen Debatte und Abstimmung ein *Letter of Intent (LoI)* – Absichtserklärung – ratifizieren wird. Es bestätigt eindeutig, dass beide Seiten in Verhandlungen über einen Vertragsabschluss stehen. Häufig bildet der Letter of Intent auch die Grundlage eines anschließenden unverzüglichen Vertragsabschlusses.
Es handelt sich eindeutig um ein Dokument aus der geheimen Arbeitsgruppe Klima- und Energiemanagement, in der Herr Alexander Gamm erneut als Vorreiter / Selbsterklärter Experte im Bereich der Energieversorgung durch die Wählergruppe *CWG-Crivitz* positioniert wurde. Denn nirgendwo sonst wurde über dieses Thema so intensiv verhandelt vor der Wahl und nach der Wahl!
Die Handlungen, Absprachen und Tätigkeiten der nicht öffentlichen Arbeitsgemeinschaft Strom und Wärme seit Dezember 2022 (Sprecher – Alexander Gamm und damaliger Fraktionschef die LINKE/Heine und Bauausschussleiter) blieben in Crivitz weitgehend im Verborgenen. Öffentliche Veranstaltungen oder Diskussionen mit den Bürgern der Arbeitsgruppe über das Thema wurden in der Regel peinlichst vermieden, da sonst unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen aufeinandertreffen könnten.
Nur einmal auf einer Stadtvertretersitzung und im Unternehmerforum 2023, wo nur wenige Teilnehmer anwesend waren, wurden die geplanten Projektprozesse von einer gemeinsamen Wärmegesellschaft mit der WEMAG vorgestellt. Es war ganz offensichtlich, dass Herr Alexander Gamm sich für diese Transaktionen und Projekte begeisterte und einbringen würde, obwohl es hierzu nur spärliche und oberflächliche Informationen für die Bürger gab. Inwieweit diese persönliche Einbringung möglicherweise in einen späteren Aufsichtsrat münden oder weitere Posten geschaffen werden, wurden jedenfalls nie angesprochen, aber das wird irgendwann einmal zur Debatte stehen.
So hörte man auf den Veranstaltungen: von der Errichtung großflächiger Solaranlagen in Zapel sowie Windkraftanlagen im Stadtgebiet Crivitz. Es wurde über die Errichtung einer Biogasanlage im Gewerbegebiet gesprochen, die mit Kraftwärmekopplung auch das Vogelviertel und die Neustadt versorgen sollte. Zu diesem Zweck sollten Fernwärmeleitungen errichtet werden, um die öffentlichen Einrichtungen und einige Wohnblöcke in der Neustadt zu versorgen. Bei der Vielzahl der Projekte war zunächst die Insellösung der Wärmeversorgung der öffentlichen Einrichtungen in der Neustadt in Crivitz das Hauptthema. Es scheint, dass diese ganzen Vorstellungen und Projekte in einem Letter of Intent (LoI)-Absichtserklärung zusammengefasst wurden, deren Inhalt allen Bürgern permanent verschwiegen wird.
Es sieht so aus, als ob die WEMAG in den letzten 11 Monaten vor den Bundestagswahlen so viel Druck auf die Crivitzer – Stadtspitze ausübte, dass die Stadtführung sich geradezu davor äußerst fürchtet, den zu erwartenden Geldsegen zu verlieren und keinen anderen mehr zu bekommen. So und nicht anders kann man die heutigen Handlungen nur bezeichnen, wenn sie zwei Monate vor der Bekanntgabe des Haushaltsplans für 2025 stattfinden.
Welche Vorteile haben denn nun die Bürger in den Ortsteilen oder der West- bzw. Nord- und Altstadt in Crivitz durch die gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG? Die Ortsteile haben keine Vorteile, außer dass sie die Belastungen von Solar- und Windprojekten und 110 KV-Trassen zusätzlich ertragen müssen. Die anderen Vorteile für die direkten Stadtteile bleiben wie immer im Verborgenen.
Dem Bürger wird es lediglich gestattet werden, die Kosten für die zu tätigen Investitionen durch weitere zusätzliche Gebühren- und Steuererhöhungen in der Stadt Crivitz in Zukunft zu tragen und die Investitionen in Solar- und Windenergieanlagen durch einen höheren Strompreis zu übernehmen für die nächsten Jahrzehnte.
Kommentar/ Resümee der Redaktion
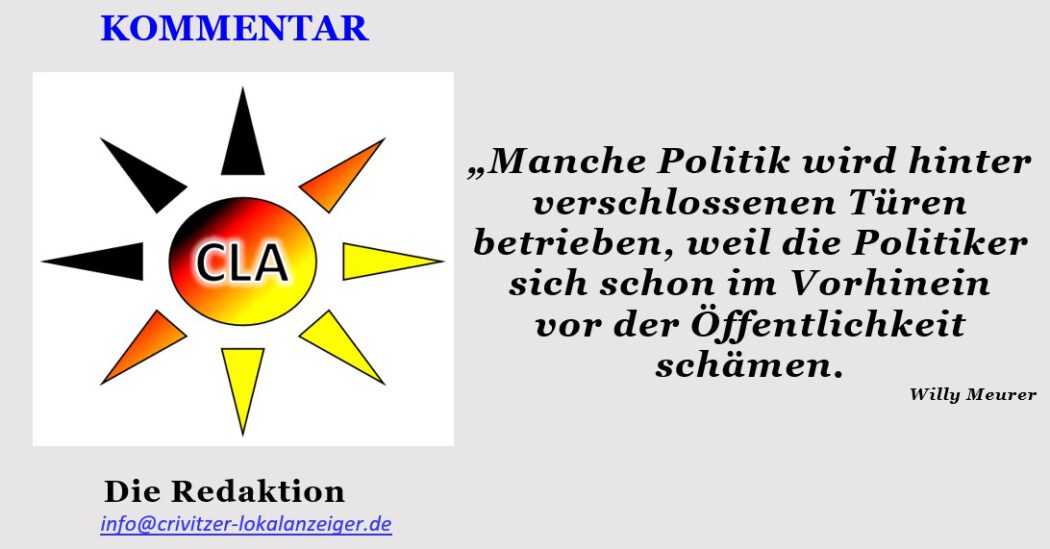
Manche Politik wird hinter verschlossenen Türen betrieben, weil die Politiker sich schon im Vorhinein vor der Öffentlichkeit schämen. Willy Meurer
Von Crivitz aus soll nun das Weltklima reduziert werden.
Wie genau das aussieht, weiß nur die von der Wählergruppe der CWG – Crivitz geführte Arbeitsgemeinschaft Klima und Energiemanagement.
Es ist erstaunlich, wie weit fortgeschritten die datierten Planungen und genauen Absprachen bereits sind und ausgestaltet wurden. Der normale Bürger in Crivitz und in den Ortsteilen wird hierüber nur in pauschalen Halbsätzen informiert, und wenn überhaupt, bleibt alles wie immer in einem streng geschützten, nicht öffentlichen Bereich liegen. Tricksen, Tarnen und Verdecken!
Die geübte Transparenz ist nicht die besondere Stärke der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und ihrer Funktionsträger, sondern vielmehr ein vorrangiges Verstecken hinter § 29 Abs. 5 KV M-V (Durchführung nicht öffentlicher Sitzungen), das hat man wenigstens gelernt und perfektioniert seit Jahren!
Hat man etwa Angst vor anderen alternativen Lösungen und Ansichten?
Oder fürchtet man, in einer Einwohnerversammlung mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden?
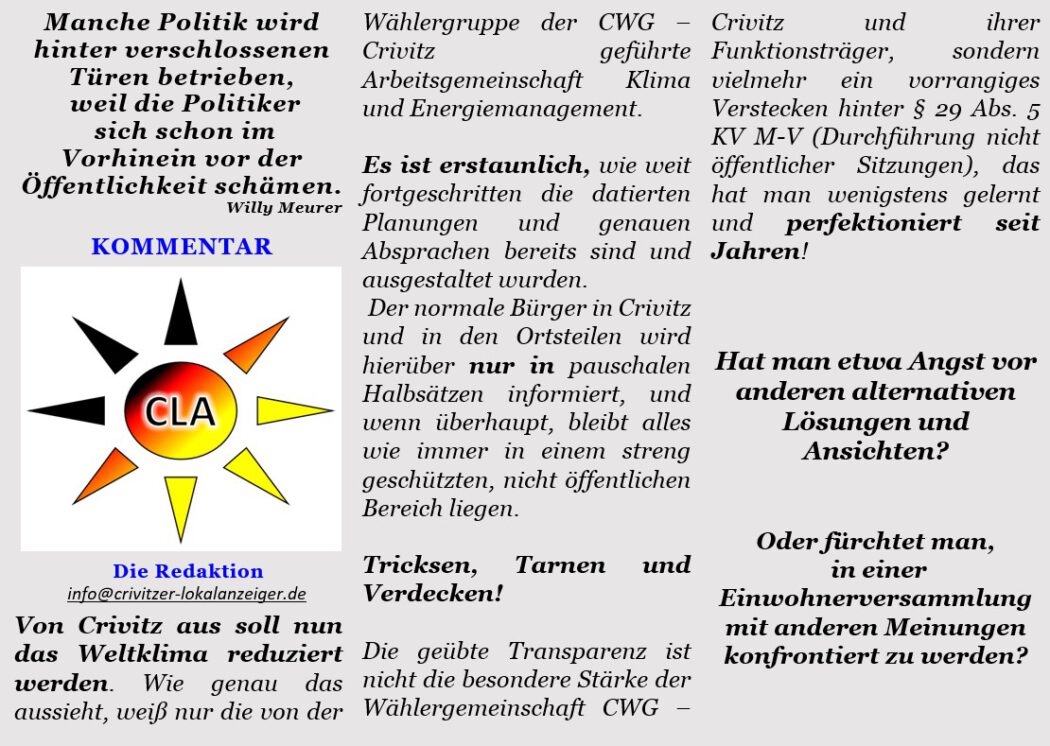
04.Sept.-2024/P-headli.-cont.-red./417[163(38-22)]/CLA-253/92-2024
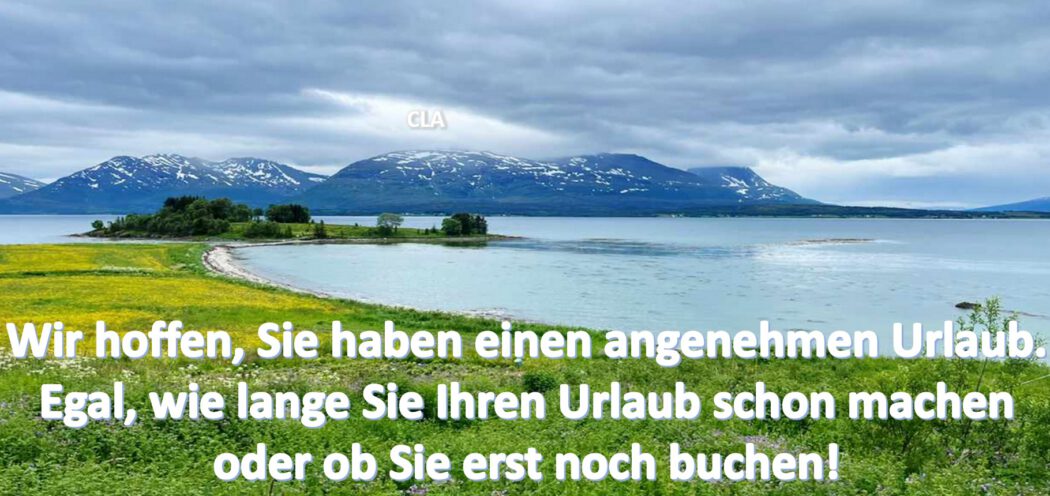
26.August -2024/P-headli.-cont.-red./416[163(38-22)]/CLA-252/91-2024
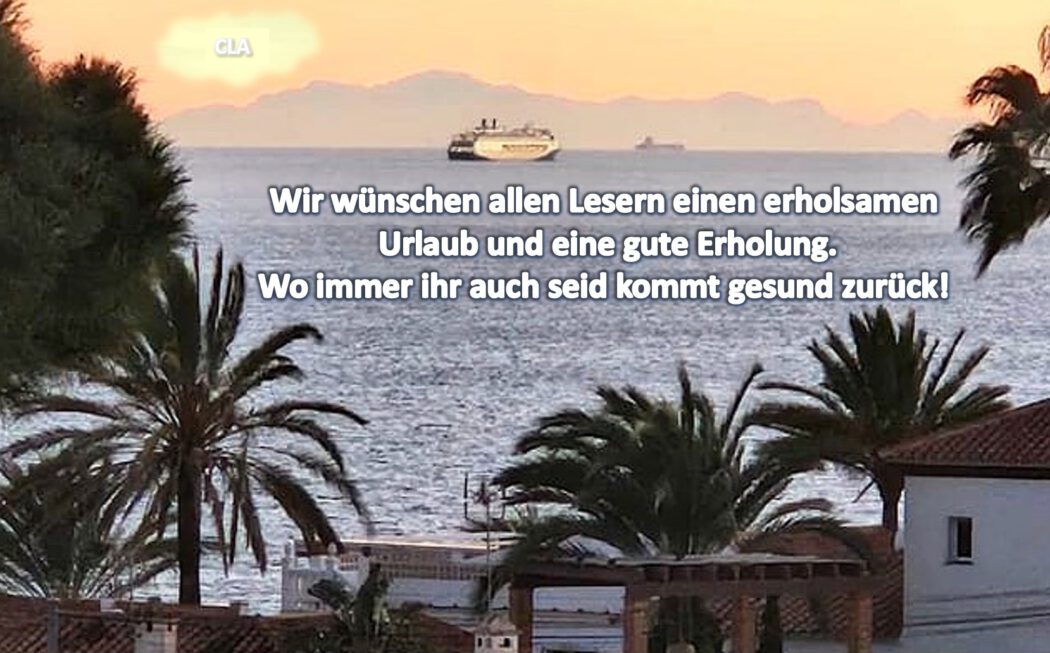
23.August -2024/P-headli.-cont.-red./415[163(38-22)]/CLA-251/90-2024

Die derzeitige Hauptsatzung der Stadt Crivitz basiert auf Ignoranz, Unkenntnis und bemitleidenswerten Verwaltungsmethoden der CWG Stadtspitze. Es ist ein Spektakel, das seinesgleichen sucht! Es herrscht ein völliges Chaos bei der Hauptsatzung in Crivitz bezüglich der Entschädigungen und Befugnisse des SBB und das hat seine Auswirkungen.
Aufgrund der internen Übereinkunft in der Ausarbeitung der neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung von CWG mit CDU und BFC kam es bei der letzten Stadtvertretersitzung zu Unstimmigkeiten, da die AFD-Fraktion nicht in die Ausarbeitungen einbezogen wurde. Die AfD-Fraktion hatte sich daraufhin intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und eigene Vorschläge unterbreitet, die die anderen Fraktionen völlig überforderten. Die CWG Fraktion hatte Schwierigkeiten, dem Ganzen zu folgen, da man selbst nicht im Thema war. Eigentlich sollten die Angelegenheiten fraktionsübergreifend im Nachgang der Sitzung geklärt werden, jedoch der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Hartmut Paulsen und die CWG Fraktion wollten unbedingt eine Satzung beschließen. Allerdings hatte das alles seinen charakteristischen Haken und zeigte das Desaster der CWG Stadtspitze im gesamten Handeln im vergangenen Wahlzyklus. Die CWG-Stadtspitze vertrat die Ansicht, dass die letzte Änderung der Hauptsatzung (4. Änderung) vom Dezember 2023 ungültig ist und daher müsse man sofort eine Satzung beschließen, da sonst keine mehr vorhanden wäre. Eigentlich ist ein Skandal, aber wie es vor der Wahl üblich ist, wurde alles seit sechs Monaten totgeschwiegen.
Was war geschehen!
Die CWG Fraktion beantragte im Dez. 2023 als Mehrheitsfraktion in der damaligen Stadtvertretung eine Änderung der Hauptsatzung, ohne diese zuvor den Ausschüssen diesen breit zu diskutieren. Diese Änderung beinhaltete, dass der Sockelbeitrag (pauschale monatliche Entschädigung von 50,00 €) für die meisten Abgeordneten abgeschafft werden sollte. Das Fatale daran war, dass alle Funktionsträger innerhalb der Stadtvertretung, die ausschließlich aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE/Heine + CWG kamen, davon nicht betroffen waren. Ebenso sollte die Wahlperiode vom SBB nicht die gleiche sein wie die der Stadtvertretung. Sondern extra fünf Jahre. Mit dieser Methode kann man seine engen, handverlesenen Vertrauten effektiv absichern! Diese Regelung würde bedeuten, dass bei der Gültigkeitserklärung der Satzung vor der Kommunalwahl keine Neuwahl des SBB erfolgen muss. Die Bestellung der Mitglieder des SBB erfolgte erst im April 2023 aufgrund einer rechtswidrigen Wahl im Juni 2022. Weiterhin war vorgesehen, dass das Rederecht des SBB auf ein Recht zur auf) Unterbreitung von Fragen, Vorschläge und Anregungen umgewandelt wird. Unklar blieb, ob dies in der Einwohnerfragestunde geschehen soll oder ob es als besonderes Recht allgemein ausgeübt werden sollte.
Aufgrund der Anwesenheit in der Stadtvertretersitzung im Dezember 2023 (von 12 der 17 Stadtvertretern) bestand zwar Beschlussfähigkeit um zwei Änderungen in der 4. Änderung der Hauptsatzung vorzunehmen. In der ersten und auch zweiten Abstimmung zu den Änderungen waren es 7 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen.
So weit, so gut, dachte man. Und so ging man frohen Mutes nach dem vollbrachten Werk in das Wirtshaus zum Seeblick und ließ es sich beim üppigen Weihnachtsessen auf Kosten des Steuerzahlers so richtig gut schmecken. Das neue Jahr 2024 begann und die betroffenen Abgeordneten erhielten auch keinen monatlichen Sockelbetrag mehr. Der SBB feierte sich in allen weiteren Sitzungen, da er erst die nächste Wahl im Juni 2028 hatte und nahm sein Rederecht in den Ausschüssen in Anspruch.
Erst nach der Kommunalwahl aufgrund unseres Artikels am 21.06.2024 zum Seniorenbeirat und einer kurzen Nachfrage bei der Kommunalaufsicht LUP offenbarte sich das ganze Dilemma. Nach sechs Monaten der Beschlussfassung und fast einem Monat nach der Wahl wurde endlich die vierte Änderung der Hauptsatzung (am 04.07.2024 auf der Internetseite des Amtes) plötzlich und unerwartet veröffentlicht. Jedoch nach wenigen Tagen wieder gelöscht wurde. Wohl gemerkt, es war bereits ca. 14 Tage vor der konstituierten Sitzung der neuen Stadtvertretung. Plötzlich erhielten auch einige ehemaligen Abgeordnete den verbleibenden finanziellen Betrag der letzten sechs Monate der Entschädigung (den fehlenden Sockelbetrag).
Was war geschehen?
Es war einfach so: Die Satzungsänderung war ungültig, da sie einen fatalen Fehler enthielt, den man erst im Nachgang bemerkt und über sechs Monate verschwiegen hatte. Daher auch die sofortige Entfernung der Veröffentlichung auf der Internetseite des Amtes Crivitz.
Generell gilt: Laut Kommunalverfassung MV im § 5 Absatz 2, dass Hauptsatzungsänderungen nur von der Stadtvertretung mit der Mehrheit aller Mitglieder beschlossen werden. Sie ist der Rechtsaufsichtsbehörde vor der Ausfertigung anzuzeigen. Aufgrund der Tatsache, dass im Dez. 2023 lediglich 12 von 17 Stadtvertretern der Stadtvertretung anwesend waren und es nur 7 Jastimmen von den Anwesenden für die Hauptsatzungsänderung gab, fehlten schließlich 2 Stimmen für eine Mehrheit (insgesamt 9) der Stadtvertretung und somit war die beschlossene Satzungsänderung nach dem bestehenden Recht ungültig.
Das bedeutet also, dass die Amtsperiode des SBB der Stadtvertretung entspricht und Neuwahlen gemäß der Hauptsatzung durchgeführt werden müssen. Der einzige Ausweg in der derzeitigen Situation besteht wirklich darin, Neuwahlen für den SBB zu organisieren und ihm ein Facelifting zu verpassen für frische Ideen, Kompetenz gepaart mit Durchsetzungsvermögen, das grundsätzlich gemeinwohlorientiert geprägt ist. Damit Barrierefreiheit nicht nur in Zukunft ein Marketingslogan bleibt, sondern auch umgesetzt wird und die Menschen mit Behinderung endlich ein Sprachrohr haben.
Es handelt sich hierbei um ein desaströses Dilemma, das die alte und neue CWG – Stadtspitze wissentlich geschaffen haben.
Man verschweigt bewusst über sechs Monate gegenüber den Bürgern, dass eine Satzungsänderung ungültig ist. Dann wird eine erste Veröffentlichung (einen Monat nach der Wahl) durchgeführt und wieder rückgängig macht. Außerdem spricht man während der Vorbereitung der neuen Stadtvertretung zur Konstituierung nicht mit allen Fraktionen und ist dann verwundert, dass einige Fraktionen bereits vorbereitet sind und Anträge stellen. Erst nach der eigenen Vereidigung wird dann von der CWG – Stadtspitze die aktuellen Geschehnisse bekannt gegeben und man ist dann weiterhin nicht einmal in der Lage, eine ordentliche Hauptsatzung zu vollenden.
Es ist nicht verwunderlich, dass so wenige Bürger an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen und sich immer weniger bereit erklären, an Aktionen teilzunehmen, wenn man solchen Vertrauensverlust sofort nach der Wahl erlebt.
Kommentar – Resümee der Redaktion
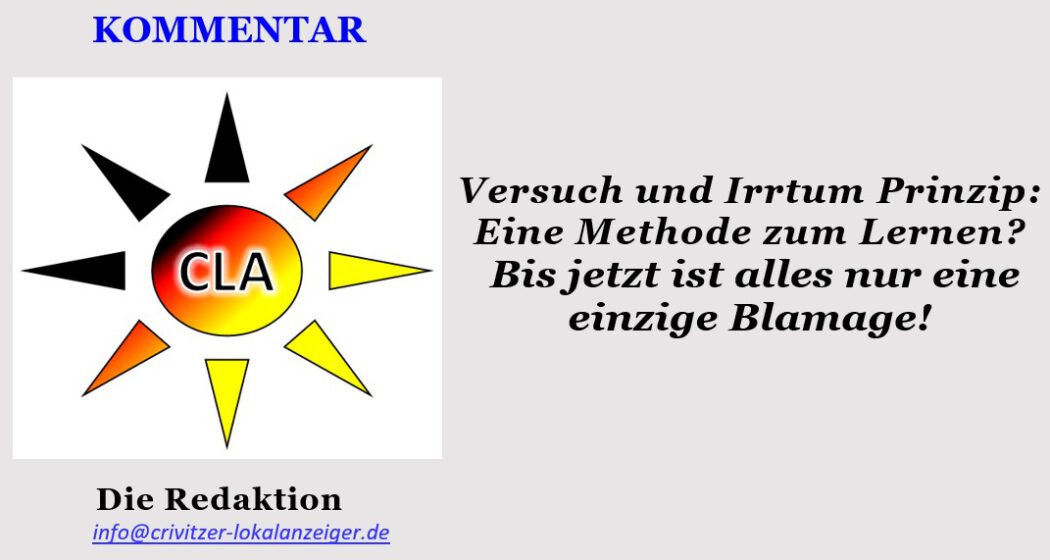
Versuch und Irrtum Prinzip: Eine Methode zum Lernen? Bis jetzt ist alles nur eine einzige Blamage!
Einfach mal so, aus der kurzen Hand beschließen, ohne genaue Analyse. Es ist symptomatisch für das sporadische unkontrollierte Handeln der letzten fünf Jahre der herrschenden CWG-Fraktion, die stets alles verändern wollte, mit Macht aufgrund ihrer absoluten Mehrheit. Doch oft nie wusste, wie es weitergehen sollte. Hauptsache, Augen zu und durch.
Es ist bedauerlich, dass das Amt Crivitz nicht in der Lage war, die CWG-Stadtspitze in diesem fachbezogenen Handeln zu unterweisen die Transparenz zu fordern. Letztlich ist es vermutlich der Kommunalaufsicht LUP zu verdanken, dass diese Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden und sicherlich wurde sie erst verspätet darüber informiert.
Aufgrund der neuen Kommunalverfassung vom Mai 2024 wurden neue Rechte für Beiräte festgelegt, dass auch ein Anspruch auf Sitzungsgeld und Reisekosten für Beiräte besteht. Des Weiteren, dass die Sitzungen der Beiräte öffentlich sein können und die Mitglieder auf die Kommunalverfassung MV verpflichtet werden. Die Mitglieder werden auf das Mitwirkungsverbot, Unvereinbarkeit von Amt und Mandat, Vertretungsverbot und die Verschwiegenheit hingewiesen. Außerdem kann die oder der Vorsitzende des Beirates an den Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse teilnehmen und dass sie oder er in den Angelegenheiten des Beirates ein Rede- und Antragsrecht hat.
Jetzt ist es auch möglich, die finanzielle Budgetausstattung optimaler auf die Bedürfnisse des SBB und deren Veranstaltungen sowie Ausstattungen abzustimmen. Dennoch sind von diesen Angelegenheiten in der Hauptsatzung der Stadt Crivitz 2024 wenig enthalten, obwohl die neue Kommunalverfassung seit dem Januar 2024 öffentlich im Landtag und Städte- und Gemeindetag diskutiert wurde. Die Gemeinden und Städte sind frühzeitig vor der Wahl informiert worden in einer Arbeitshilfe 2024 zu den Hauptsatzungen, auch das Amt Crivitz und der Amtsausschuss.
So ist es wiederum erstaunlich, dass nun der Sockelbeitrag für die meisten Abgeordneten weiterhin gültig ist und entrichtet werden sollte, aufgrund der Nichtigkeit der Hauptsatzungsänderung. Aber auf der konstituierenden Sitzung am 17.07.2024 wurde er jedoch den neuen Abgeordneten wieder gestrichen, da niemand ihnen die Vorgeschichte für das Dilemma so richtig erklärt hatte.
Seit Jahren ist festzustellen, dass die CWG – Fraktion und Stadtspitze lieber großflächige Bauprojekte plant und sich mit der Baubetreuung beschäftigt und Vergabeverfahren sowie Festveranstaltungen durchführt (während gleichzeitig die Finanzausgaben und Schulden im Haushalt exorbitant steigen), anstatt sich in Haushalts-, Verwaltungs- und kommunalrechtlichen Angelegenheiten weiterzubilden.
Nach der Wahl ist vor der Wahl!

21.August -2024/P-headli.-cont.-red./414[163(38-22)]/CLA-250/89-2024
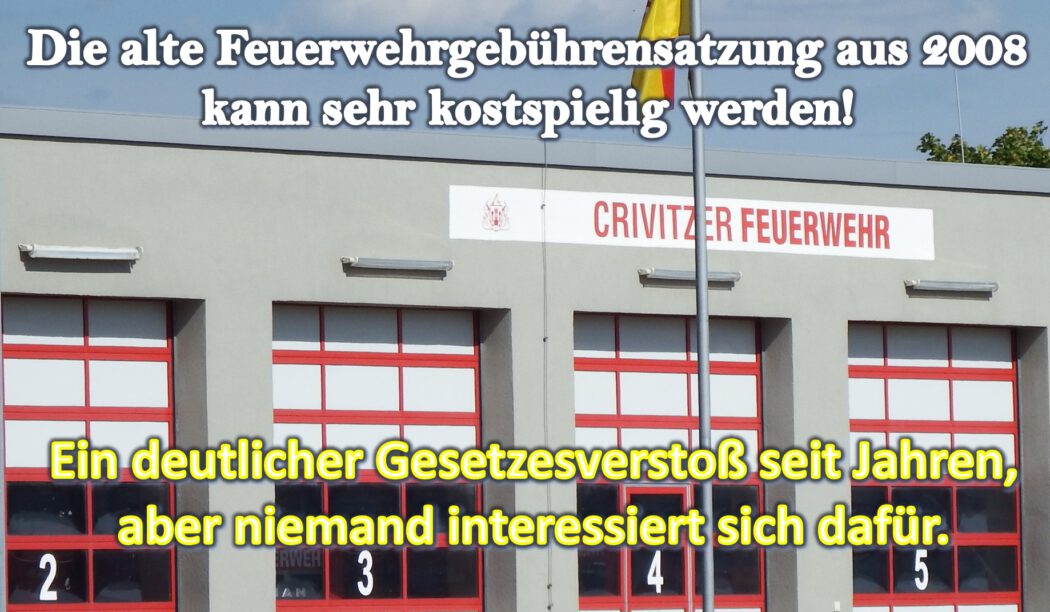
Trotz mehrfacher Appelle/Anträge seit Jahren und Bekräftigung zur Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung blieben scheinbar die *CWG- Stadtspitze*, sowie die Amtswehrführung im Amt Crivitz seit drei Jahren wissentlich untätig!
Demnach dürfen Feuerwehrgebühren gemäß § 2 Abs. 1 KAG/KAG M-V nur aufgrund einer Satzung erhoben werden. Daraus folgt zugleich, dass die als Rechtsgrundlage herangezogene Satzung aktuell wirksam sein muss. In unserem Alltag können Situationen auftreten, in denen wir auf Hilfe von Rettungsdiensten, Feuerwehreinsätzen oder Polizeieinsätzen angewiesen sind. Wer übernimmt eigentlich die Kosten für diese Einsätze? Was passiert, wenn es zu Fehlalarmen oder anderen besonderen Situationen kommt?
Feuerwehr: Wann muss man die Kosten zahlen? Grundsätzlich gilt: Die Einsätze der Feuerwehr sind kostenlos, wenn sie ihre Kernaufgaben erfüllen. Also Löschen von Bränden und die Entschärfung lebensbedrohlicher Lagen für Mensch und Tier. In den jeweiligen Feuerwehr-, Brandschutz- oder Katastrophenschutzgesetzen der Bundesländer ist geregelt, wann die Steuerzahler und die einzelnen Bürger für die Feuerwehr bezahlen.
In den folgenden Fällen fallen Gebühren an: Personen, die im Aufzug feststecken oder Menschen, die sich aus ihrem Haus oder Auto ausgesperrt haben. Ein automatischer Feuermelder, der versehentlich ausgelöst wird. Hier gilt: Wer nicht grob fahrlässig handelt, hat nichts zu fürchten. Wenn der Rauchmelder einen Fehlalarm macht und die Nachbarn die Feuerwehr rufen, müssen alle Beteiligten keine Kosten fürchten. Wenn die Rauchmelder an ein System angeschlossen sind, kann das Geld kosten. Öffentliche Gebäude wie Kindergärten und Schulen sind von dieser Regelung ausgenommen. Sobald Fahrzeuge involviert sind und Schaden oder Gefahr durch den Betrieb eines solchen Fahrzeugs entstehen, können Feuerwehrkosten in Rechnung gestellt werden. Für den Fall, dass jemand eine Ölspur verursacht und die Feuerwehr diese beseitigen muss, wird er zur Kasse gebeten. Jedoch, diese Rechnung muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen.
Die Abrechnung eines kostenpflichtigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr bedarf stets einer rechtssicheren Feuerwehrgebührensatzung. Voraussetzung ist, dass eine aktuelle, korrekte Kalkulation der Feuerwehrgebühren vorliegt. Falls also der Verdacht besteht, dass unverhältnismäßig hohe Kosten berechnet wurden, ist es ratsam, Einspruch einzulegen und im Zweifelsfall einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht hinzuzuziehen. Denn gemäß § 6 KAG M-V Kommunalabgabengesetz – KAG M-V muss die Kalkulation spätestens alle drei Jahre angepasst werden.
Dabei sind zwei Kostengruppen zu unterscheiden: Die einen sind es die Kosten, die unmittelbar Folge konkreter Feuerwehreinsätze sind, also die tatsächlich bei einem konkreten Feuerwehreinsatz angefallenen Personal- und Sachkosten wie Kraftstoffverbrauch, Reinigung, Entsorgung und Ersatz für verbrauchtes Material bzw. beschädigte oder unbrauchbar gewordene Geräte.
Die anderen Kosten sind die Kosten, die unabhängig von konkreten Feuerwehreinsätzen „generell“ anfallen, die folglich als sogenannte Vorhaltekosten für die Sachgüter entstehen und die gleichmäßig das ganze Jahr anfallen, um die öffentliche Einrichtung „Feuerwehr“ vorzuhalten, also z. B. das Feuerwehrgerätehaus. Auch diese Kosten sind für den Zeitraum, in dem kosten erstattungsfähige Einsätze gefahren werden, durch den Einsatz verursacht und damit grundsätzlich erstattungsfähig (vgl. VG Schwerin, Urt. v. 13.08.2009 – 4 A 277/07 –, Stand: August 2011).
Die Feuerwehrsatzung der Stadt Crivitz ist schon 15 Jahre alt. Die technische und personelle Ausstattung der Feuerwehr hat sich seit 2008 deutlich verändert. Mangels ordnungsgemäßer angepasster aktueller Kalkulation enthält sie keine rechtmäßige Festsetzung des Abgabensatzes und kann infolgedessen unwirksam sein. Einsprüche und Widersprüche gegen Rechnungen der Feuerwehr im Amtsbereich Crivitz würden eine perfekte Aussicht auf Erfolg haben, auch bei vielen Verwaltungsgerichten und die Gemeinden müssten die Kosten übernehmen. Ist die Feuerwehrgebührensatzung seit 2008 angepasst und erhöht worden? NEIN? Warum wohl nicht! Ist das Amt Crivitz personell und fachlich nicht in der Lage, diese Aufgabe adäquat zu bewältigen? Vielleicht ist es zu unpopulär für die bestehenden politischen Gemeinschaften und Parteien? Auf jeden Fall ist es ein klarer Gesetzesverstoß!
Der Amtswehrführer des Amtes Crivitz, Markus Eichwitz, weiß diese Tatsache schon seit Jahren. Der bereits seit 2016 im Amt ist und auch einmal 2. Gemeindewehrführer der Stadt Crivitz war und nun sogar 1. Bürgermeister der Stadt Crivitz ist (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 KV -MV Amt und Mandat?) Nicht nur aus vielen Gesprächen ist ihm das Thema bekannt, sondern auch aus Anträgen der CDU-Opposition im Jahre 2021 in der Stadtvertretung zu diesem Thema, die schon damals eine dringende Überarbeitung gefordert und auf die Gefahren hingewiesen haben.
Aufgrund von Herrn Hans – Jürgen Heine (damals zweiter Bürgermeister) wurde jegliche Diskussion darüber abgebrochen und der Antrag von der Fraktion DIE LINKE/Heine und der CWG-Fraktion abgelehnt, mit der Begründung von der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm: „Sie teilt mit, dass alle diesbezüglichen Satzungen im Amt Crivitz bereits in naher Zukunft überarbeitet werden und von Amts wegen eine Zuarbeit erfolgen wird.“ (August 2021). Seit dieser Zeit ist nichts geschehen, aber auch gar nichts. Tatsächlich hat sich die Lage im Amtsbereich der Satzungen seit dieser Zeit verschlechtert.
Demnach haben von den 17 Gemeinden im Amtsbereich Crivitz also zehn Kommunen eine alte Feuerwehrgebührensatzung aus dem Jahr 2005 (Barnin, Cambs, Bülow, Dobin am See, Gneven, Langen Brütz, Leezen, Pinnow, Raben – Steinfeld und Zapel. Eine aus dem Jahr 2006 (Sukow) und eine aus dem Jahr 2007 (Plate). Vier aus dem Jahr 2008 (Crivitz, Demen, Friedrichsruhe, Tramm) und eine Gemeinde aus dem Jahr 2010 (Banzkow).
Es wird viel Arbeit auf die Amtswehrführung zukommen, um die Rechtssicherheit zu überprüfen und zu erhalten. Ungültige oder nicht überarbeitete Feuerwehrgebührensatzungen sind kein Kavaliersdelikt und können sehr kostspielig werden!
Kommentar/Resümee – der Redaktion

Es ist erstaunlich, dass auch die Amtsvorsteherin Frau Iris Brincker Amt Crivitz im Jahr 2021 an der besagten Sitzung der Stadtvertretung teilnahm und auch die Dringlichkeit der Änderungen oder Überarbeitungen betonte. Sie versprach baldige Änderungen oder Anpassungen, doch seit genau 36 Monaten ist nichts geschehen! So heißt es aber in der Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Crivitz dazu im §15(3): „Das Amt Crivitz wird ermächtigt, die Gebührenordnung zu dieser Satzung aus marktwirtschaftlicher Sicht anzupassen und bei neu beschafften Mitteln der Feuerwehr die erforderlichen Kostensätze in diese aufzunehmen“.
Seit 15 Jahren wurden erhebliche Mittel neu angeschafft und die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Zu diesem Zweck erhält die Feuerwehr in Crivitz im Oktober 2024 wieder ein neues Fahrzeug. Aufgrund des Mangels an Kapazitäten im Amt Crivitz könnte es sein, dass externes Fachwissen erforderlich ist. Die Kommunalberatung und Service GmbH – KUBUS – bietet hierzu umfangreiche Fachworkshops „Kosten für Leistungen und Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr“ in MV an.
Es wäre sicherlich hilfreich, wenn auch der Amtswehrführer Markus Eichwitz an diesen umfangreichen Schulungen teilnimmt, um der gesamten Problematik mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sein eigenes Verständnis für die Kalkulationen und das Gesetz zu erweitern. Denn in etwa 45 Monaten steht die nächste Wahl an!
Es wäre ebenso denkbar, in diesem Kontext gleich ebenfalls zu klären, wer denn nun die Erlaubnis erhält, die Feuerwehr auch im internen Bereich zu Festlichkeiten und Repräsentationen einzubinden und wer dafür die Kosten trägt und welche.
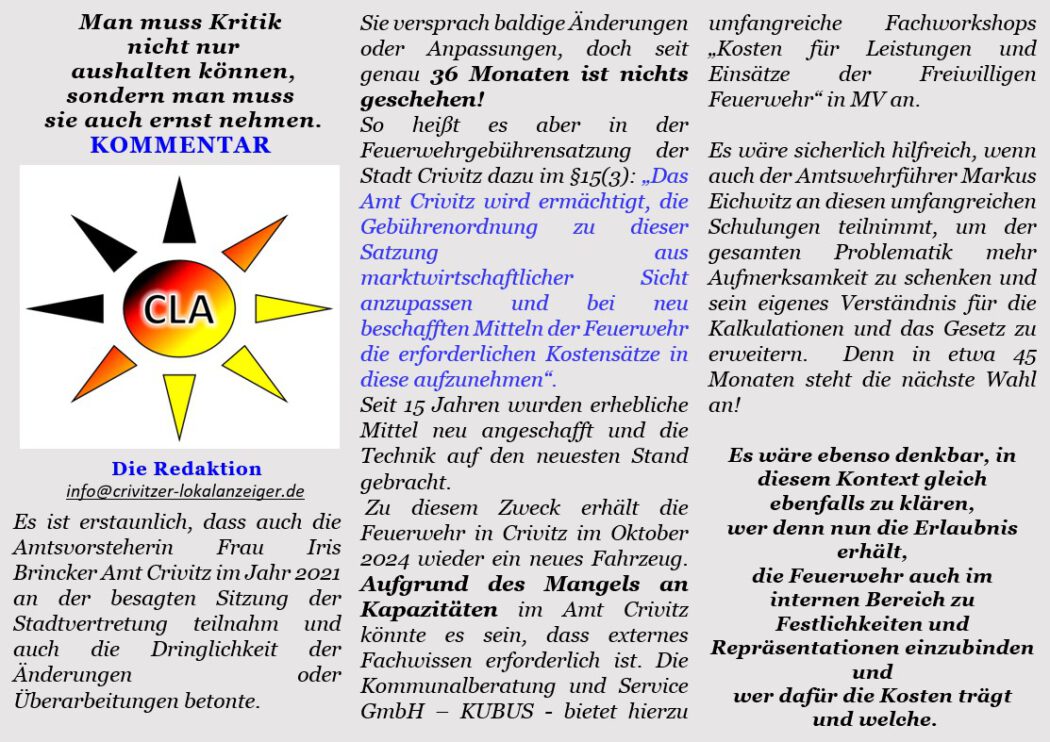
19.August -2024/P-headli.-cont.-red./413[163(38-22)]/CLA-249/88-2024

Es ist vorgesehen, bis zu 20 Windräder zu errichten, und Crivitz plant, eines davon zu errichten!
Die Wählergruppe *CWG* strebt an, ein städtisches Windrad im „Energiepark Wessin“ errichten zu lassen. Sie hofft sicherlich auf finanzielle Unterstützung sowie einen möglichen Geldregen, um ihren desaströsen Haushalt zu retten!

Damit hat sich die *CWG – Crivitzer Wählergemeinschaft* in ihren politischen Ansichten um 180 Grad gedreht, denn vor der Wahl wurde das Thema im Wahlkampf peinlichst vermieden
(vom ehemaligen Windkraftgegner zum Windanlagenbauer).

Auf den eigenen Wahlflyern hieß es lediglich: „Seit Monaten arbeiten u. a. auch Stadtvertreter von uns zusammen mit Fachleuten an einem gemeinsamen Wärme- und Energiekonzept für Barnin, Crivitz und Zapel. Durch erneuerbare Energien soll somit eine Versorgung zu erschwinglichen Preisen ermöglicht werden“. Hiermit ist klar die Arbeitsgruppe (Klimaschutz- sowie Energiemanagement) gemeint; eine Lieblingsbeschäftigung von Alexander Gamm, in der er sich wieder als Vorreiter und Experte bezüglich Energiesicherheit in der Stadtvertretung mithilfe der *CWG* positionieren konnte.
Bereits kurz vor der letzten Wahl wurde uns von Bürgern und auch Unternehmern aus Wessin mitgeteilt, dass die Wählergruppe der *CWG* plant, ein eigenes Windrad in ihrem eigenen geplanten Energiepark in Wessin zu errichten. Einige von ihnen konnten uns sogar den stadteigenen Grund und Boden als Standort auf einem Hügel innerhalb des geplanten Energieparks genau bezeichnen. Zu diesem Zeitpunkt des Bekanntwerdens wurden bereits Vermessungsarbeiten in diesem Gebiet durchgeführt, die in Bezug auf die geplanten 110 KV-Leitungen der WEMAG standen. Es ist anzunehmen, dass alles bereits in den Köpfen seit Längerem geplant war!
Nun soll also Crivitz anstreben, ein sogenanntes Bürgerwindrad im Tourismusort Wessin zu errichten und falls es nach der CWG gehen sollte, könnte es sicherlich lieber heute als morgen sein. Man kann daher nicht davon ausgehen, dass die CWG oder die Stadt Crivitz in der Lage sind, ein Windrad zu bauen oder genauer gesagt überhaupt weiß, wie man das tut. Auch die CWG oder die Stadt Crivitz haben nicht einfach so mal eben ca. 4 Mio. € (2020 waren es noch ca. 2,7 Mio. €) in einer Schublade herumliegen für ein Windrad dieser Größe, wie sie im Energiepark geplant sind.
Denn der Haushalt der Stadt Crivitz ist im Keller und es gibt nur noch 125.000 € liquide Mittel. Folglich ist es die Logik der Sache, dass man hierfür einen starken Partner benötigt, der entweder baut oder bauen lässt oder einen beteiligt an diesem Projekt wie in anderen Gemeinden. Der einzige Antragsteller für den Bau der Windräder im Energiepark ist die Kloss New Energy und diese sind nicht gerade romantisch auf die Stadt zu sprechen, aufgrund der durchgeführten jahrelangen Veränderungssperre und der Planung eines eigenen Energieparks.
Wir dürfen gespannt sein, welchen Energie – Partner die Stadtvertretung und insbesondere der Bauausschuss uns präsentieren werden. Es sei daran erinnert, dass Alexander Gamm bereits im September 2023 als damalige Bauausschussvorsitzender und Arbeitsgruppenchef (Wärme und Klimaschutz) im Crivitzer Stadtblatt klare und eindeutige Aussagen getroffen hat zu diesem Thema: „Viele Gespräche, Besichtigungen anderer erfolgreicher Orte und Systeme, Seminare der Landesenergie- und Klimaschutzagentur und eigene Konzeptentwicklung u. a. mit der WEMAG als kommunaler Energiedienstleister bringen uns dem Ziel näher: einen Strom- und Wärmetarif für uns Crivitzer, Barniner, Zapeler, der bezahlbar bleibt und eine mögliche Fernwärmeversorgung, an der bereits einige große Hauseigentümer sehr interessiert sind.“
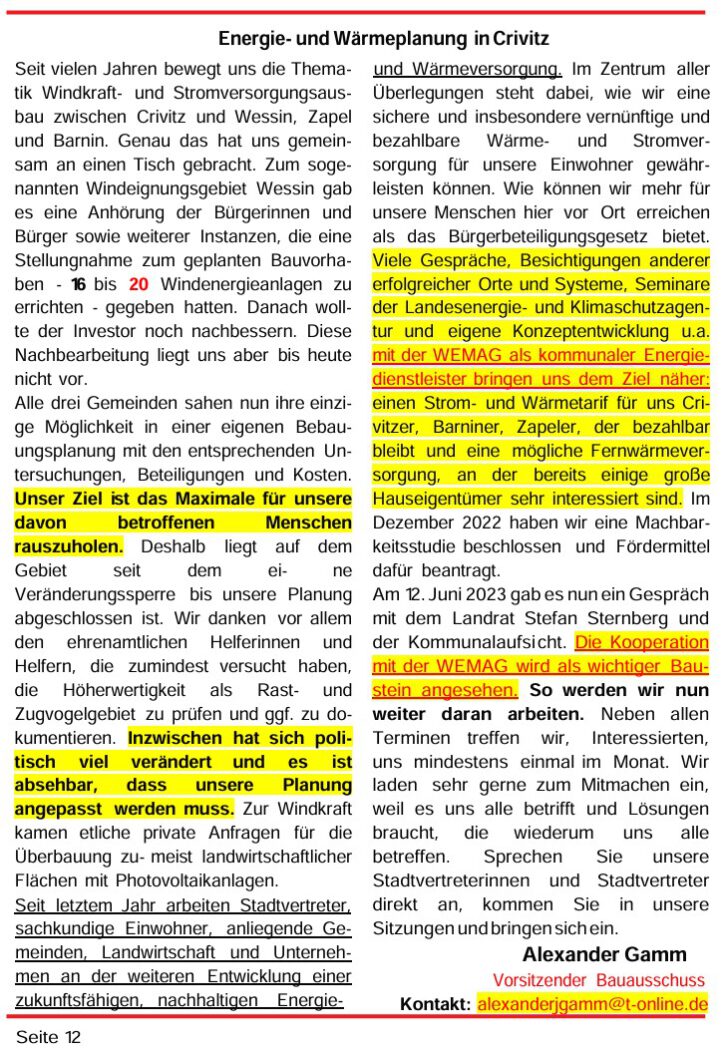
Hierzu wurde noch deutlicher formuliert: „Die Kooperation mit der WEMAG wird als wichtiger Baustein angesehen.“ (Crivitzer Stadtblatt 09/2023, Alexander Gamm). Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bereits im Jahr 2014 ein Antrag der WEMAG als erster Investor auf Zielabweichung in dem Ortsteil Wessin der Stadt Crivitz, dem heutigen Energiepark, eingereicht wurde, um sieben Windkraftanlagen zu errichten.
Die Geschichte wird sicherlich ihre Fortsetzung finden und die Aussagen zu einem Partner sind bereits im Jahr 2023 klar und deutlich erkennbar.
Kommentar-Resümee der Redaktion
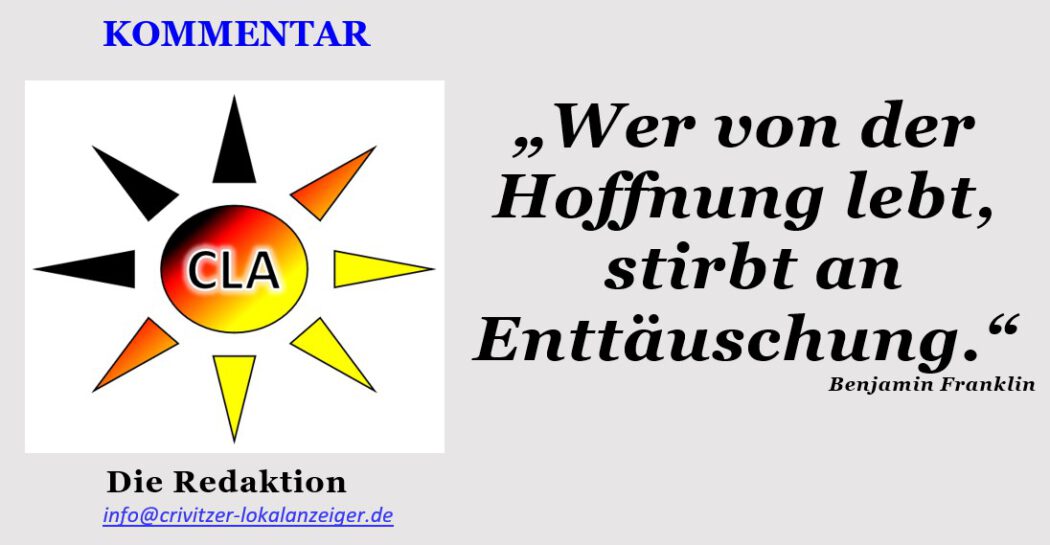
„Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung.“ Benjamin Franklin
Die endlosen Narrative der Wählergruppe der *CWG*:
–„ Die Nutzung erneuerbarer Energien ist notwendig, aber mit uns nur im Einklang mit den Menschen vor Ort realisierbar.“ (Wahlflyer 26.05.2019),
sowie das ewige Wortspiel:
– „Wenn die Windkraftanlagen tatsächlich nicht verhindert werden können, so sind zumindest die bestmöglichen Konditionen zu erzielen“ (10.12.2018-Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm)
und die Erklärung:
–„ Inzwischen hat sich politisch viel verändert und es ist absehbar, dass unsere Planung angepasst werden muss“ (Stadtblatt Crivitz-Alexander Gamm – damaliger Bauausschussvorsitzender – September 2023) kumulieren den Eiertanz und die Verschauklung des Bürgers zu diesen Themen vor und nach der Wahl 2024!
Windenergie soll attraktiver gemacht und neue Anreize sollen bei den Betroffenen geschaffen werden und die klammen kommunalen Kassen zu füllen. Es ist erfreulich, dass bisher nur wenige Kommunen sich an diesem unsinnigen Spielmodus beteiligt haben. Seit Juni 2024 gehört Crivitz nun aber auch zu denjenigen, die auf einen Geldsegen hoffen. Womit soll eigentlich dieser Geldregen vom Bürgerwindrad begründet sein?
Wenn bei den betroffenen Einwohnern Landschaften zerstört werden, Böden zu Sondermüll verkommen, die Lebensqualität durch Lärm und Schall beeinträchtigt wird, der Lebensraum von Großvögeln und Insekten zerstört und ein Tourismusgebiet in Wessin auf Generationen von Profitakteuren verschlungen wird. Bloß, weil das Gebiet gerade Pech hat und an einem Umspannwerk der WEMAG liegt und man alle Natur- und Artenschutzrichtlinien beiseite räumt, um mit aller Macht Windräder zu bauen, von denen die Anwohner im Ortsteil Wessin am wenigsten profitieren. Auch bei einem städtischen Bürgerwindrad der Stadt Crivitz nicht. Es bleibt zu hoffen, dass viele Menschen eine Haltung haben werden, den wunderschönen Versprechen der Windindustrie zu widerstehen. Denn es würde nur wenige Menschen profitieren, aber viele würden alles verlieren.
Es ist erstaunlich, dass die Crivitzer Wählergemeinschaft, die gerade in Ihrem jüngsten „Danksagung“ Flyeralarm an die Wähler versprochen hat, die Bürger „zu informieren und Transparenz zu schaffen“, gerade diese Themen im Geheimen abspricht. Wobei man doch schon im September 2023 im Stadtblatt dazu aufgerufen hat, sich jeden Mittwoch öffentlich zu präsentieren für interessierte Bürger zum Windkraft- und Stromversorgungsausbau.
Was soll das denn alles? Also bitte, klar und deutlich, auch in der Öffentlichkeit!
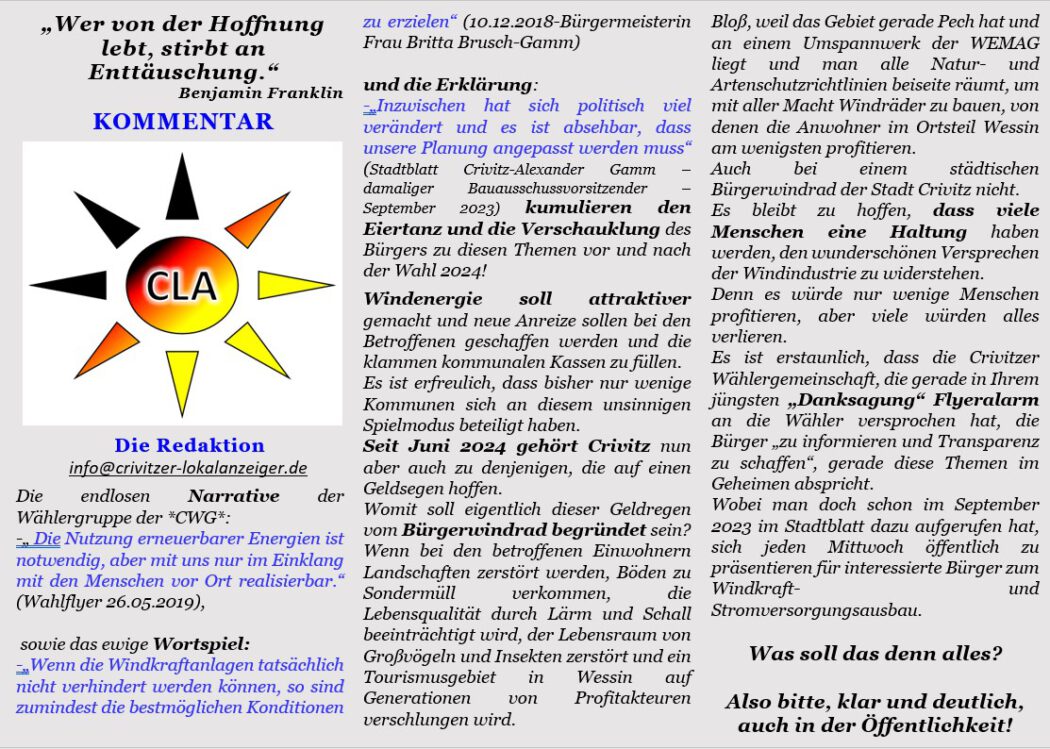
17.August -2024/P-headli.-cont.-red./412[163(38-22)]/CLA-248/87-2024
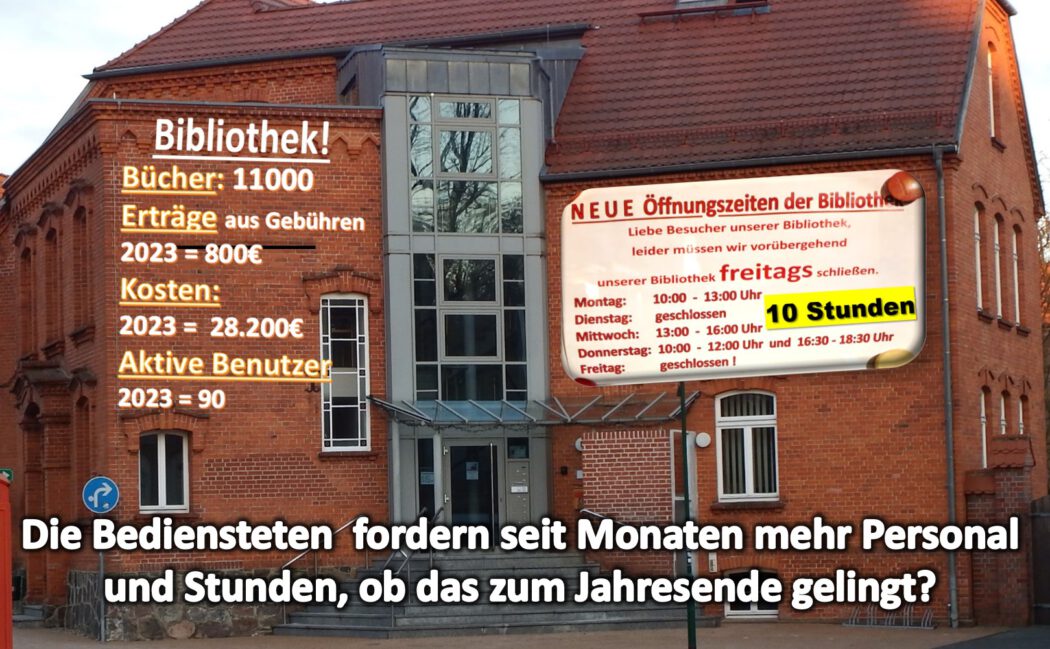
Könnte es sein, dass sich ein gewisser Realitätsverlust in diesen Forderungen manifestiert?
Bereits während der Kulturausschusssitzung am Anfang des Jahres 2024, wo eigentlich die letzte Berichterstattung der damaligen Citymanagerin vorgesehen war und nicht erfolgte, entschied man sich lieber für eine Besichtigung der soeben sanierten Bibliothek zu unternehmen. Die Stimmen aus der Bibliothek erregten bereits vor der Wahl großes Aufsehen, als sie forderten, dass mehr Mitarbeiterstunden erforderlich seien.
Es wurden Wellensofas angeschafft, die Bodenbeläge in der Bibliothek ausgetauscht und eine Türsprechanlage installiert sowie ein PC-Arbeitsplatz, auch wurden neue umfangreiche Kopiermöglichkeiten geschaffen. Ebenso wurde die Mitarbeiteranzahl Anfang des Jahres auf vier aufgestockt. Zur Rechtfertigung dieser Investitionen in Personal und Ausstattung beschloss damals die *CWG* Stadtspitze, eine neue Gebührenerhöhung in der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek zu veranlassen. Um die Einnahmen aus freiwilligen Leistungen für die Bibliothek zu erhöhen.
Die neuen Benutzungsgebühren pro Erwachsenen/Jahr ist von 20 auf 30 € gestiegen, und neu sind auch die Jahreskarten für Partner und Familienangehörige bis zu 40,00 €. Die Halbjahreskarte für Erwachsene ab 18 Jahren kostet jetzt 15 €, ebenso wie der Eintritt für Lesungen und Veranstaltungen für Erwachsene. Selbstverständlich sind auch die Kosten für das Kopieren gestiegen durch die neuen Kopiermöglichkeiten von 0,25 € auf bis zu 1,00 € pro Blatt, je nachdem, wie groß und bunt das Blatt sein soll. Das entspricht einer deutlichen Steigerung der Gebühren im Vergleich zur alten Satzung.
Das Ungewöhnliche an dieser neuen Gebührenerhöhung ist, dass sie zwar am 11.12.2023 beschlossen wurde und man danach auch in der Bibliothek tätig wird und die Einnahmen auch kassiert. Dennoch wurde die neue Gebührensatzung bis heute nicht veröffentlicht! Die Satzung wird erst wirksam, wenn sie von der Bürgermeisterin unterzeichnet und veröffentlicht wurde! Erst dann entfaltet sie ihre Rechtskraft! Daher muss man sich darauf einstellen, dass es weiterhin Einwände und Anfragen seitens der Kommunalaufsicht geben wird, welche Gelder nun rechtmäßig nach welcher Satzung eingenommen wurden und welche nicht.
In der Bibliothek sind seit dem Jahr 2024 indessen bis zu vier Mitarbeiter tätig, was bedeutet, dass in der Woche ca. 39 Arbeitsstunden zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich entweder eine deutliche Diskrepanz, die es auszugleichen gilt, oder es ist notwendig, die Fragen zu beantworten: Welche Tätigkeiten im Bürgerhaus noch von den Bediensteten der Bibliothek erledigt werden? Auch ist der Zugang zur Bibliothek nach wie vor NICHT barrierefrei!
Im Bürgerhaus arbeiten 2024 insgesamt 8 Bedienstete mit ca. 110 Wochenstunden. Das sind eine Stadtkoordinatorin in Vollzeit, zwei Museumsmitarbeiter, davon eine in Vollzeit und eine Aushilfe Seniorenarbeit, das entspricht insgesamt ca. 71 Wochenstunden und vier Bibliotheksmitarbeiter mit insgesamt ca. 39 Wochenstunden. Es ist schon bemerkenswert und erstaunlich, dass die wöchentlichen Öffnungszeiten der Bibliothek nur auf 10 Stunden in der Woche beschränkt sind.
Zusammengefasst fallen hier unter dem Bereich Kultur und Heimatpflege für das Bürgerhaus ca. 207.000 € an mit ca. 137.000 € Personalkosten, ca. 1.800 € an Sachleistungen, ca. 11.000 € Transferleistungen an das Land + 5.000 € Zuschüsse an den privaten Bereich und ca. 52.000 € für Sonstige laufende Auszahlungen, wovon ca. 43.000 € Repräsentationen sind. Hinzu kommen noch einmal ca. 63.000 € für die Unterhaltung, Versicherungen, Gas, Wasser, Strom, Telefon und Reinigung und sonstiges.
Die Gesamtkosten für die Heimat und sonstige Kulturpflege mit dem Bürgerhaus betragen also ca. 270.000 € wobei dem gegenüber stehen an Einnahmen (gesamt ca. 86.000 €) davon sind Eingliederungszuschüsse für Arbeitnehmer vom Bund ca. 63.000 €, Miete Trauzimmer und Wohnung mit ca. 8.000 € und Zuweisungen vom Land mit ca. 15.000 €. Verbleibt ein jährliches Defizit von ca. – 184.000 € für die Heimat uns sonstige Kulturpflege mit dem Bürgerhaus.
Forderungen sind nur dann erreichbar, wenn sie auch realistisch in absehbarer Zeit umsetzbar sind!
Bei allen Überlegungen, die Personalstunden für den kommenden Haushalt 2025 zu erhöhen, muss auch berücksichtigt werden, dass es bereits nach den aktuellen Tarifverträgen im Jahr 2024: Eine Entgelterhöhung: +200 € +5,5 %; mindestens insgesamt 340 € gab, sowie eine Einmalzahlung von insgesamt 3000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies »Inflationsausgleichsgeld«: Juni 2023: 1240 € und Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 € erfolgten.
Ab dem 31.12.2024 findet die nächste Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst für die Kommunen statt, wobei man auch hier wieder von ca. 3,0 % Erhöhung der Entgelte ausgehen kann.
Kommentar/Resümee-der Redaktion
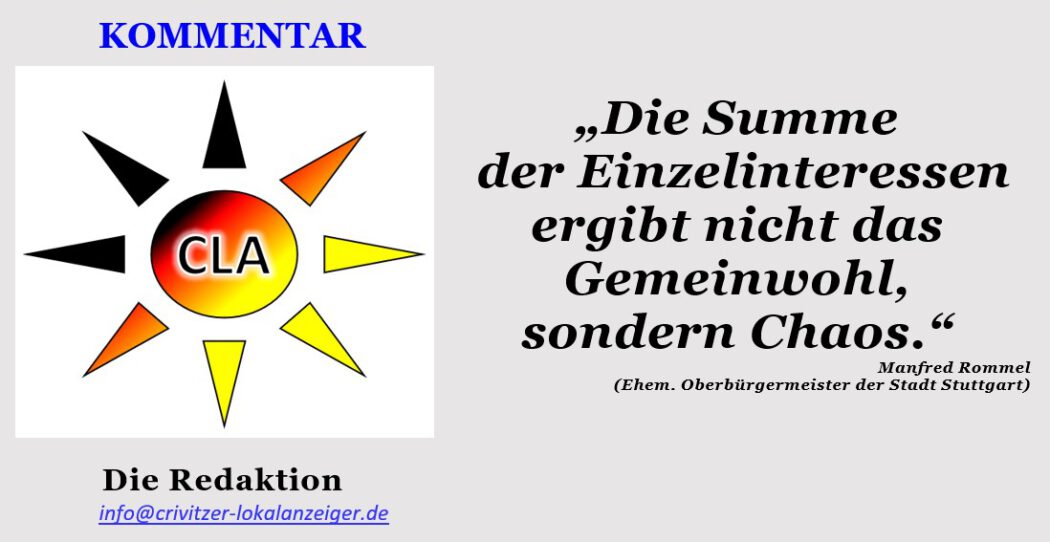
„Die Summe der Einzelinteressen ergibt nicht das Gemeinwohl, sondern Chaos.“ Manfred Rommel (Ehem. Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart)
Die Entscheidung, die neue Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Stadt Crivitz zu beschließen, ist nicht zufällig, sondern beruht auf rein politischen Erwägungen. Die Diskussion über den Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Stadt Crivitz steht unmittelbar bevor; an diesem Ort findet selbstverständlich auch die Debatte über den neuen Stellenplan für das Jahr 2025 statt. Da es sich bei der Bibliothek in der Stadt Crivitz um eine sehr defizitäre Haushaltsposition handelt, muss zumindest ein Versuch unternommen werden, die vielen Investitions- und Personalkosten zu rechtfertigen.
Es ist von Bedeutung, das Bürgerhaus in seiner Gesamtheit zu betrachten, einschließlich seiner Angebotspalette und der personellen Ausstattung, um zu analysieren, welche Bereiche zusammengelegt werden können, um neue finanzielle Strategien für die Zukunft zu entwickeln und umzusetzen. Eine langfristige Sicherung oder sogar ein Standortwechsel sind nötig. So wie es bereits von der *CWG Stadtspitze* auf dem ersten Workshop * Perspektive Bürger*- zum Thema Innenstadt *Marktplatz im Volkshaus Crivitz am 29.10.2022 präsentiert wurde in einem von mehreren Entwürfen.
Trotz der nüchternen Betrachtungsweise, die man als Außenstehender hat, ist die Betreibung einer Bibliothek stets eine politische Angelegenheit in Crivitz und muss als Ganzes im Bürgerhaus betrachtet werden. Es ist anzunehmen, dass die Finanzierung der gegenwärtigen Personal- und Sachausgaben aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Crivitz in den kommenden Jahren nicht mehr zu bewältigen ist und zunehmend schwieriger wird, wenn sie überhaupt noch realisierbar ist.
Hierbei handelt es sich stets um einen hohen Verlust, der vom Steuerzahler zu tragen ist und das muss man auch den Bürgern vermitteln. Damit die Steuerzahler auch bereit sind, diese expliziten Kosten ebenfalls in der Zukunft mitzutragen und zu akzeptieren, auch durch neue Steuer- und Gebührenerhöhungen auf anderen Ebenen.

14.August -2024/P-headli.-cont.-red./411[163(38-22)]/CLA-247/86-2024

Während der Konstituierung in Raben Steinfeld hat die neue Fraktion ZgRS die Bürgermeisterfraktion in Raben Steinfeld entmachtet und die Befugnisse des wiedergewählten Bürgermeisters drastisch reduziert.
Die Bürger haben sich für den Bürgermeisterkandidaten in Raben Steinfeld im ersten Wahlgang für Herrn Klaus-Dieter Bruns Wählergemeinschaft – WfRS [Wir für Raben Steinfeld] mit 48,7 % einer hohen Mehrheit gegen seine Kontrahenten Holger Voß 29,8 % Wählergruppe –SfuD (Stark für unser Dorf) und haushoch gegen Torsten Lubatsch (CDU) 21,4 % entschieden. Ein zweiter Wahlgang war erforderlich, da die absolute Mehrheit knapp verfehlt wurde. Aufgrund des schlechten Ergebnisses im ersten Wahlgang war die CDU mit Torsten Lubatsch nicht mehr vertreten.
Die CDU/SPD und die Wählergruppe SfuD haben sich bereits vor der Stichwahl zu einem gemeinsamen Wahlaufruf zusammengeschlossen. Sie haben sich an die Bürger damit gewandt und um Unterstützung für Ihren Kandidaten/ Herausforderer Herrn Holger Voß aus der Wählergruppe SfuD gegen den amtierenden Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns, Wählergemeinschaft – WfRS gebeten. Man nutze auch die Tageszeitungen, um die Stimmung auf den zweiten Wahlgang so richtig anzuheizen.
Auf die Frage, warum Herr Holger Voß, SfuD nun der bessere Bürgermeister sein sollte, antwortete er: „Das wird im gemeinsamen Wahlaufruf für mich von CDU, SPD und Wählergemeinschaft „Stark für unser Dorf“ deutlich: Mein Selbstverständnis von diesem Amt ist anders: Ein Bürgermeister sollte verbinden, nicht polarisieren; er ist kein Alleinherrscher, sondern muss vertrauensvoll mit der Gemeindevertretung zusammenarbeiten. Er sollte mit Sachverstand und Umsicht die Geschicke des Dorfes steuern und darf es nicht in den Ruin führen. Von Kindheit an bin ich Raben Steinfeld verbunden. Ich habe langjährige Führungs- und Verwaltungserfahrung.“(SVZ vom 15.06.2024).
Die Seitenhiebe, die sich zwischen den Zeilen verbergen und die hier bereits verteilt wurden, über die Anzweiflung der persönlichen Eignung und die finanzielle Übersicht des Amtsinhabers, zeigen bereits hier die Entschlossenheit und Angriffslust des Herausforderers. Sie könnten einerseits auf die frühere Stasi-Mitgliedschaft des amtierenden Bürgermeisters zurückzuführen sein, die vor der Wahl öffentlich gemacht wurden und andererseits auf die erteilten SPERRVERMERKE im Nachtragshaushalt 2024 vom 11.03.2024 bei Investitionen wegen einer negativer Liquiditätsentwicklung der Folgejahre. Die Gemeinde Raben Steinfeld möchte für einen geplanten Solarpark Grundstücke in Höhe von 300.000,00 € erwerben und zur Sicherstellung des Brandschutzes benötigt sie ein neues HLF 20 (Feuerwehrfahrzeug), welches ungefähr 600.000,00 € kosten wird. Die beiden Investitionen wurden gesperrt, erst nachdem die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (ca. 160.000 €) tatsächlich generiert werden und die Sonderbedarfszuweisung für das Feuerwehrfahrzeug in geplanter Höhe von ca. 200.000 € bewilligt wird, sollen diese Investitionen umgesetzt werden. Hierzu gab es vermutlich erhebliche Diskrepanzen in der Gemeindevertretung mitten im Wahlkampf.
Die Bürger bestätigten trotzdem den amtierenden Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns mit 60,2 % (WfRS) vor seinem Herausforderer Holger Voß mit nur noch 39,8 % (SfuD), jedoch bei nur noch einer Wahlbeteiligung von 65,3 % gegenüber dem ersten Wahlgang von 81,7 %. Bereits 2019 trat Holger Voß als Bürgermeisterkandidat in seiner Tätigkeit als Forstamtsleiter durch die Partei der SPD an und verlor ebenfalls sehr deutlich.
Bei der Zusammensetzung der Gemeindevertretung in Rabensteinfeld haben sich die Bürger zum ersten Mal breiter entschieden als bei der letzten Wahl 2019. Die CDU verlor deutlich an Stimmen und Mandaten und ist nur noch mit vier Sitzen in der Gemeindevertretung vertreten, davon zwei das Ehepaar Lubatsch. Die SPD wurde deutlich verkleinert und ist nur noch mit einem Sitz vertreten. Auf Anhieb in der Gemeindevertretung sind die Wählergemeinschaft WfRS mit drei Mandaten + Bürgermeister sowie die neue Wählergruppe SfuD der Familie Holger und Malte Voß. [ CDU 40,8 %, SPD 5 %, SfuD 19,9 % und die WfRS mit 34,5 %] Eine schwere Bürde für die CDU, die seit zehn Jahren nur Erfolg gewohnt ist.
Nachdem die Angst bei den Parteien ausgebrochen war, schlossen sich nun diejenigen zusammen, die eine Niederlage erlitten haben CDU+SPD und die jetzige Wählergruppe SfuD (mit dem ehemaligen Kandidaten der SPD) zu einer Fraktion *Zukunft gemeinschaftliches Raben Steinfeld (ZgRS) * mit nun 7 Sitzen und Machtansprüchen gegen die Bürgermeisterfraktion WfRS mit nur 4 Sitzen.
So entschied die neue Zukunftsfraktion ZgRS die Wahl für die Stellvertreter des Bürgermeisters für sich und besetzte die Spitzenposten des 1. Bürgermeister Herrn Jörg Nagel (CDU) und des 2. Bürgermeister Herr Holger Voß (SfuD) ohne auch nur einen Zweifel daran aufkommen zu lassen, wer hier in den kommenden 59 Monaten das Sagen haben wird und der bestimmende sein wird. Im Rahmen der folgenden Abstimmung zur Änderung der Hauptsatzung wurden als Erstes die Rechte des Bürgermeisters drastisch eingeschränkt; er darf nur bis zu den Wertgrenzen von 750 € und wiederkehrenden Verpflichtungen von 250 € pro Monat (vorher 2.500 € und 500 €) entscheiden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2.500 € (vorher bei 5.000 €).
Am deutlichsten wird die Befugnisbeschränkung des Bürgermeisters zum Ausdruck gebracht, in dem er NICHT MEHR entscheiden darf über die Ausübung oder Nichtausübung des Vorkaufsrechts gem. §§ 24 ff. BauGB und der über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen gem. § 36BauGB. Es ist ihm auch NICHT mehr möglich, über alle Bauanträge innerhalb der bebaubaren Bereiche bis maximal 5 m Zufahrtsbreite im Einvernehmen mit der Verwaltung zu entscheiden.
Die Entscheidung über diese Vorgänge liegt indessen ausschließlich beim Hauptausschuss, der seine Befugnisse bei der Vergabe von Bauaufträgen auf eine Wertgrenze von 500 EUR bis 250.000 € ausgeweitet hat und in dem die neue Zukunftsfraktion ZgRS die absolute Macht erlangte. Sämtliche Angelegenheiten in Bezug auf Verwaltung, Nutzung und Sanierung des Schlosses sowie Pflege und Instandsetzung des Schlossparks sind der Gemeindevertretung vorbehalten.
Es ist zu hoffen, dass die neue Zukunftsfraktion ZgRS weiterhin die Zusammenarbeit und das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt, anstatt alle Macht und Entscheidungen an sich zu reißen.
Kommentar-Resümee der Redaktion
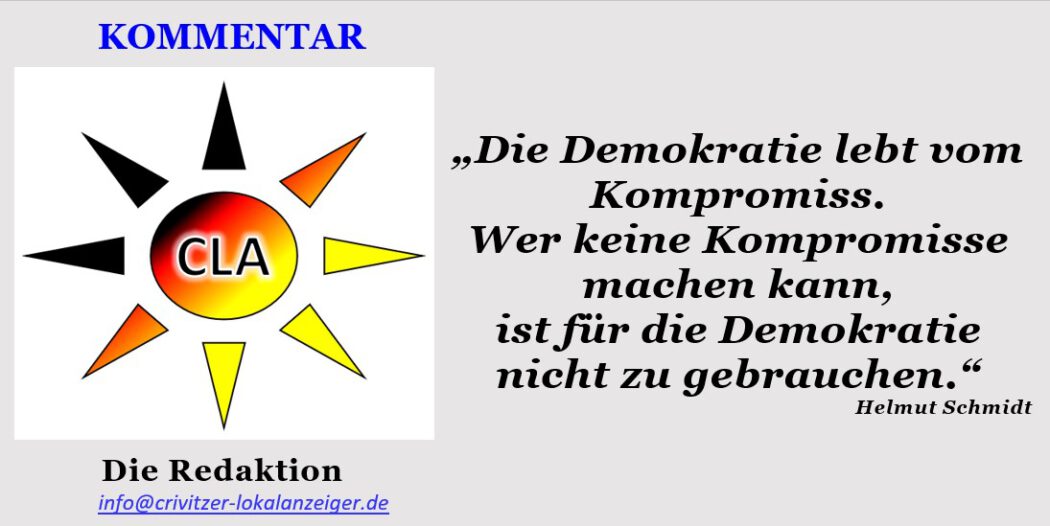
„Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen.“ Helmut Schmidt
Die Wahl wurde zwar verloren, jedoch die absolute Macht wurde gewonnen.
Offenbar setzt die neue Zukunftsfraktion ZgRS aus CDU+SPD und der Wählergruppe SfuD weiterhin auf Konfrontation und massive Einschränkungen, indem sie vor der nächsten Gemeindeversammlung Folgendes vorhat:
– Die offizielle bestehende Raben-Steinfeld-App zu kündigen und stattdessen eine neue angeblich neutrale App „Dorf Funk“ einzurichten, die vom Land MV unterstützt wird.
– Gemäß der neuen Hauptsatzung soll eine neue Arbeitsgruppe (Schloss/Schlosspark) gegründet werden, die folgenden Mitglieder Holger Voss (SfuD), Jörg Nagel (CDU) und Gunter Dehl (CDU) angehören sollen. Die genannten Mitglieder gehören komplett zur neuen Zukunftsfraktion ZgRS.
– Die Ausstattung mit Tablett im Wert bis zu 500 € für alle Gemeindevertreter, um die Unterlagen für ihre Sitzungen über das ALLRIS-System des Amtes Crivitz einzusehen.
– so verlangt die Fraktion ferner Auskunft über:
„Rückmeldung BVVG über Flächenkauf an der Autobahn, Kaufvertrag mit Herrn Bunsen, Investor bei Planet wegen Wohnungsbau, Förderantrag bei Geothermie Projekt, Bauvorhaben bzw. Flächennutzungsplan im U-Dorf bzw. im Oberdorf, Klageverfahren gegenüber dem Landkreis, Rechnung Bauvorhaben Krüger, Haus von Anke im Oberdorf, Nutzungsvereinbarung, Schlüsselberechtigung vom Schloss, Flächentausch Angler/Krüger“! (Anträge @Allris-Sitzungsunterlagen)
Abgesehen von der rechtschreib- und formalrechtlichen Beschreibung der Anträge entsprechen sie in keinerlei Hinsicht den Bestimmungen der Kommunalverfassung und der eigenen Geschäftsordnung. Sie sind weder einzeln in schriftlicher Form eingereicht worden, noch wurden sie begründet, geschweige denn ist die Finanzierung beschrieben worden, mit eventuellen finanziellen Folgen für den Haushalt.
Die Gründung der Zukunftsfraktion ZgRS aus CDU+SPD und der Wählergruppe SfuD könnte bei den Wählern Erstaunen auslösen, da es einen weitergehenden Zusammenschluss (z. B. mehrere Fraktionen miteinander) darstellt und dadurch andere Fraktionen oder Zählgemeinschaften benachteiligt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10. 12. 2003 ist es rechtlich unzulässig, dass sich mehrere Fraktionen zu einer Zählgemeinschaft zusammenschließen und so kleinere Fraktionen bei der Ausschussbesetzung benachteiligt werden.
Es wird sich zeigen, ob das Vertrauen der Bürger in die Mehrheitsfraktion (Zukunftsfraktion-ZgRS) weiterhin ungebrochen ist und welche Darbietungen noch so alles diese Fraktion der Zukunft gemeinschaftliches Raben Steinfeld in dieser Wahlperiode präsentieren wird.
Der Start ist bereits missglückt.

12.August-2024/P-headli.-cont.-red./410[163(38-22)]/CLA-246/85-2024

Die Bürger in Pinnow haben sich im ersten Wahlgang mit einer deutlichen Mehrheit von 64,2 % dafür entschieden, Herrn Günter Tiroux (offene Liste) zum neuen Bürgermeister zu wählen gegen seine Mitbewerberinnen Frau Karoline Ruth Dorothea Münch (WGP) 23,7 % und Frau Daniela Lemmer-Helms (Aktive) 12,1 %.
Auch bei der Zusammensetzung der Gemeindevertretung in Pinnow haben die Bürger zum ersten Mal einen eindeutigen Sieger und drei deutliche Verlierer gewählt. Die Wählergruppe der offenen Liste erreichte mit 52,5 % die absolute Mehrheit und konnte durch ihre kommunale Tätigkeit und Ziele für die Zukunft den Wähler deutlich in Pinnow überzeugen. Die CDU mit 17,9 %, die Wählergruppe des ehemaligen Bürgermeisters Andreas Zapf (WGP) mit 17,6 % und die Wählergruppe (AKTIVE) mit nur 10,1 % konnten die Bürger nicht überzeugen und verloren deutlich an Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2019.
Somit konnte die Fraktion *offene Liste Godern und Pinnow* 7 Mandate erzielen und auch der Bürgermeister war aus dieser Fraktion hervorgegangen. Daraufhin schlossen sich also jetzt die drei, die eine Niederlage (CDU, WGP, Aktive) erlitten haben zu einer gemeinsamen Fraktion (5 Mandate) * Bastion für Recht und Demokratie*[BRD) zusammen, die bereits in den vergangenen 10 Jahren auf unterschiedliche Weise kooperiert haben. Sodass jetzt nur noch zwei Fraktionen in der Gemeinde Pinnow gibt: die „Offene Liste Godern und Pinnow“ um den Bürgermeister Tiroux mit 8 Sitzen und die Fraktion „Bastion für Recht und Demokratie“ mit 5 Sitzen, wobei auch 2 auf die CDU entfallen.
Eine sogenannte „Bastion“ ist eigentlich eine letzte Zuflucht oder Rückzugsort, mit einer Verschanzung gegen Feinde ausgerichtet. Es bleibt abzuwarten, ob die Fraktion *BRD* in der Gemeinde Pinnow in MV das letzte Bollwerk für Recht und Demokratie darstellt. Die vorgestellten Ziele im Internet, ihre Zusammensetzung und Präsenz in der Öffentlichkeit auf der ersten Sitzung in Pinnow in MV lassen erhebliche Zweifel aufkommen. Die eigentlichen Feinde, gegen die man sich schützen möchte, wurden im Internet klar definiert und dienen nicht so richtig der Rettung des Rechts und der Demokratie, sondern dienen eher dazu, Spaltungen und Bollwerke innerhalb einer Gemeinde Pinnow aufzubauen.
„Gerade bei einer Bürgermeisterfraktion, die mit einer starken Mehrheit ausgestattet ist, bedarf es einer organisierten Gruppe, die darauf achtet, dass Recht und Demokratie gewahrt bleiben, so der gewählte Fraktionsvorsitzende Klaus-Michael Glaser (CDU)“. (www.pinnow.orts.app) . Hier wird ein seltsames *Narrativ* verwendet, um den eigentlichen Machtverlust zu verdeutlichen, mit dem man nicht zurechtkommt. Eine äußerst merkwürdige Festlegung und Aussage, die stark an die rechtskonservative Partei der Werteunion von Herrn Maaßen erinnert, deren Anschauungen in Pinnow anscheinend erfolgreich sind.
Nun stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Fraktion *offene Liste Godern und Pinnow* welche als sogenannte „Bürgermeisterfraktion“ bezeichnet wird und als Wahlsieger 2024 festgestellt wurde, außerhalb von Recht und Demokratie steht?
Mit welchen Mitteln strebt denn nun die Fraktion der *Bastion* an, ihre Festung bzw. Bollwerk zu verteidigen, beispielsweise etwa durch eine Form von Attacke oder was ist eigentlich ihr Plan?
So gab es bereits in den letzten Wahlperioden in der Stadt Crivitz und in der Gemeinde Plate, Demen, Bülow, Dobin am See, Gneven, Raben Steinfeld sowie Suckow, sogenannte „Bürgermeisterfraktion, die mit einer starken Mehrheit“ ausgestattet waren, aber *Bastionen* sind dort nicht entstanden.
Der Sommerabend war sehr schwül und Gewitter zogen auf Pinnow zu, als die konstituierende Sitzung stattfand. Im Sitzungsraum herrschte eine sehr angenehme Temperatur und eine freundliche, niveauvolle Stimmung, die von vielen Gästen unterstützt wurde. Die anwesenden Mandatsträger verfügten eigentlich über die nötige Kompetenz, um richtig zu argumentieren. Der neue Chef von der Fraktion der [BRD], Herr Klaus Michael Glaser, zeigte sich jedoch bereits bei der ersten Sitzung der Gemeindevertretung recht angriffslustig und schmallippig bei seinen Reden, als es um die Hauptsatzung + Geschäftsordnung sowie um die Postenverteilung ging.
Nach der Vereidigung des Bürgermeisters Günter Tiroux (offene Liste) stand die Wahl des ersten 1. Bürgermeisters an, wobei hier Frank Czerwonka (offene Liste) nominiert wurde. Nachdem der Versammlungsleiter nach weiteren Bewerbern gefragt hatte, wurde dann plötzlich eine Laudatio der Fraktion *Bastion* abgehalten auf den ehemaligen 1. Bürgermeister, Herrn Klaus Michael Glaser. Als erneut die Anfrage gestellt wurde, weitere Kandidaten zu benennen, und ob nun Herr Glaser kandidieren würde, wurde dies nicht bestätigt. Gleichzeitig wurde jedoch von ihm eine geheime Wahl beantragt. Bei den anwesenden Zuschauern und Gästen herrschte ein raues Geräusch und ein Kopfschütteln.
Herr Frank Czerwonka konnte sich mit 9 Stimmen durchsetzen. Die Wahl zum 2. Bürgermeister war weniger spektakulär und anscheinend hatte man sich darüber bereits fraktionsübergreifend geeinigt. Frau Karoline Ruth Dorothea Münch (WGP) wurde hier als zweite Bürgermeisterin gewählt.
In der anschließenden Diskussion um die neue Hauptsatzung stellte die Fraktion der offenen Liste einige Anträge und erläuterte diese, welche nicht immer ein Freunden-Taumel bei der Fraktion *Bastion* auslöste, die mit ihren Anträgen zur Änderung scheiterte. Die Erklärungen und Begründungen der Anträge der Fraktion *Bastion* waren zu kurz gefasst und wurden lediglich verwaltungstechnisch und belehrend, aber nicht plausibel erklärt. Der neue Chef der [BRD], Herr Klaus Michael Glaser, verkündete sofort lautstark „die Gelbe Karte – das ist nicht mit uns abgestimmt“ an die andere Fraktionsseite. Es ist schon erstaunlich, dass eine demokratische Forderung zwar als selbstverständlich betrachtet wird, jedoch in der Vergangenheit nicht immer in der eigenen Rolle als Funktionsträger vermutlich umgesetzt wurde. Im Hinblick auf die einzelnen Ausschüsse verliefen einige Vorabgespräche äußerst zügig, sodass die meisten Positionen sofort besetzt werden konnten und hier zeigte sich eine gewisse Kooperation.
Es ist zu hoffen, dass die Fraktion der *Bastion* weiterhin die Zusammenarbeit und das Gemeinwohl im Vordergrund sieht, anstatt die Attacke!
Kommentar/Resümee – der Redaktion

Gute Dinge brauchen Ihre Zeit!
Es ist erstaunlich, dass die Mehrheitsfraktion mit ihrem Motto: „Informieren, Diskutieren, GEMEINSAM GESTALTEN“ bereits mit der Änderung der Hauptsatzung + Geschäftsordnung wesentliche Grundlagen geschaffen hat, um Ihre Ziele zu verwirklichen. So wurde ein Medienbeauftragter gewählt, der für sämtliche Medien (Pinnow-App+ Internetseite) zuständig ist. Überdies ist er eine Art *Pressesprecher* für alle öffentlichen Mitteilungen, an denen alle Gemeindevertreter teilnehmen und ihre Kontrolle ausüben können. Anders als in der Stadt Crivitz, wo die Bürgermeisterin die Medieninhalte (Facebook, Internetseite, Printmedien) bearbeitet und Pressestatements abgibt, auf deren Inhalt niemand Einfluss und Kontrolle hat.
Bei der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister + Stellvertreter hat die Gemeinde Pinnow sich nicht an die neue Entschädigungsverordnung gehalten, sondern ist unter dem Höchstbetrag geblieben und wollte somit ein Signal setzen. Auch soll der Zukunftsausschuss Pinnow 2050 neu ausgerichtet werden, um mehr Bürgerbeteiligung bei Projektentwicklungen für einen Bürgersolarpark oder ein energetisches Dorf zu ermöglichen.
Der Verlust des Postens des 1. Bürgermeisteramtes in Pinnow war für Herrn Klaus-Michael Glaser eine schmerzhafte Enttäuschung, die man während der Sitzung sehr deutlich spüren konnte. Nach einer derart langen Zeit ist es notwendig, sich mit einem Machtverlust einfach auseinanderzusetzen, auch wenn man es nicht gewohnt ist, als CDU-Führungskraft im Kreis LUP nun in der eigenen Gemeinde als Minderheit zu agieren. Es scheint, als ob er unbedingt erneut in den Amtsausschuss des Amtes Crivitz möchte, um wenigstens dort seine Positionen verteidigen zu können.
Folglich hat sich in der Gemeinde Pinnow gleich zum Anfang einiges getan.
Es wird sich zeigen, ob das Vertrauen in die Mehrheitsfraktion der offenen Liste (Wählergruppe) weiterhin ungebrochen ist und welche Darbietungen die Fraktion der „Bastion für Recht und Demokratie“ noch so alles abliefern wird in dieser Wahlperiode.
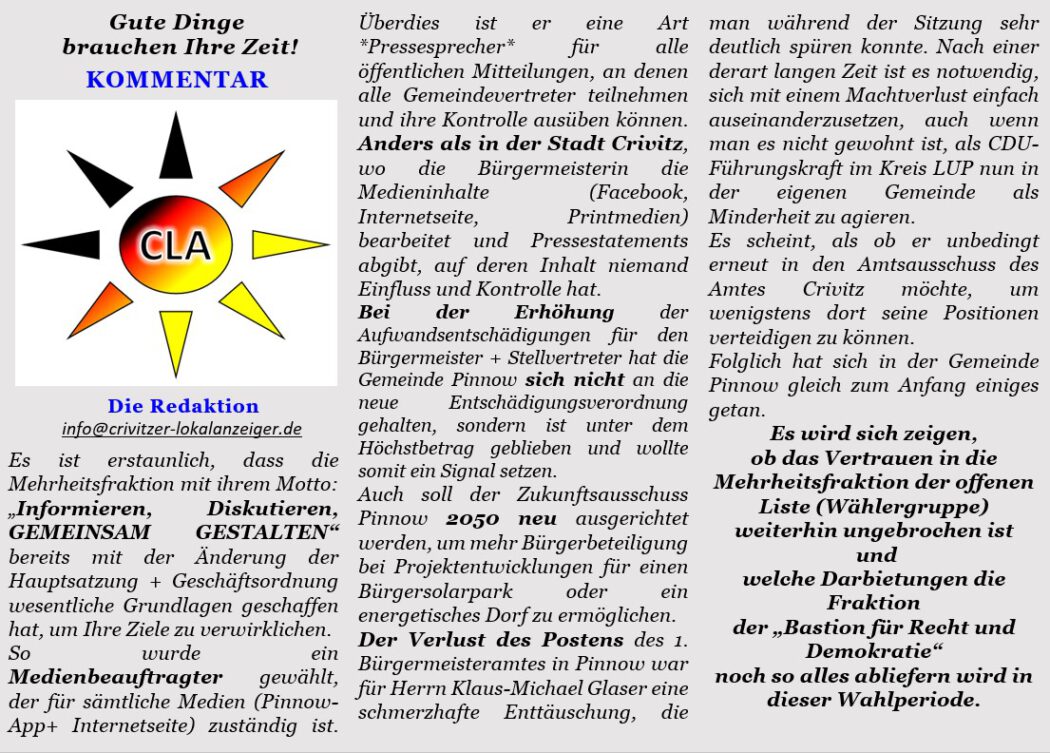
09.August -2024/P-headli.-cont.-red./409[163(38-22)]/CLA-245/84-2024

Wo sollte man hingehen, wenn sich die Blase wieder meldet und ein Klo nötig ist?
Die Region um den Tourismusort Crivitz und Crivitz möchte unbedingt Touristen anlocken. Mit immer mehr Radwegen, Rastplätzen am Ortseingang, Badestellen und einem neuen Marktplatz mit Events, der zum Einkaufen animieren soll. Was passiert, wenn Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Inkontinenz unterwegs sind? Doch an welchem Ort befindet sich nun die nächste rettende öffentliche Toilette?
Eine öffentliche Toilette befindet sich in Crivitz direkt neben dem Bürgerhaus. Es ist die Einzige in der Stadt Crivitz und den Ortsteilen sowie im Umkreis von ca. 10 km. Das öffentliche Klo ist nicht nur für Frauen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, sondern auch für Männer.
Abgesehen von dem Fäkalgeruch und der schlichten Ausstattung, die an das vergangene Jahrhundert erinnert, ist es jedoch erfreulich, dass genügend Papier zu finden ist. Wer jedoch am Wochenende oder nach 16:00 Uhr an den Werktagen oder bei Urlaub des Bürgerhauses unterwegs ist, hat ein großes Problem, da es verschlossen ist und bleibt. Es existiert kein Hinweis darauf, dass diese Toilette dann geschlossen ist; ebenso sind die Öffnungszeiten nicht bekannt. Hinweisschilder in der Stadt sind ebenfalls Mangelware, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Es scheint jedoch eine wöchentliche Reinigung zu geben!
Insbesondere in ländlichen Regionen ist die Versorgung mit öffentlichen WCs unzureichend. Hier besteht dringend Handlungsbedarf. Vielmehr sollte das Thema öffentliches Klo in die Diskussionen der Stadtvertreter aufgenommen werden, anstatt sich permanent nur seit Jahren im Kulturausschuss mit Kinderspielplätzen zu befassen und im Umweltausschuss Flyer für Wanderwege drucken zu lassen. Die demografische Entwicklung ist auch in einem regionalen Grundzentrum wie der Stadt Crivitz zu spüren und die Menschen mit eingeschränkter Mobilität haben in Crivitz kaum Möglichkeiten, ein öffentliches Klo aufzusuchen, besonders nach 16:00 Uhr an den Werktagen und am Wochenende. Wo soll man hingehen oder bei einem Event auf dem Marktplatz?
Acht Monate lang versuchte der Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) im Kultur- und Bauausschuss darauf hinzuweisen, dass es auf der einzigen öffentlichen Toilette in der Stadt Crivitz kein Licht gibt. Das Problem konnte erst kurz vor den bevorstehenden Wahlen im Juni 2024 gelöst werden.
Es fehlt ganz einfach bei unserer Stadtspitze angefangen und auch bei den Mandatsträgern schlichtweg die Erkenntnis, dass öffentliche Toiletten ein wichtiger Teil der Infrastruktur einer Stadt sind. Besonders wenn man sich mit dem Titel*Tourismusort* schmückt, aber dafür kein Konzept hat.
Es ist ratsam, über die Errichtung weiterer öffentlicher WCs nachzudenken oder die im Bürgerhaus selbst existierenden WCs als öffentliche Toilette zu deklarieren. Ebenso könnten Partnerschaften mit dem Krankenhaus, dem Kaufhaus oder der Gastronomie in der Lage sein, kostenfreie Toiletten zur Verfügung zu stellen, wobei die Stadt Crivitz im Gegenzug sich an den Kosten beteiligt.
Seit 10 Jahren stellt Crivitz Millionen Euro für Projekte in der Infrastruktur zur Verfügung. Jedoch ist für ein Konzept für *öffentliche Klo’s* oder eine Sanierung der einzigen öffentlichen Toilette auf einen entsprechen Standard in der Ausstattung auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität plötzlich kein Geld mehr verfügbar.
Crivitz erhält jährlich 343.054,05 € an Zuweisungen zur Infrastruktur für 4770 Einwohner und erhält jährlich noch dazu etwa 70.887,21 € als zentraler Ort für die Einwohnerzahl 8675 des Nahbereichs. Also, das Geld ist da, oder?
Kommentar/Resümee – der Redaktion
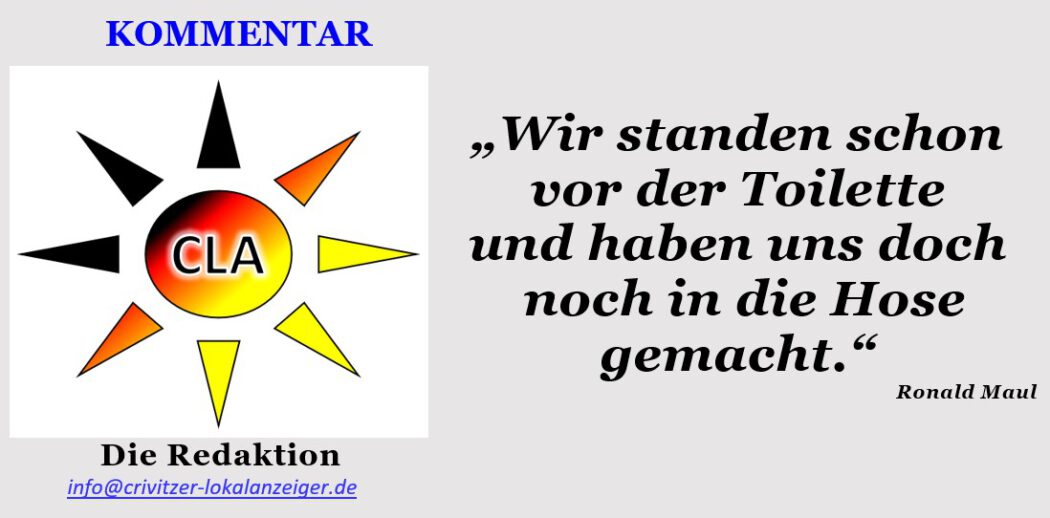
„Wir standen schon vor der Toilette und haben uns doch noch in die Hose gemacht.“ Ronald Maul
So wie es der Rostocker Mittelfeldspieler Ronald Maul beschreibt und sich fühlte im Jahre 2002 nach der 3:4-Niederlage von Rostock bei Werder Bremen angesichts des unbefriedigenden Spielverlaufs, könnte es jedermann tatsächlich ergehen in der Stadt Crivitz. Sofern man nach 16:00 Uhr an den Werktagen oder am Wochenende in Crivitz ein öffentliches stilles Örtchen sucht.
Die Aktion „Nette Toilette“ wurde bereits in über 300 Kommunen seit 2002 etabliert. Um die städtischen Ausgaben zu reduzieren und mehr Dienstleistungen für Bürger und Touristen anzubieten. Die gastronomischen Betriebe im Zentrum von Städten stellen ihre Toiletten zu ihren Öffnungszeiten kostenlos und ohne Verzehrpflicht der Allgemeinheit zur Benutzung zur Verfügung. Die Firmen, die an diesem Projekt teilnehmen, bekommen von den Städten einen Aufkleber. Mit diesem Aufkleber machen sie darauf aufmerksam. Die Städte beteiligen sich dann im Gegenzug an den Kosten der Betriebe dafür. Dieses Projekt bzw. Idee wäre zumindest eine Übergangslösung, um den Tourismusort Crivitz und die Innenstadt attraktiver zu machen, auch wenn ein Event nach 16:00 Uhr stattfindet oder der Einkauf im Kaufhaus etwas länger dauert.
Die Stadt Crivitz gibt in diesem Jahr ca. 68.700 € für Repräsentationen aus (allein die Bürgermeisterin Frau Britta – Brusch Gamm verbraucht davon ca. 10.000 €) sowie ca. 3.300 € für den Tourismus (wofür auch immer) und ca. 100.000 € verbrauchen die politischen Gremien (allein die Sitzungsgelder betragen ca. 35.000 €), aber für die Sanierung der öffentlichen Toilette in der Stadt Crivitz ist seit Jahren kein Geld mehr vorhanden!
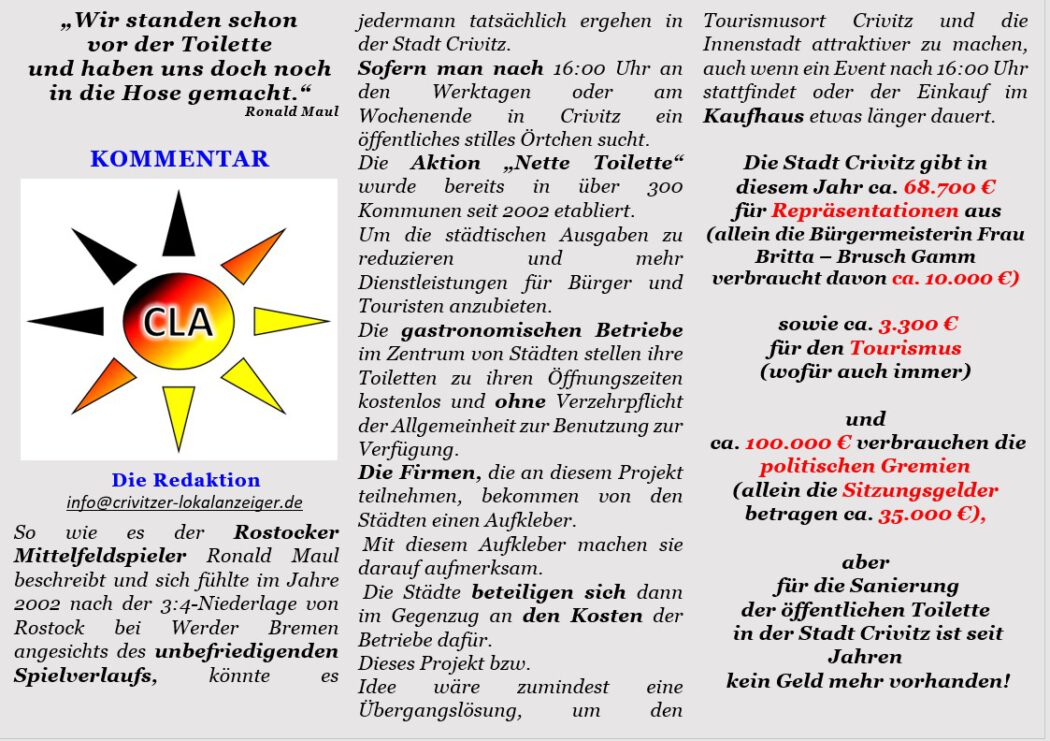
07. August -2024/P-headli.-cont.-red./408[163(38-22)]/CLA-244/83-2024

Die Begrüßung war freundlich und die Atmosphäre vermittelte den Eindruck, dass niemand etwas verbergen wollte.
Nach der Ernennung von Heinrich-Hermann Behr zum Bürgermeister machte er in seinem kurzen Statement zum Amtsantritt deutlich, wo seine Schwerpunkte lagen. Er betonte unter anderem, er wolle ein Bürgermeister für alle Ortsteile von Tramm, Göhren, Bahlenhüschen und Settin sein. Was auch immer er damit besonders betonen wollte, bleibt offen. Vielleicht hat es mit der Vergangenheit zu tun.
Die Wähler in Tramm haben sich für die folgenden Fraktionen, CDU mit 13,4 %, DIE LINKE mit 8,7 %, die Wählergruppen der FWT 25,0 %, die UWG mit 22,0 % und die „Alle Gemeinsam“ 30,9 % entschieden. Auch in der Gemeinde Tramm sind die parteilosen Wählergruppen deutlich stärker vertreten als die etablierten Parteien. Nachdem sich alle Fraktionen und Wählergruppen auf die konstituierende Versammlung vorbereitet und gemeinsame Gespräche geführt hatten, fand die Wahl zum ersten und zweiten Bürgermeister sogar offen statt. So ist nicht verwunderlich, dass Herr Maik Schomann von der Wählergruppe der UWG zum 1. Bürgermeister und Frau Britta Eggert von der Wählergruppe „Alle Gemeinsam“ zur zweiten Bürgermeisterin gewählt wurde.
Doch bei der Verabschiedung der neuen Hauptsatzung kam es zu Diskussionen über die Änderungen.
In der Gemeinde Tramm sollen keine beratenden Ausschüsse mehr gebildet werden. Es soll nur noch einen nicht öffentlichen, beschließenden Hauptausschuss und eine Sitzung der Gemeindevertretung geben. Selbst die Rechnungsprüfung übergibt man an das Amt Crivitz. Auch alle Bauvorhaben nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben), Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach § 69 LBauO M-V und alle Anträge auf Zufahrten bis zur Breite von 5 m entscheidet nun allein der Bürgermeister allein im Einvernehmen mit der Verwaltung des Amtes Crivitz. Lediglich auf der Gemeindeversammlung informiert der Bürgermeister über die Entscheidungen, die er getroffen hat, oder gemeinsam mit dem Amt Crivitz.
Auch auf der letzten verbliebenen öffentlichen Sitzung in der Gemeinde Tramm (Gemeindevertretersitzung) ist es den Einwohnern nicht gestattet, in der Einwohnerfragestunde (Fragen, Anregungen und Vorschläge) bei wichtigen Themen zu aktuellen Tagesordnungspunkten zu sprechen oder Vorschläge zu unterbreiten und Anfragen zustellen. Stattdessen müssen sie im Durchschnitt 2 Monate auf die nächste Sitzung der Gemeindevertretung warten, um ihre Anliegen vorzutragen, sofern das Thema nicht mehr auf der Tagesordnung steht.
Das ist wirklich überwältigend und eigentlich wenig geeignet, um eine Bürgernähe und Bürgerbeteiligung zu fördern? Ob das alles im Interesse des Wählers ist und ob es dem Gemeinwohl dient, bleibt abzuwarten.
Alle diese Maßnahmen wurden begründet durch die Tatsache, dass man vorher noch einen beratenden Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr und Sicherheit hatte, der manchmal Fristen nicht einhalten konnte gegenüber dem Amt Crivitz und zu wenig Bauanträge gestellt wurden. Es wurde dargelegt, dass dieses sich alles in der letzten Wahlperiode nicht bewährt hat und deshalb soll nun der Bürgermeister oder der nicht öffentliche Hauptausschuss über vieles entscheiden.
Eine äußerst fragwürdige und unverständliche Begründung!
In der anschließenden Abstimmung wurde über die Hauptsatzung abgestimmt und mehrheitlich wurden die Änderungen beschlossen. Die darauffolgende Besetzung des Hauptausschusses und anderer Gremien wurde wiederum sehr einvernehmlich vorgenommen. Zum Schluss des Abends gab es noch ein gemeinsames Foto mit den angereisten Gästen des Amtes (Amtsvorsteherin Iris Brincker, Fachbereichsleiterin – Zentrale Dienste-Frau Iris Lenk und Sachbearbeiter – Tiefbau / Beiträge / Grün-Herr Matthias Beresowski)
Kommentar-Resümee/-die Redaktion
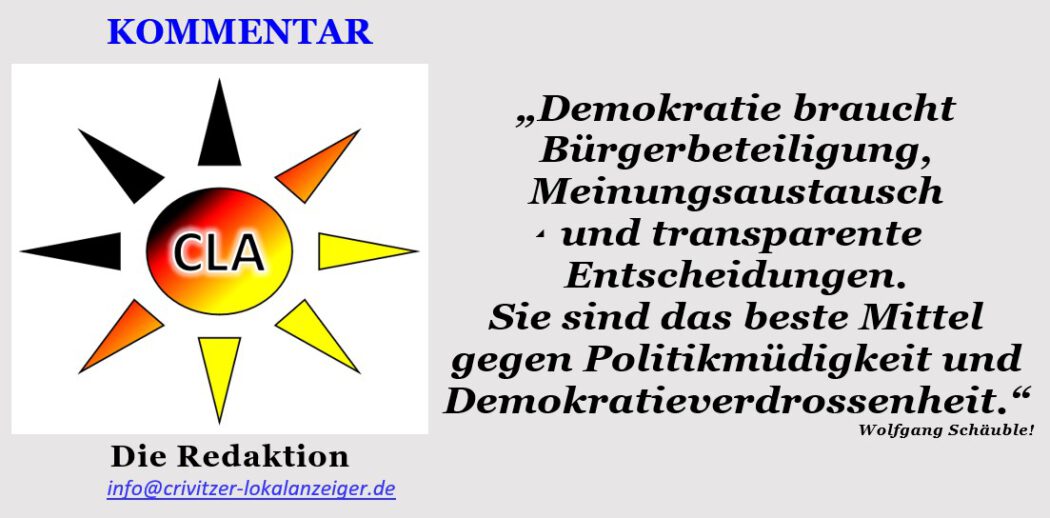
„Demokratie braucht Bürgerbeteiligung, Meinungsaustausch und transparente Entscheidungen. Sie sind das beste Mittel gegen Politikmüdigkeit und Demokratieverdrossenheit.“ Wolfgang Schäuble!
Es ist fraglich, ob eine Zentralisierung der Entscheidungen bei nahezu allen Bauanträgen und Plänen in einer Hand oder in den nicht öffentlichen Hauptausschuss erfolgen zu einem wesentlichen Fortschritt führt in der heutigen Zeit. Damit entledigen sich die Mandatsträger der Verantwortung, ihre Entscheidungen den Bürgern zu erklären oder sie mehr einzubeziehen.
Gerade in Zeiten der Wärmeplanung und des Klimaschutzes sind umfangreiche Bürgerbeteiligungen und Diskussionen mit den Einwohnern notwendig. Es bleibt unverständlich, warum der Bauausschuss, der für Sicherheit und Gemeindeentwicklung sowie Umwelt und Verkehr zuständig war, nun abgeschafft wurde, weil die Bürger bei diesem Thema deutlich mehr in der Zukunft hätten einbezogen werden können.
Es ist sicherlich nicht ohne Grund, dass sich Bürger in der Vergangenheit an die Sitzung des Landkreises LUP aus Tramm gewandt haben, um dort ihr Anliegen vorzutragen und sich Gehör zu verschaffen. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr geschehen.
Politik muss erklärt werden, deshalb ist die Diskussion mit den Bürgern über komplexe und komplizierte Themen in der heutigen Zeit von großer Bedeutung, insbesondere wenn die Einwohner nicht auf öffentlichen Sitzungen zu den aktuellen Tagesordnungspunkten bei Themen sprechen dürfen. Gerade in kleinen Gemeinden ist die Bürgerbeteiligung wichtig. Es ist nicht sinnvoll, die Diskussionen mit Einwohnern zu beschränken, indem man die Anzahl der beratenden Ausschüsse reduziert und sich stattdessen mehr auf die kommunalpolitischen und verwaltungsrechtlichen Aspekte fokussiert.
Politikverdrossenheit und Demokratieverdrossenheit können die Folge sein!

05.August -2024/P-headli.-cont.-red./407[163(38-22)]/CLA-243/82-2024

Wurde von Anfang an falsch kalkuliert oder gerechnet? Oder gibt es noch weitere zusätzliche Features, die nachträglich hinzugefügt wurden, um einen gehobenen Standard zu gewährleisten? Wurde das Leistungsverzeichnis für die Erstellung der Leistungen erweitert? Gab es mehrere Entwurfsplanungen?
Egal, gleichwohl, der Steuerzahler und die nachfolgenden Generationen in Crivitz werden es zwangsläufig bezahlen müssen! Die Sportstättenförderung ermöglicht für dieses Projekt eine Förderung in Höhe von bis zu max. 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben zu beantragen.
Im Oktober 2021 wurde der Beschluss gefasst, die Sanierung/Modernisierung der Sportanlage an der Grundschule „Fritz-Reuter“ durchzuführen, u. a. eine Sprintgerade, Rundlaufbahn, Weitsprunganlage und eine Multifunktionsfläche. Damals wurden die Bruttobaukosten geschätzt auf etwa 260.000 €. Die Vergabe der Planungsleistungen für die Modernisierung des Schulsportplatzes der Grundschule erfolgte unmittelbar im März 2022 an das Büro Tiefbauprojekt Schwerin, mit einem Bruttoauftragswert von 41.110,31 €. Das Programm der Sportstättenförderung läuft am 30.10.2025 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das Vorhaben fertiggestellt und komplett abgerechnet sein.
Kurioserweise wurde in den vergangenen 24 Monaten in keinem Gremium des Stadtparlaments über dieses Thema diskutiert, geschweige denn, dass jemand die Ursache für den rasanten Preisanstieg ermittelte und erklärt hat. Unmittelbar nach dem Grundsatzbeschluss im Oktober 2021 (öffentliche Beratung in der Stadtvertretung) wurde das Thema ausschließlich im Hauptausschuss (nicht-öffentlich-BV 521/22) im April 2022 beraten und sofort die Vergabe der Planungsleistungen veranlasst.
Es erfolgte zunächst die Vergabe der Leistungsphasen 1 bis 4 (Genehmigungsplanung) mit der Option der Vergabe der Leistungsphasen 5 bis 9. So wurde im Hauptausschuss damals festgelegt, dass eine erneute Beschlussfassung nicht erforderlich sei. Im September 2022 fand lediglich eine kurze Abstimmung über den Bauantrag im Bauausschuss statt, mit einer Entwurfsplanung oder Genehmigungsplanung, die noch einen Fußballplatz und Kleinspielfeld vorsahen. Das alles wurde nicht alles klar beschrieben, bevor das Vorhaben gänzlich von der Oberfläche verschwand.
Erst wieder im Februar 2023 tauchte das Thema wieder in abgeänderter Form zum Haushaltsplan auf, allerdings mit 63.200 € Ausgaben (gab es weitere Entwürfe?) und neuen Gesamtkosten ca. 429.000 € laut letztem Leistungsverzeichnis. Unmittelbar danach verschwand das gesamte Vorhaben wieder von der Bildfläche bis kurz vor der Kommunalwahl im März 2024. Da tauchte es wieder auf, nur in abgewandelter Form im Haushaltsplan 2024, nun beliefen sich die Gesamtkosten laut aktuellem Leistungsverzeichnis plötzlich schon auf ca. 500.000 €. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 240.000 € ausgegeben und weitere 332.853 € geplant, sodass die Gesamtplanung der Baukosten jetzt schon 572.853 € betägt.
Die Folgekosten wurden bisher nicht in den Blick genommen, denn sie betragen jährlich mindestens ca. 25.000 € Abschreibungen (welche erwirtschaftet werden müssen) sowie die zurzeit noch gültigen Personalkosten für den Sportstättenwart (Sportplatz Grundschule) von etwa 6.000 €. Hinzukommen dürften noch etwa 4.000 € für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen (laufende Unterhaltung).
Nur zum Vergleich: Die jährlichen Folgekosten im Jahr 2024 betragen für den:
– den Ausweichsportplatz (Neubau) etwa 45.000 €,
– den Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz ca. 30.000 €,
– Sportplatz Regionale Schule (Neustadt) etwa 27.000 €,
– Sportplatz der Grundschule (Altstadt) ca. 35.000 € (nach der Fertigstellung).
Und die jährlichen Folgekosten im Jahr 2024 betragen für die:
– die Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz etwa 53.000 €,
– die Turnhalle Regionale Schule (Neustadt) ca. 94.000 €,
– die Turnhalle Grundschule Crivitz etwa 36.000 €.
Für diese Sportstätten werden vermutlich wieder ab nächstes Jahr Gesamteinnahmen durch Nutzungsgebühren und Zuwendungen von etwa 140.000 € zur Verfügung stehen, aber dann sicherlich jährliche Gesamtaufwendungen von etwa 320.000 €. Es zeichnet sich bereits jetzt ein jährliches Defizit von etwa -180.000 € ab.
Unabhängig von den Kosten und der Tatsache, dass die Sportstätten sicherlich ihre Notwendigkeit und Bedeutung und ihre Erhaltung haben, sollte man den Bürgern die Pläne und Kostensteigerungen erläutern und benennen, um sie in Diskussionen einzubeziehen und mittragen zu lassen.
Transparenz ist eine Voraussetzung für erfolgreiche Politik. Oder?
Kommentar/Resümee der Redaktion

„Bürgerbeteiligung kann teuer sein. Keine Bürgerbeteiligung kann teuer werden.“ (Andreas Paust Vorsitzender des Kompetenzzentrums Bürgerbeteiligung)
Nur ein Beispiel zum Vergleich:
Die Gesamtkosten für den Ausweichsportplatzes (Neubau) 2015 beliefen sich auf ca. 837.000 € und die Summe der Fördermittel für dieses Projekt betrug lediglich 365.000 € (eine Förderung von ca. 40 %). Also betrug der Eigenanteil der Stadt Crivitz ( des Steuerzahlers) etwa 470.000 €.
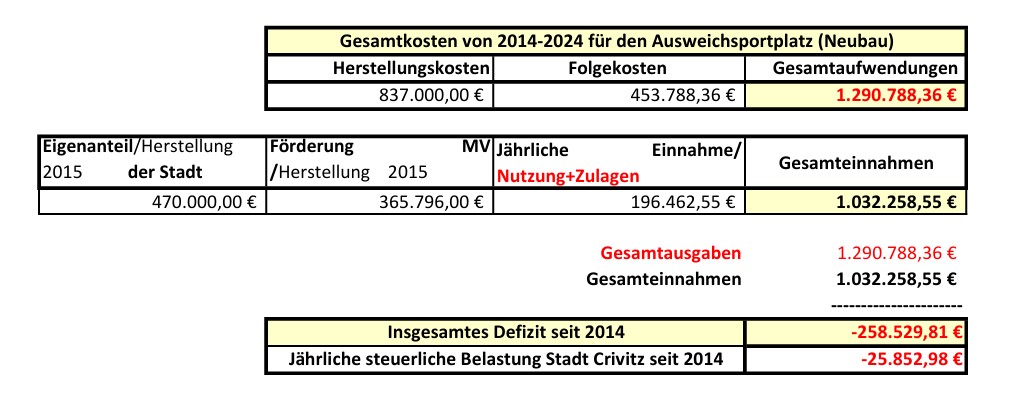
Die gesamten Aufwendungen seit 2014 (Herstellung + Folgekosten) betragen etwa 1.290.000€ und dem stehen gegenüber aber nur Einnahmen von (Eigenanteil+ Nutzungsgebühren+ Zuwendungen) etwa 1.032.258€.
Die jährlichen Folgekosten betragen von 2014 bis 2024:
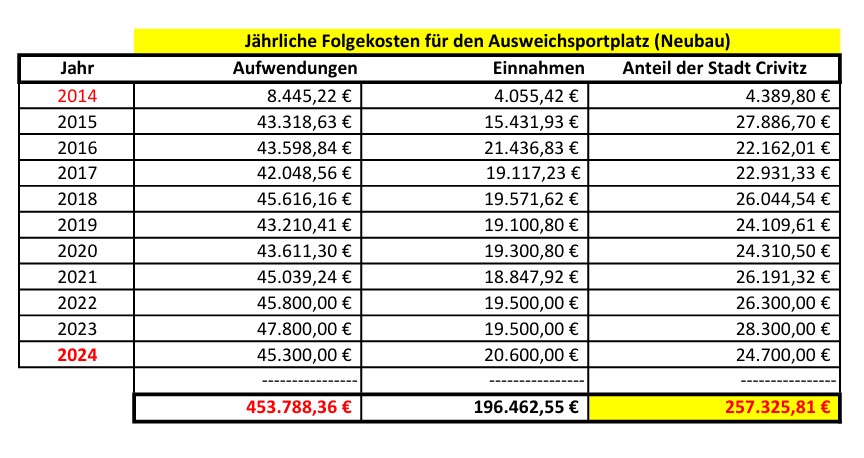
–Aufwendungen (Abschreibungen/Personalkosten/laufende Unterhaltung +GWG) = ca. 453.000 €
–Einnahmen (Nutzungsgebühren/Zuwendungen/Anlagen Umbuchungen) = ca. 196.000 € (davon reine Nutzungsgebühren ca. 10.000€)
Seit 10 Jahren trägt die Stadt Crivitz (also der Steuerzahler) die jährliche Differenz zu dieser Sportstätte in Höhe von ca. -25.800 €, wobei die Einnahmen insgesamt seit 2014 fast unverändert geblieben sind.
Das Thema der Einnahmen (Nutzungsgebühren) für den Ausweichsportplatz wird seit 10 Jahren unter den Tisch gekehrt, weil es politisch zu brisant sein könnte für die Parteien und Wählergruppen und Auswirkungen auf die nächste Wahl haben kann. Dies ist nur ein Beispiel für eine Sportstätte von sieben in der Stadt Crivitz und einer der Gründe, warum die Stadt Crivitz mit einer der höchsten Steuersätze seit 10 Jahren im Amtsbereich Crivitz hat!
Es ist erstaunlich, dass nicht einmal die vollständige Genehmigungsplanung, genauer gesagt das aktuelle Leistungsverzeichnis (Sportplatz Grundschule) in einem Gremium der Stadt Crivitz öffentlich besprochen wurde, sondern nur die Kostenerhöhungen. Dies gilt auch für die im Jahr 2024 beschlossenen Steuererhöhungen (Grund+ Gewerbesteuer) und die folgenden Erhöhungen, denn die nächste Generation wird dafür bezahlen müssen.
Transparenz ist eine Voraussetzung für erfolgreiche Politik. Oder?
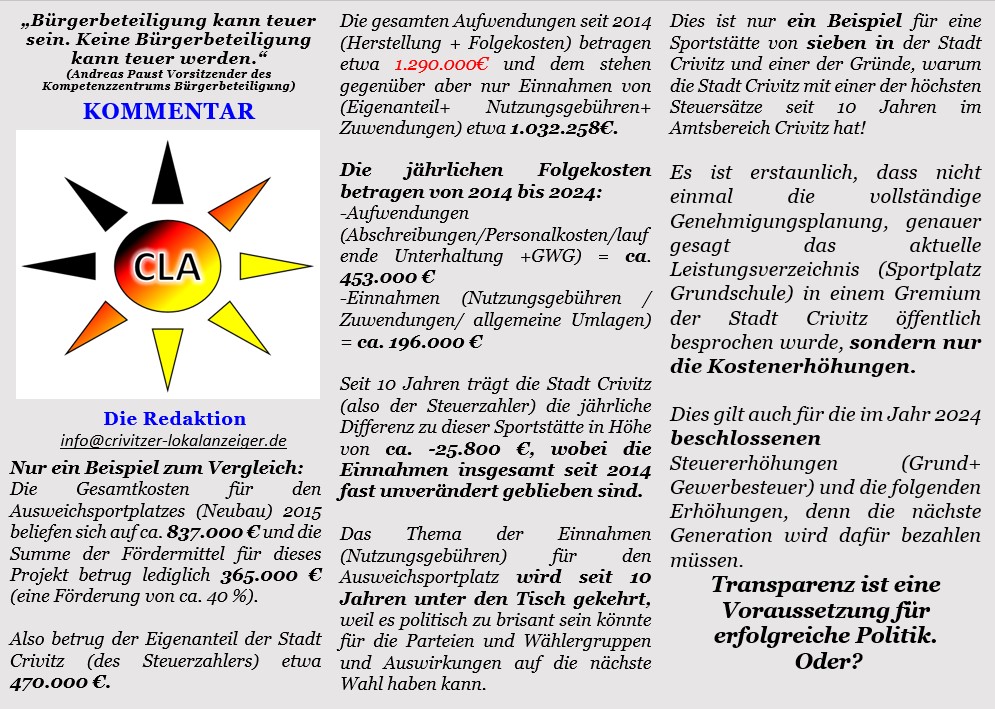
02.August -2024/P-headli.-cont.-red./406[163(38-22)]/CLA-242/81-2024
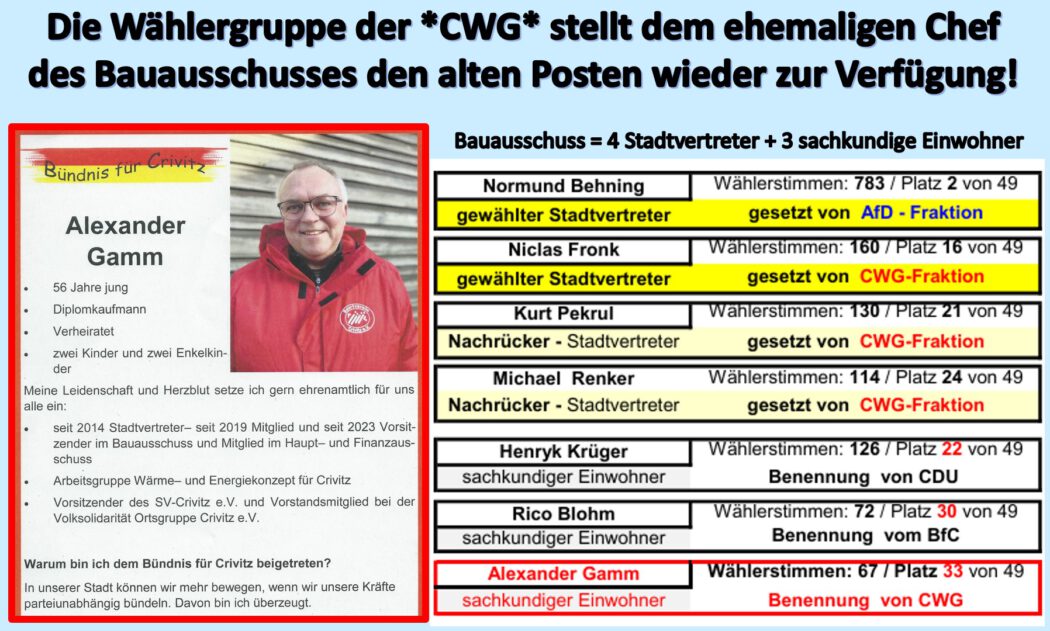
Von den Wählern wurde Alexander Gamm und seiner Partei die LINKE sowie dem Bürgerbündnis BFC abgestraft, doch nun ist er auferstanden, mithilfe der Wählergruppe der CWG, in der auch seine Ehefrau ist!
Ist der neue Bauausschuss wie der alte vor der Wahl? Raten Sie einmal, wer vermutlich Vorsitzender des Bauausschusses in Crivitz werden soll, bei vier CWG-Stimmen und drei anderen im Bauausschuss? Das ist eigentlich mathematisch ganz klar ersichtlich. Herr Alexander Gamm (Ehemann von Frau Brusch-Gamm und auf Facebook unter *Paul Hermann* unterwegs und Unterstützer der Partei des BSW)wird sich wahrscheinlich als Vorsitzender etablieren, da die CWG – Anhänger als politisch sehr linientreu gelten und ihn sicherlich wieder wählen werden. Was auch immer kommen mag! Gemäß dem Motto: *immer die Augen zu und durch*! Aber „Wen interessiert das“ schon, schließlich geht es primär nur um den Erhalt und die Ausübung einzelner Machtpositionen und Posten!
Wahrscheinlich war er auch bei seinen Genossen in der Partei DIE LINKE in Ungnade gefallen, die einerseits nicht mehr für die Wahl 2024 in Crivitz kandidierten und andererseits ihn auch nicht mehr zur Wahl aufstellen wollten. Es ist anzunehmen, dass es zu einer Vielzahl von Ereignissen innerhalb der Partei gekommen ist. Vermutlich erinnerte man sich noch an das legendäre Spektakel im Vorwahlkampf mit seinem Brandbrief vom Dez. 2018 (Vorwahlkampf), wo er seine Genossen mächtig unter Druck setzte. Im Juni 2024 präsentierte er sich jedoch zwar weiterhin im roten Gewand, aber auf Fotos als Mitglied *des Bündnisses für Crivitz* und kandidierte erneut für die Stadtvertretung. Allein der ehemalige Kollege Hans-Jürgen Heine und Gründer des *Bündnisses für Crivitz* hat ihm bei seiner Kandidatur für die Stadtvertretung 2024 geholfen.
Aufgrund seiner frühzeitigen und parallelen Teilnahme an zahlreichen Unterstützertreffen der Partei des BSW war er jedoch weiterhin bestrebt, eine eigene Ortsgruppe des BSW in Crivitz zu gründen, um irgendwie eigenständig an der Wahl 2024 teilzunehmen. Es war sogar vorgesehen, dass er der Spitzenkandidat der Ortsgruppe des BSW in Crivitz wird, wie es aus gut informierten Unterstützerkreisen berichtet wurde. Jedoch blieb ihm eine Mitgliedschaft in der Partei des *BSW* bis zur Wahl verwehrt und nur Mitglieder dürfen kandidieren! Die BSW-Partei trifft eine äußerst mysteriöse Mitgliederauswahl, die einerseits verständlich ist, andererseits jedoch streng geheim bleibt. „Die BSW-Partei achtet peinlich genau darauf, Schwärmer, Glücksritter, Irrlichternde und AfD-U-Boote zu vermeiden.“ Herr Christian Grimm hat dies in seinem Artikel verständlich beschrieben. Sie nimmt stets eine Distanz zu skandalträchtigen Personen ein, die ihren eigenen Ruf beeinträchtigen könnten.
Nun kam die Wahl im Juni 2024 und der Souverän hat gewählt und entschieden. Der Ausgang der Wahl war für Herrn Alexander Gamm anders als erwartet. Er hatte wohl die Stimmung der Wähler gänzlich falsch eingeschätzt und konnte auch mit seiner eigenen Persönlichkeit beim Wähler nicht überzeugen. Es war ein schreckliches Desaster für Herrn Alexander Gamm, der lediglich 67 Wählerstimmen von den 7978 gültigen Stimmen erhielt und auf Rang 33 von den insgesamt 49 Kandidaten landete. Sicherlich war er schon zu sehr vom verwaltungstechnischen System vereinnahmt worden und aktiv in dem politischen Überbau tätig, ohne ständig den Kontext mit den Bürgern zu suchen. Und so war wohl der Traum von Ämtern und Macht ausgeträumt, er erreichte keine direkte Wahl in die Stadtvertretung.
Auch aus der Position eines *Nachrückers – Stadtvertreter* im eigenen Bündnis für Crivitz sind die Kandidaten noch zu zahlreich. Zudem gibt es einen Widerstand innerhalb des Bürgerbündnisses (BfC) Crivitz gegen die *Benennung als sachkundiger Einwohner* für Herrn Alexander Gamm in einem Ausschuss der Stadt Crivitz sodass die Benennung nicht wirklich gelang. Es ist offensichtlich, dass andere Mitglieder des Bündnisses als sachkundige Einwohner benannt wurden, was das Drama bestätigt. Angeblich soll Herr Gamm schon aus dem Bündnis ausgetreten sein, wie es aus Mitgliederkreisen heißt. Bei der Partei des BSW geht es mit seiner Mitgliedschaft ebenfalls nicht so richtig voran, wie aus Unterstützerkreisen bekannt wurde.
Eine verfahrene Lage, jedoch nahte die Rettung von der Wählergruppe der CWG aus der auch seine Ehefrau (Frau Britta Brusch-Gamm) kandidierte und bereits Bürgermeisterin wurde. Die CWG hat Herrn Alexander Gamm kurzerhand als sachkundigen Einwohner in den Bauausschuss einfach benannt und somit wird er auch bald wieder auf seinen alten Posten präsent sein. Man kennt sich untereinander hervorragend, deshalb spielt das Wahlergebnis nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es ist offensichtlich, dass er erneut die Leitung des Bauausschusses übernimmt, um anschließend an den öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung teilzunehmen und um somit ein Rede- und Antragsrecht zu erhalten.
Dann ist es endlich wieder möglich, seinen geistigen Szenejargon, den man seit Jahren kennt, wieder zu hören, der bereits zu einigen Strafanzeigen von Bürgern geführt hat.
Kommentar/Resümee der Redaktion
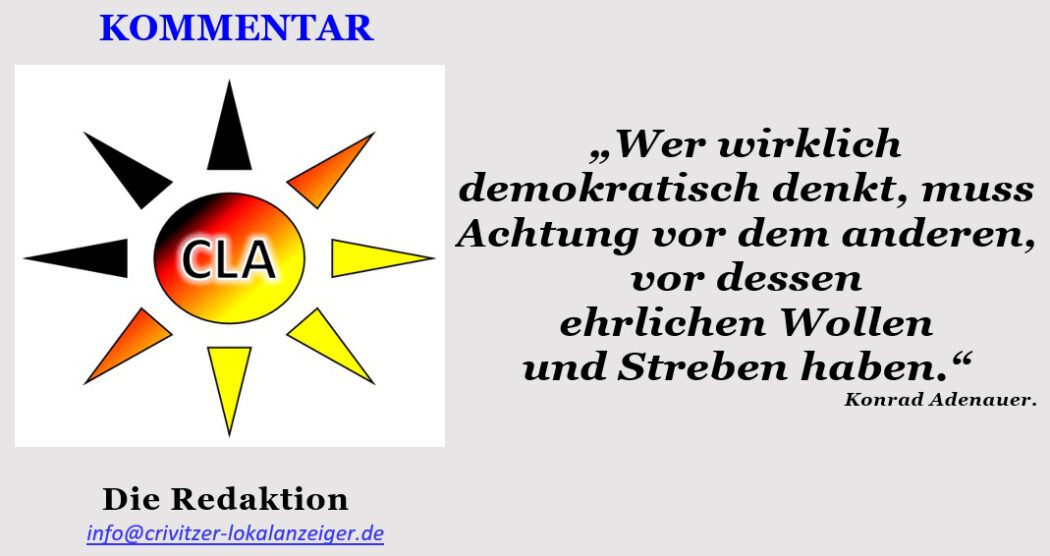
„Wer wirklich demokratisch denkt, muß Achtung vor dem anderen, vor dessen ehrlichen Wollen und Streben haben.“ Konrad Adenauer.
Was ist das für ein Schauspiel und eine Parade, die man hier in Crivitzer Stadtparlament beobachten kann? Politikinteressierte so wie Herr Alexander Gamm ohne Anschluss leben ihre hochflexiblen Meinungen beim intensiven *Parteihopping* aus. Einige verirren sich dabei jedoch gänzlich. Es ist wichtig, die Art und Weise zu analysieren, wie Herr Alexander Gamm als Bauausschuss-Chef in der Vergangenheit mit den Bürgern umgegangen ist, die eine andere Meinung zu bestimmten Themen hatten.
In der Vergangenheit wurde kein Raum für den Bürger oder Dialog geschaffen; so wollte Herr Alexander Gamm den Bürger anleiten, dirigieren und maßregeln, aber sich nicht in die vorher festgelegten Regeln und Richtlinien hineinreden lassen. Bis jetzt ist kein Dialog zustande gekommen, geschweige denn, dass Bürger mit anderen Meinungen sprechen dürften; sie wurden allenfalls als dumme Zuhörerschaft in Versammlungen dargestellt. Das wurde noch einmal durch das Wahlergebnis im Juni 2024 deutlich. Der Wähler hatte Herr Alexander Gamm wegen schlechter Leistungen mit nur 67 Stimmen abgewählt. Aber, einige Protagonisten sind einfach nicht in der Lage, loszulassen.
Ihr gesamtes Engagement wird aufgewendet, um Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu beschaffen. Natürlich geht es wieder einmal nur um Posten, Geld und Aufträge. Es ist bedauerlich, dass der Wähler, der auch Schlechtleistungen abgestraft hat, erneut betrogen wird, indem die gleichen Personen erneut wieder an Schlüsselpositionen der Macht sitzen wie zuvor.
Hätte der Wähler vorab davon Kenntnis benommen, wäre die Wahl sicherlich anders verlaufen. Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern ist von einer gewissen Endlichkeit gekennzeichnet, was die Bürger bei den kommenden Wahlen erfreuen wird.
Nach der Wahl ist vor der Wahl!

31.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./405[163(38-22)]/CLA-241/80-2024

Hochmut kommt vor dem Fall!
Es war ein herrlicher Sommertag mit Temperaturen bis 24 °C außerhalb des Atriums der Naturgrundschule Plate, aber innerhalb herrschte eine frostige Atmosphäre bei der konstituierenden Sitzung der Gemeinde Plate.
Aufgrund des in der SVZ veröffentlichten Artikels „Ärger um Briefwahlunterlagen“ (Redakteurin Katja Müller) war die Stimmung im Vorfeld zur Versammlung ohnehin angeheizt. Die Redakteurin hatte sicherlich den Blick für das Wesentliche bei Ihrem Artikel vergessen, da der veröffentlichte Einspruch zur Stichwahl im Kontext betrachtet werden sollte.
Zitat: „Zunächst wurde mir bekannt, dass diverse Plater Einwohner sich bei der Schweriner Volkszeitung über zu spät, also erst am Freitag, den 21.06.2024, zugestellte Wahlunterlagen beschwert haben.“ Hier wird ein denkbarer Anlass für den Widerspruch genannt und ein andererlautete: „Darüber hinaus wurde in Sportgruppen und durch den Austausch mit Einwohnern besprochen, dass eine kurzfristige Anmeldung zur Briefwahl nicht möglich gewesen sein soll.“( veröffentlichter Einspruch @Allris-Sitzungsunterlagen). Dies ist lediglich eine kurze Darstellung der etwaigen Beweggründe für den Einspruch.
Auch das Amt Crivitz hat den Einspruch und eine Stellungnahme bereits veröffentlicht und die Vorgänge aus Ihrer Sicht in einer Beschlussvorlage geschildert. In den veröffentlichten Artikeln der SVZ vom 26.07.2024 wird zum genauen Inhalt des Einspruches zu wenig Bezug genommen. Liebe SVZ, eine genaue Recherche ist zwar nicht immer einfach, doch manchmal ist es notwendig, vor dem Drucken zu recherchieren!
Die Zählgemeinschaft der Fraktionen der SPD + CDU haben gleich zu Beginn (9 von 15 Stimmen) gemeinsam das Postengeschacher für den 1.+2. Bürgermeister für sich entschieden, ohne auch nur einen Zweifel daran aufkommen zu lassen, wer hier in den kommenden 59 Monaten das Sagen haben wird.
Herr Niels Ihde wurde zum 1. Bürgermeister (CDU) gewählt und zur 2. Bürgermeisterin Frau Marion Funk (SPD). Bisher bekleidete Frau Funk das Amt einer 1. Bürgermeisterin, doch anders als vor fünf Jahren war sie dieses Mal bei ihrer eigenen Wahl anwesend. Damals wurde sie erst am 26.08.2019 vereidigt und ernannt. Der Unterlegene war in beiden geheimen Abstimmungen Herr Mario Gohde von der Wählergemeinschaft WGP. Die Zählgemeinschaft der Parteien zeigte keinerlei Entgegenkommen bei der Besetzung eines zweiten Bürgermeisters für das Wählerbündnis WGP. Manche Protagonisten sind nicht in der Lage, sich von der Machterhaltung zu lösen!
Dies zeigt sich auch in dem kurzen Statement des 1. Bürgermeisters Niels Ihde, in dem er betont, man wolle sachlich zusammenarbeiten, „wenn die Anträge der WGP vernünftig sind“, so könne man diesen auch folgen. Er wirkte auf dieser ersten Veranstaltung sehr angriffslustig, was sich in der Haltung zum Einspruch und in den Anfragen zur Person der Bürgermeisterin widerspiegelte.
Als Zuschauer konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die Fraktionen vorher nicht übergreifend abgesprochen hatten und dass auch nicht wollten. Schon an der Sitzordnung war zu erkennen, welche Haltung die Zählgemeinschaft der SPD+CDU-Fraktion (SPD inmitten der CDU-Fraktion) als gemeinsame Front (im Bild rechts) direkt gegenüber der Wählergruppe der WGP eingenommen hatte.
Die SPD-Fraktion stellt den Königsmacher für die CDU-Fraktion dar, da sie zwei Mandate und die CDU sieben Mandate stellt und sich gegen die Wählergruppe der WGP mit nur sechs Mandaten durchsetzt. Dies ermöglicht der SPD-Fraktion, dem einen (CDU) oder dem anderen (WGP) die Rolle des Siegers zuzuweisen; früher galt das als sogenannte Rolle der FDP, jedoch nur auf Bundesebene. Durch die verlässliche Mehrheit in den Ausschüssen der Zählgemeinschaft von SPD + CDU und den 1. und die 2. Bürgermeisterin ist SPD- Fraktion sicherlich fest an die Zustimmung und Gunst der CDU-Fraktion gebunden. Macht bedeutet eben nicht nur Abhängigkeit!
Bei der Niederschlagung des Widerspruchs/Einspruch gegen die Wahl des Bürgermeisters hatte die CDU-Fraktion bereits einen Schuldigen benannt, nämlich das Amt der Zukunft Crivitz. Herr Niels Ihde bot eine angriffslustige und publikumswirksame Darbietung. Er möchte noch einmal die internen Abläufe des Amtes Crivitz überprüfen und verwies auf die Verantwortung des Amtes in Vorbereitung auf die Stichwahl. In seiner Stellungnahme äußerte das Amt Crivitz seine Bedenken bezüglich des Einspruches nach den gesetzlichen Bestimmungen und äußerte auch Kritik an den übergroßen Tönen der CDU-Fraktion. Schließlich wurde der Widerspruch mit großer Mehrheit abgewiesen.
Als im folgenden Tagesordnungspunkt zu Anfragen von Herrn Niels Ihde, auch noch die Beschäftigung der Bürgermeisterin in Schwerin nachgefragt wurde, bestätigte sich das frostige Klima in der Sitzung und die Vorabkonfrontation, welche die CDU-Fraktion eingenommen hatte.
Die neue Bürgermeisterin zeigte sich hingegen sehr selbstbewusst und konnte nicht eingeschüchtert werden. Sie hat sich bereits in der ersten Sitzung wacker geschlagen und bringt frischen Wind in die Gemeinde Plate. Das ist ein gutes Zeichen!
Kommentar/Resümee – die Redaktion
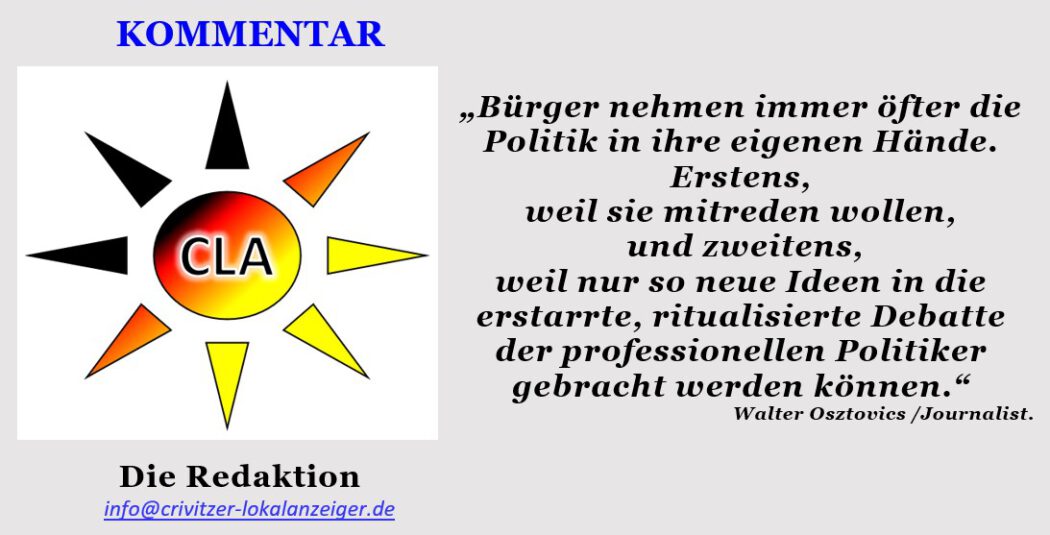
„Bürger nehmen immer öfter die Politik in ihre eigenen Hände. Erstens, weil sie mitreden wollen, und zweitens, weil nur so neue Ideen in die erstarrte, ritualisierte Debatte der professionellen Politiker gebracht werden können.“ Walter Osztovics /Journalist.
Was für eine Darbietung für den Wähler in der Gemeinde Plate!
Wie auch immer der Start in die neue Wahlperiode für die CDU+SPD-Fraktion als Mehrheitsfraktionen bewertet werden sollte, so war er an Peinlichkeiten kaum zu übertreffen. Die Begierde ist ein leidenschaftliches Verlangen, aber einige Darsteller verleihen diesem Begriff durch ihr Handeln und ihren unbedingten Postenerhalt eine gänzlich neue Gestaltungsmöglichkeit in allen Lebensbereichen.
Es gibt einige Akteure, die nicht in der Lage sind, loszulassen. Ihr gesamtes Engagement wird dafür verwendet, die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu beschaffen, als eigentlich notwendig. Selbstverständlich geht es erneut ausschließlich um Posten, Geld und Aufträge.
Die Wählergruppe der Gemeinde Plate (WGP) hat sicherlich gute Ansätze und Ideen, um zum Gemeinwohl beizutragen, doch die WGP erneut ins Abseits zu stellen, weil die Mitglieder der WGP nicht in Parteien organisiert sind, verhindert Veränderung und alles bleibt dadurch wie immer beim Alten.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Fraktionen wäre vorteilhafter, als bei der ersten Sitzung eine Dominanz der etablierten Parteien zu erleben, die die Wähler in 59 Monaten bestimmt nicht vergessen werden.
Nach der Wahl ist vor der Wahl!

28.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./404[163(38-22)]/CLA-240/79-2024
Liebe Stadtmarketing-Agentur aus Schwerin, jetzt beginnt die Arbeit erst richtig für die kommenden Jahre!

Es ist eine Verpflichtung der Politik und der Kommunalvertreter, noch mehr in das „UNESCO-Weltkulturerbe“ in Schwerin und die Infrastruktur zu investieren.
Bisher sind auf der UNESCO-Welterbeliste n die Hansestädte Wismar und Stralsund aufgeführt. Die alten Buchenwälder im Müritz-Nationalpark und auf der Insel Rügen haben den Status eines Weltnaturerbes. Die Bestrebungen, Schwerin auf die Welterbeliste zu setzen, sind bereits mehr als 20 Jahre alt.
Das Residenzensemble ist ein Beispiel für den Historismus, der verschiedene Stile verbindet. Das Schloss am See in Schwerin ist das Herzstück des Ensembles. Mitte des 19. Jahrhunderts veranlasste Großherzog Friedrich Franz II. den Umbau des Palastes, um die Geschichte des Hauses Mecklenburg-Schwerin hervorzuheben. Das Welterbe umfasst neben dem Schloss, ein Theater und Kirchen auch Militärgebäude, einen Bahnhof, eine ehemalige Schule für höfische Beamte, ein Palais, Wohnhäuser und einen Krankenpferdestall. In Schwerin entstand ein harmonisches Ensemble aus Architektur, Gebäuden und Parks, das die gesamte Infrastruktur des höfischen Lebens und der romantischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
Nun ist es endlich so weit, nach einer langen Zeit der intensiven Aktivitäten des Welterbe-Schwerin-Fördervereins. Die Mitglieder des Vereins möchten dieses Ereignis gemeinsam feiern und würdigen es mit einem vereinsinternen „Welterbefest“, zu dem der Vorstand eingeladen hat.
Dieses Fest soll ein kleines Dankeschön an alle Mitglieder und Unterstützer des Vereins sein, die sich in den vergangenen Jahren für die Bewerbung der Welterbe-Bewerbung so sehr engagiert haben. Dieser Einsatz und die Unterstützung sind für den Verein, die Stadt Schwerin und die Region von großer Bedeutung! Aber es geht auch um die Frage, was aus der engagierten Bürgergesellschaft möglicherweise in Zukunft zum Thema Welterbe beitragen werden kann.
Kommentar/Resümee- der Redaktion

„Wir sind Welterbe“ Welterbe Schwerin Förderverein
Nachdem 1918 die Monarchie in Deutschland geendet hatte, wurde das Schloss in Staatsbesitz umgewandelt. Seitdem wurde es unter anderem als Museum, Lazarett, Hauptquartier des sowjetischen Militärs und pädagogische Schule genutzt. Seit Herbst 1990 dient es wieder als Regierungssitz: Neben dem Schlossmuseum befindet sich hier der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
Die besondere Verantwortung des Landtags besteht darin, einen Landtagssitz zu besitzen, der gleichzeitig UNESCO-Weltkulturerbe ist, und die Verpflichtung, die Erhaltung auch in Zukunft zu gewährleisten.
Es ist wichtig, dass die Förderung, Erhaltung und der Schutz der Welterbestätten in Mecklenburg-Vorpommern stets im Vordergrund stehen.
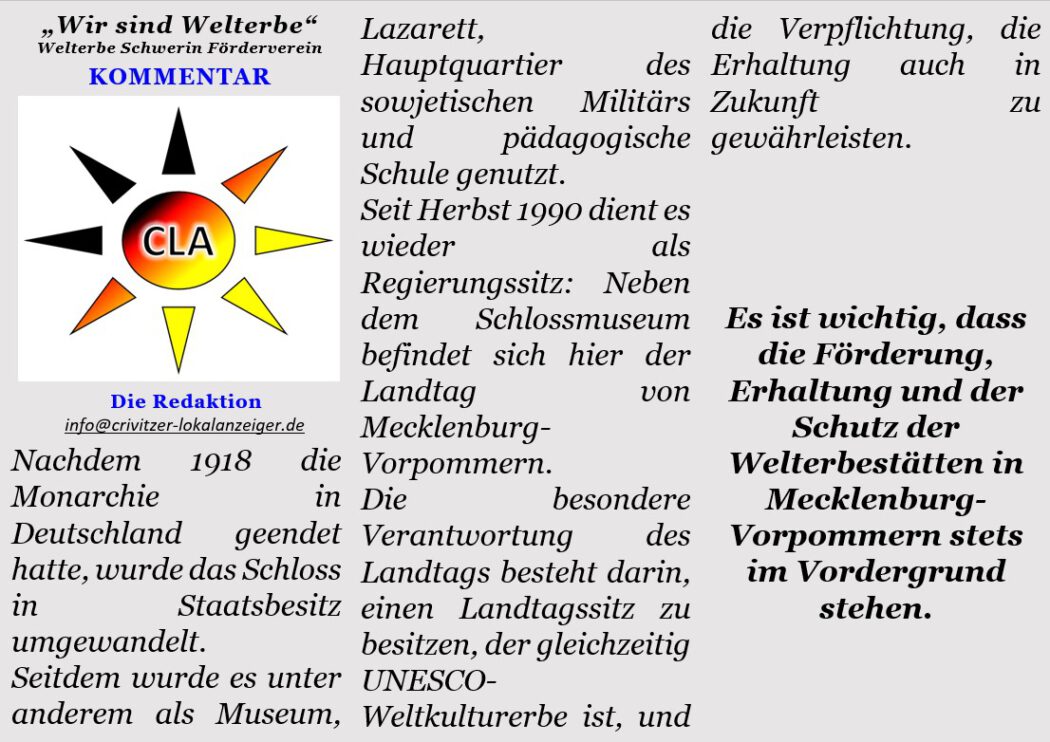
25.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./403[163(38-22)]/CLA-239/78-2024

Aus den ursprünglich geplanten Kosten von 11.900 € (2018) werden sechs Jahre später 150.000 € für ca. 26 Parkplätze auf dem ehemaligen Sparmarktgelände in Crivitz erwartet.
Das ehemalige Sparmarktgelände sollte zuerst als Parkplatz, dann als Bürogebäude genutzt werden und nun werden beide zusammenwachsen.
Am 28.08.2022 wurde verkündet, dass bereits ein Teil des Grundstückes alter Sparmarkt im Frühsommer verkauft wurde (ca. 378 m² + 322 m² + 38 m²). Der Preis betrug 55,00 €/m², also insgesamt 40.700,00 €. Weiterhin wurde durch die Stadt Crivitz dem Erwerber die Genehmigung zur Bestellung einer Grundschuld in Höhe von 1.800.000,00 € erteilt. Somit endet die unendliche Geschichte des Sparmarktes.
Man kann es eben nicht allen recht machen! So oder ähnlich könnte man das Handeln der damaligen Mehrheitsherrschaft von CWG und die LINKE bezeichnen. Sie versuchten, ihr angekratztes Image wiederherzustellen, das sie bei der jahrelangen Diskussion über den Marktplatz bei der vorhergehenden Arbeitsgruppe eingebüßt haben. Die Stadt Crivitz befindet sich in einer prekären Situation, da sie nicht in der Lage ist, ein Verkehrsraum- bzw. Parkraumkonzept zu erstellen, welches den Vorstellungen der damaligen Arbeitsgruppe *Marktplatz* entspricht. Ein sogenannter Ausweichparkplatz von 26 Parkplätzen soll die Gemüter beruhigen und die laufenden Planungen unterstützen.
Bereits am 12.12.2022 wurde beschlossen, dass auf der verbleibenden Fläche des alten Sparmarktes, der weiterhin der Stadt Crivitz gehört, insgesamt 26 neue Parkplätze entstehen sollen. Zunächst sollen die gesamten vorhandenen Flächen noch in diesem Jahr beräumt werden. Es bedurfte einer ERMÄCHTIGUNG der Bürgermeisterin und ihres Stellvertreters, um eine Vereinbarung zur Kostenteilung zwischen der Stadt und dem Eigentümer zu treffen.
Die Stadt Crivitz ist mit etwa 15.000 € an den derzeit stattfindenden Abbrucharbeiten der Betonfläche und der sonstigen befestigten Flächen beteiligt. Nachdem der Bau und die Anlegung von 26 neuen Parkflächen abgeschlossen sind, werden weitere 110.000 € fällig. Es wurde eine Planung (Kosten laut Haushaltsplan für ca. 25.000 €) von einem Architekturbüro eines Ortsteils in Crivitz erstellt.
Für die Nutzung der Fläche sind mehrere Varianten vorstellbar:
1. Freies Parken für alle?
2. Parkfläche mit Schranke und Gebühr für Dauerparker?
3. Anwohnerparken und kurzzeitige Parkflächen?
Es gibt keinen Plan zu diesem Thema, auch in der Vergangenheit nicht. Über das Thema wurde seit 2019 bis jetzt nicht im Bauausschuss oder in irgendeinem anderen Ausschuss der Stadt diskutiert. Die Stadt Crivitz hat bislang kein Verkehrs- und Parkraumkonzept erarbeitet, sondern lediglich die Parkdauer in einigen Straßen seit 2019 verlängert.
Es ist erstaunlich, dass die damaligen Mehrheitsfraktionen der CWG-Fraktion und DIE LINKE /Heine schon im Februar 2023 beschlossen haben, einen Entwurf für den Marktplatz zu erstellen. Dieser lautete: „Die Stadt Crivitz plant die Umgestaltung des Marktplatzes. Der derzeitige Zustand in Verbindung mit der Bereitsstellung von Parkmöglichkeiten unterliegt nur einer zeitlich begrenzten Genehmigung. Zudem soll der Platz ebenerdig hergestellt werden. Im Jahr 2023 werden Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt.“
Schon jetzt ist bereits klar, dass der Marktplatz als *Parkplatz* bald sein Ende finden wird. Oder doch nicht?
Kommentar/Resümee der Redaktion
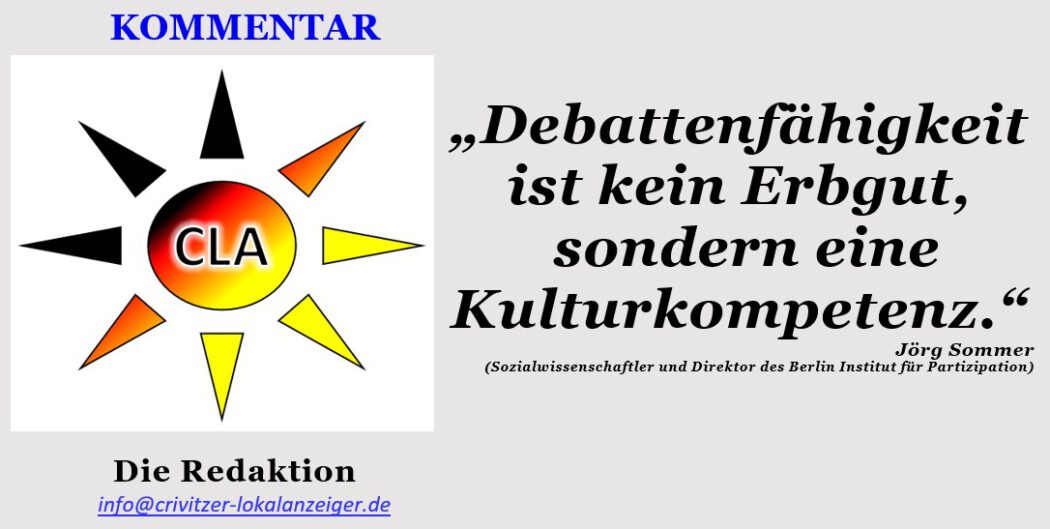
„Debattenfähigkeit ist kein Erbgut, sondern eine Kulturkompetenz.“ Jörg Sommer (Sozialwissenschaftler und Direktor des Berlin Institut für Partizipation).
Es existieren zwar noch keine Pläne für ein Verkehrs- und Parkraumkonzept, aber die Frage, wie der Marktplatz umgestaltet werden soll, wird seit 10 Jahren kontrovers diskutiert.
Der Bauausschuss unter der Führung des ehemaligen Leiters Alexander Gamm war bekanntlich darauf bedacht, dieses Thema immer zu umgehen, während andere Prioritäten auf seiner Liste standen. Insbesondere die Parkdauer und Geschwindigkeitsbeschränkungen im sogenannten Premium-Viertel von Crivitz (Vogelviertel) oder die Außenverkehrsanbindung über die Bahnschienen an das Vogelviertel. Sehen Sie sich die Pläne für Solar- und Windanlagen, die Karbonisierungsanlage oder die Pläne für die Ausgleichsflächen für die Bauarbeiten in der Neustadt an! Es gibt einige interessante Aspekte aus dem Repertuar (Repertoire) des Bauausschusses, aber ein Verkehrs- und Parkraumkonzept ist seit 10 Jahren nicht vorhanden.
Es wäre sicherlich für jeden Bürger interessant zu erfahren, welchen Status die neuen 26 Parkplätze nun einnehmen werden und wie sie genutzt werden sollten.
Wäre es nicht ebenso spannend zu erfahren, ob der Marktplatz tatsächlich in einer absehbaren Zeit nicht mehr als Parkplatz genutzt werden soll und welche Kompensationsmaßnahmen dann von der Stadt Crivitz ergriffen werden?
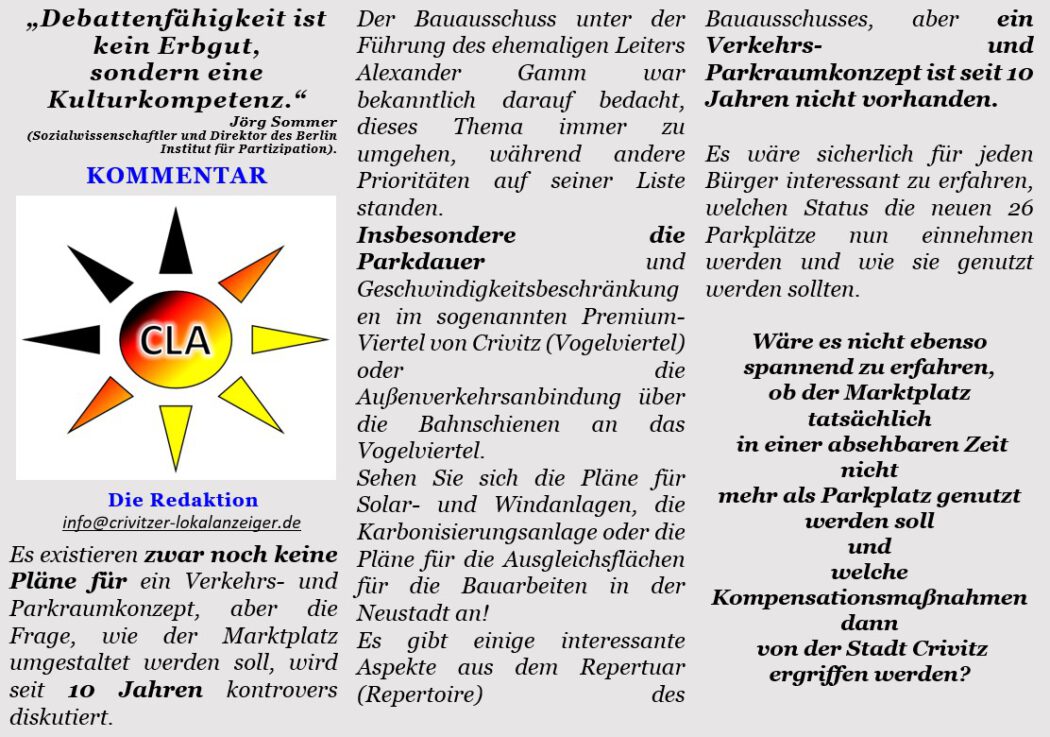
22.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./402[163(38-22)]/CLA-238/77-2024
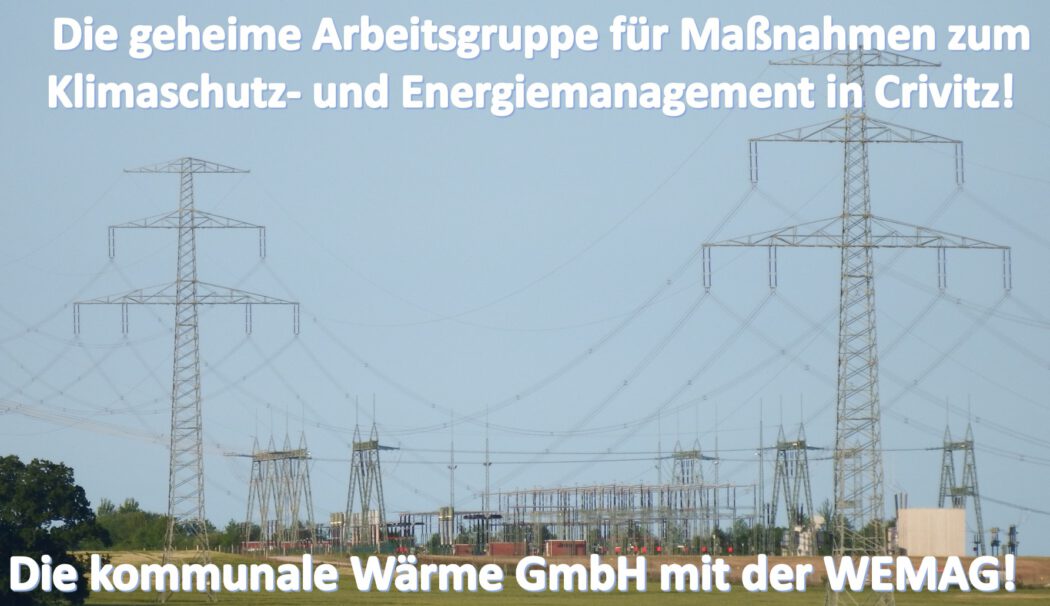
Die Geheimprojektion der kommunalen Wärme GmbH mit der WEMAG, die Windkraft sowie Solarprojekte unter anderem nutzen möchte, um Strom zu produzieren. Es ist die Lieblingsbeschäftigung von Alexander Gamm, um sich wieder als Vorreiter in der Arbeitsgruppe (Klimaschutz- sowie Energiemanagement) und in der Stadtvertretung zu positionieren. Doch wie soll das funktionieren, wenn er bisher nicht einmal vereidigt ist und (nicht öffentlich) über Angelegenheiten der Stadt Crivitz verhandelt? Eigentlich geht das gar nicht und nur mit der Zustimmung der anderen Fraktionen, da das in keinerlei Hinsicht der Kommunalverfassung entspricht. Doch wo kein Kläger, da ist auch kein Richter!
In Crivitz ist einiges möglich, was anderswo unmöglich wäre und alle schauen zu!
Kaum ist die Sitzung der Stadtvertretung beendet, da schwillt die Brust von Herrn Gamm erneut an. Nachdem die Fraktionen von CWG + BfC+ CDU ihn in die nicht öffentliche Arbeitsgruppe aufgenommen haben. Was für eine Farce, denn eigentlich sollten in diesem Ausschuss nur gewählte Stadtvertreter sein, aber die Bürgermeisterin und der 2. Bürgermeister Herr Hartmut Paulsen (CDU-Fraktion) machten sich besonders stark dafür, Herrn Alexander Gamm zu integrieren.
Die Argumentation stützte sich darauf, dass er ja bald in die Stadtvertretung einfach benannt wird als sachkundiger Einwohner der CWG-Fraktion im Bauausschuss, wodurch angeblich die Stadt repräsentiert wird. Ist es wirklich so, dass man dann automatisch in der Stadtvertretung sitzt? Eigentlich nicht! Denn die Stadtvertretung setzt sich nur aus den *gewählten Bürgern* zusammen, welche als Stadtvertreter bezeichnet werden.
Für die CWG + BFC und CDU-Fraktion ist dies inakzeptabel, deshalb haben sie die Hauptsatzung dahin gehend angepasst, sodass sie lautet: „Die Vertretung der Bürger führt den Namen Stadtvertretung Crivitz, die Mitglieder der Stadtvertretung führen die Bezeichnung Stadtvertreter“. Ein Kuddelmuddel ohne Gleichen, mit einem ganz bestimmten Ziel; hier wird der benannte sachkundige Einwohner von den Fraktionen zu einem Mitglied der Stadtvertretung bestimmt. Dies bedeutet, dass diese lediglich von den einzelnen Fraktionen benannt wurden, jedoch nicht vom Bürger gewählt wurden.
Diese Maßnahme ermöglicht es, dass der Ehemann (Alexander Gamm) von der Bürgermeisterin Frau Brusch-Gamm wieder an Schlüsselpositionen gesetzt wird, damit er etwas zu sagen hat, obwohl er anscheinend nicht mehr Mitglied im Bürgerbündnis BFC ist und auch bisher nicht Mitglied im Partei-Bündnis Sahra Wagenknecht ist.
Die Tätigkeit der nicht öffentlichen Arbeitsgemeinschaft [AG] Strom und Wärme seit 2022 (Vorsitz – damals-Alexander Gamm auch Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine und Bauausschussleiter) in Crivitz blieb weitgehend im Verborgenen. Öffentliche Veranstaltungen oder Diskussionen der AG über das Thema wurden in der Regel vermieden, da sonst unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen aufeinandertreffen könnten. Nur einmal auf einem Unternehmerforum 2023, an dem nur einige Teilnehmer anwesend waren und nicht die großen Schlüsselunternehmen von Crivitz, präsentierte er seine persönlichen Vorstellungen von einer gemeinsamen Wärmegesellschaft mit der WEMAG – AG. Es ist offensichtlich, dass er sich für dieses Projekt begeistern und einbringen würde, obwohl es hierzu nur spärliche und oberflächliche öffentliche Erklärungen gibt. In den Crivitzer Ausschüssen findet hierzu keine öffentliche Debatte zu diesem Thema statt, sondern nur Ankündigungen.
Allgemein hierzu ist lediglich bekannt, dass die Gemeinden Barnin und Zapel und Crivitz eine gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG AG gründen wollen. Die technische und kaufmännische Verantwortung dieser Gesellschaft soll hauptsächlich in der Hand der WEMAG – AG liegen. Die entscheidenden Absprachen sollen hierzu bereits im Spätherbst 2023 getroffen worden sein.
Die Gemeinde Pinnow hat einen Ausschuss in ähnlicher Form gebildet, aber er wurde öffentlich gemacht und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bürger zu den Themen Klimaschutz- und Energiemanagement der Gemeinde einzubinden.
In der Stadt Crivitz ist die Situation gänzlich anders, hier ist ein solcher Ausschuss geheim und es geht lediglich um Posten und wer etwas zu sagen hat.
Kommentar/Resümee – die Redaktion
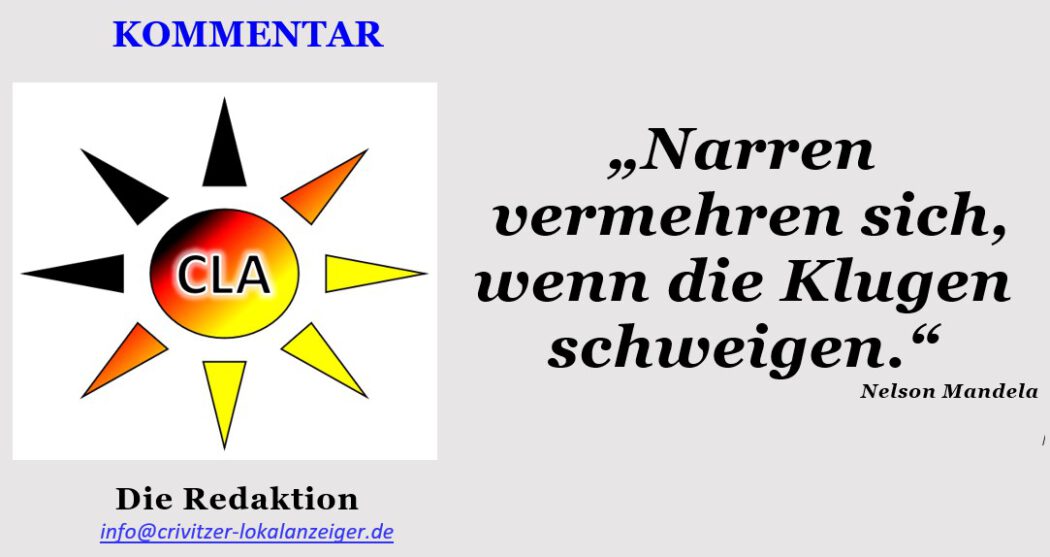
„Narren vermehren sich, wenn die Klugen schweigen“. Nelson Mandela
Das Projekt in Crivitz soll eine „BLAUPAUSE“ wie in Goldberg werden, die auch angeblich für die Umlandgemeinden Barnin/Zapel bald gelten soll! Angeblich sollen diese beiden Windkraft- und Solarprojekte sowie Abfälle aus Biogasanlagen liefern!
Das technische Schema in Goldberg war anfangs so gedacht, dass die WEMAG Flächen und Gebäude auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft anmietet und pachtet, um dort ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu errichten. Dieses wird auf Basis von Biogas betrieben. Der Rohstoff Rohbiogas wird nicht nur von der Agrargenossenschaft produziert, sondern auch die Wärme, die in einer Biogasanlage entsteht, soll in Goldberg genutzt werden. Beides will man auch weiterhin in Goldberg ausbauen und nutzen, aber hauptsächlich um Strom zu erzeugen.
Ob die Blaupause von Goldberg so funkeln wird in der Stadt Crivitz, bleibt abzuwarten. Die Stadt Crivitz hat leider keine eigene kommunale Genossenschaft, die den Wohnungsbau fördert. Die Verlegung einer Fernwärmeleitung bis in die Neustadt wird in Zukunft Millionen in Crivitz verschlingen und große Überzeugungsarbeit bei den privaten Eigentümern erfordern.
Es ist erstaunlich, wie weit fortgeschritten die Planungen und Absprachen bereits sind und diese nehmen dann so richtig Fahrt auf ab Anfang Oktober 2024. Wenn die Windparkprojekte in Westmecklenburg vorliegen („Energiepark-“ Wessin) und die Planungen für die 110 KV – Leitung und Solarprojekte in Crivitz beginnen werden.
Der normale Bürger erhält diese Information lediglich in Halbsätzen, während ansonsten alles in einem streng geschützten, nicht öffentlichen Bereich liegt. Wie man es seit Jahren gewohnt ist, ist die Transparenz nicht die Stärke der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und auch nicht von Herrn Alexander Gamm. Dies hat er in der letzten Wahlperiode jahrelang praktisch bewiesen. Der einstige Windkraftgegner wurde zum selbsterklärenden Experten für Klimaschutz.
Wenn solche Projekte wirklich abgeschlossen werden sollten, sind die Steuerzahler in der nächsten Generation dafür dann verantwortlich.
Warum werden dann alle Informationen geheim gehalten?

19.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./401[163(38-22)]/CLA-237/76-2024

Ein besonderes Ereignis, das mindestens drei Unterbrechungen oder „Auszeiten“ erforderte, um es mit den Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden zu sagen, wie im Volleyball. Für Außenstehende fühlte es sich zumindest so an. Der erste Satz wurde klar gewonnen und verging wie im Flug. Der zweite und dritte Satz zog sich aufgrund der fehlenden einheitlichen Spielführung bei den verschiedenen Fraktionen hin und her. Herr Rene Witkowski begleitete die Sitzung der Stadt Crivitz, wobei sein Fachgebiet eigentlich die Zahlen im Amt Finanzen und nicht das Verwaltungsrecht /Wahlrecht sind, denn Frau Lenk und Frau Brinker waren in der Gemeinde Friedrichsruhe beschäftigt und eher beschaulich unterwegs.
Aufgrund einer internen vorherigen Abstimmung von CWG mit der CDU und BFC natürlich ohne Beteiligung der AfD- Fraktion wurde Herr Markus Eichwitz (CWG – Fraktion) zum 1. Bürgermeister gekrönt, der eigentlich nur 308 Wählerstimmen errang und in der Gesamtplatzierung auf Platz 6 der Wählergunst in Crivitz liegt. Nun ist er also der Bedienstete des Amtes Crivitz als Amtswehrführer und gleichzeitig der erste Bürgermeister in Crivitz, während Frau Brusch Gamm in zweifacher Funktion seine Vorgesetzte ist. Einmal als Bürgermeisterin und dann als Vorsitzende des Amtsausschusses. Was für eine gelungene Kombination aus Amt und Mandat, so schreibt eigentlich die Gewaltenteilung vor, das Gebot einer strikten Trennung zwischen Amt und Mandat?
Herr Hartmut Paulsen (CDU-Fraktion) hat ein ähnliches Schicksal. Aufgrund der vorherigen Übereinstimmung der Fraktionen der CWG mit der CDU und BFC wurde er als zweiter Bürgermeister gewählt, obwohl er lediglich 309 Stimmen erhielt und eigentlich auf Platz 5 der Wählergunst rangiert. Auch er ist Bediensteter der Stadt Crivitz und im Arboretum Verein tätig und hat soeben Frau Brusch – Gamm als Doppelvorgesetzte in Form als Bürgermeisterin und Arbeitgeberin vor sich.
Was ebenfalls für eine gelungene Kombination spricht, da es sicherlich keine Widersprüche in der Zukunft geben wird!
Ob diese Postenbesetzungen jedoch das Ergebnis der Wahlen und den Wählerwillen widerspiegeln, bleibt wirklich fraglich! Wenn sich die Fraktionen vorher im kleinen Kämmerlein verabredet haben, einen Einklang zwischen CWG+ BfC +CDU zu erreichen und dabei einfach eine Fraktion ausschließen. Durch diese Herangehensweise hat sich wieder einmal die CWG- Fraktion die Mehrheit gesichert, da sich die CDU-Fraktion (3 Sitze) jetzt wieder ganz nahe bei der Bürgermeisterin befinden. Somit wirkt hier auch das alte Prinzip * Divide et Impera* (Teile und Herrsche) für die nächsten 5 Jahre! Obwohl die ausgeschlossene Fraktion der AfD mehr Stimmen erhielt, was zu Platz 2,4 und sieben in der Rangfolge der Wählergunst führte. (783, 316 und 295 Wählerstimmen).
Es kam zu weiteren Unterbrechungen in der Sitzung, da die AFD-Fraktion nicht in die Vorbereitung der Ausarbeitungen der neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung einbezogen wurde. Denn die AfD-Fraktion unterbreitete inzwischen Vorschläge, die die anderen Fraktionen überforderten, die darauf nicht vorbereitet waren. Die CWG +BfC+CDU-Fraktion hatte es schwer, dem Ganzen zu folgen, weil man selbst nicht im Thema war. Sie waren jedoch nicht abgeneigt, diese Vorschläge zu akzeptieren. Schau einmal an, das hätte man auch früher haben können, wenn man die Fraktion eingebunden hätte.
Die Verabschiedung der Hauptsatzung war kurz vor dem Scheitern und so beschloss man, eine Nothauptsatzung zu verabschieden und alle eingereichten Anträge der AfD bis September zu diskutieren. Gleiches gilt für die eingereichten Anträge der AfD-Fraktion zur Geschäftsordnung. Als nun endlich die Entscheidung über die Besetzung der Ausschusssitzungen getroffen wurden sollten, war man bestrebt, ein Losverfahren zu vermeiden, doch wie soll man es machen, wenn man vorher nicht mit einer Fraktion gesprochen hat? Der erste Vorschlag war, dass sich die Fraktionsvorsitzenden noch einmal zusammensetzen und eine einvernehmliche Lösung finden sollten.
Die CWG-Fraktion lehnte es jedoch ab und drängte auf eine sofortige Entscheidung. Also gab es wieder eine sogenannte Auszeit und dann einigte man sich darauf, dass einige Fraktionen auf bestimmte Sitze verzichten sollten.
Es war merkwürdig, dass die CWG-Fraktion erneut ankündigte, Herrn Alexander Gamm in einen Ausschuss als sachkundigen Einwohner zu benennen, damit er dann widerspruchslos wieder als Mitglied der Stadtvertretung einzieht. Zitat: „Dann ist er wieder Mitglied der Stadtvertretung.“
Also alles wieder beim Alten und der Haussegen scheint dann auch etwas ruhiger zu verlaufen. Da Alexander Gamm während der Pause mächtig im Hintergrund agierte in der BfC-Fraktion, was man deutlich an seiner Mimik und Gestiken in den Agitationen (erstaunliche Herangehensweise) erkennen konnte.
Kommentar/Resümee-die Redaktion!
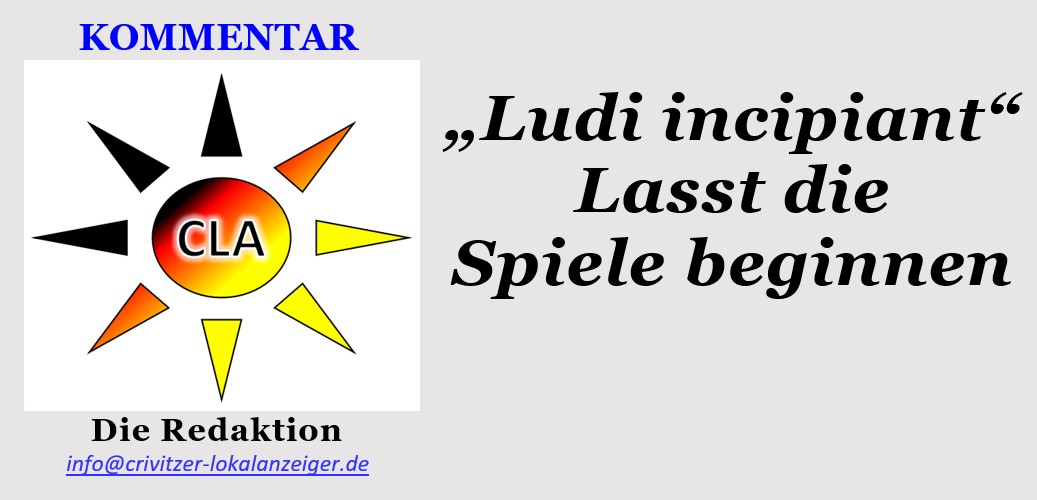
„Ludi incipiant“ Lasst die Spiele beginnen
Es ist schon erstaunlich, dass man sich zunächst zusammensetzt, ohne die AFD-Fraktion einzuladen und die Posten einfach abzusprechen und hinterher bedauert, dass die Kommunikation indessen so ist, wie sie ist. Die CWG-Fraktion hat angekündigt, sich zu bessern. Denn nun hat auch die Bürgermeisterin plötzlich eingestanden: Zitat: „die Telefonnummer der AfD Fraktion wurde korrigiert“ und die schriftliche Korrespondenz ist plötzlich auch aufgetaucht. In der die AfD – Fraktion zu einer Zusammenarbeit aufgefordert hatte. Dies ist wenig hilfreich, wenn vorher die Posten bereits vergeben wurden.
Was für ein Schauspiel soll das sein?
Die Posten sind wieder wohlwollend verteilt worden und es scheint, dass sich alles wieder beim Alten befindet und der Ehemann Alexander Gamm ist auch wieder gut untergebracht!
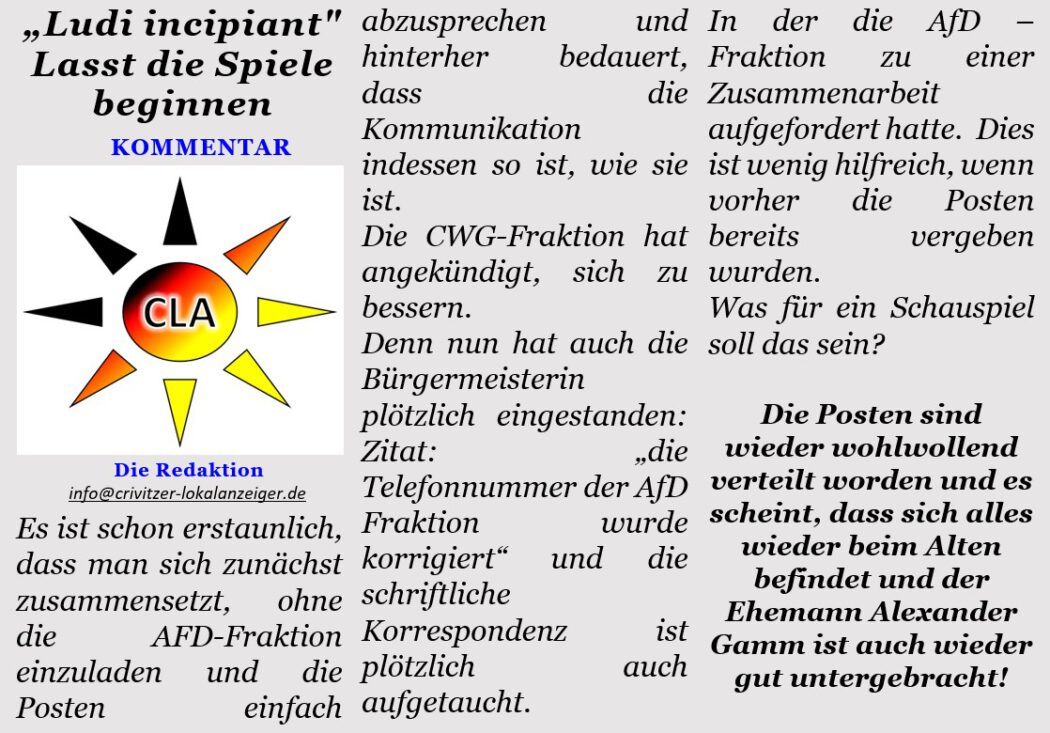
14.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./400[163(38-22)]/CLA-236/75-2024
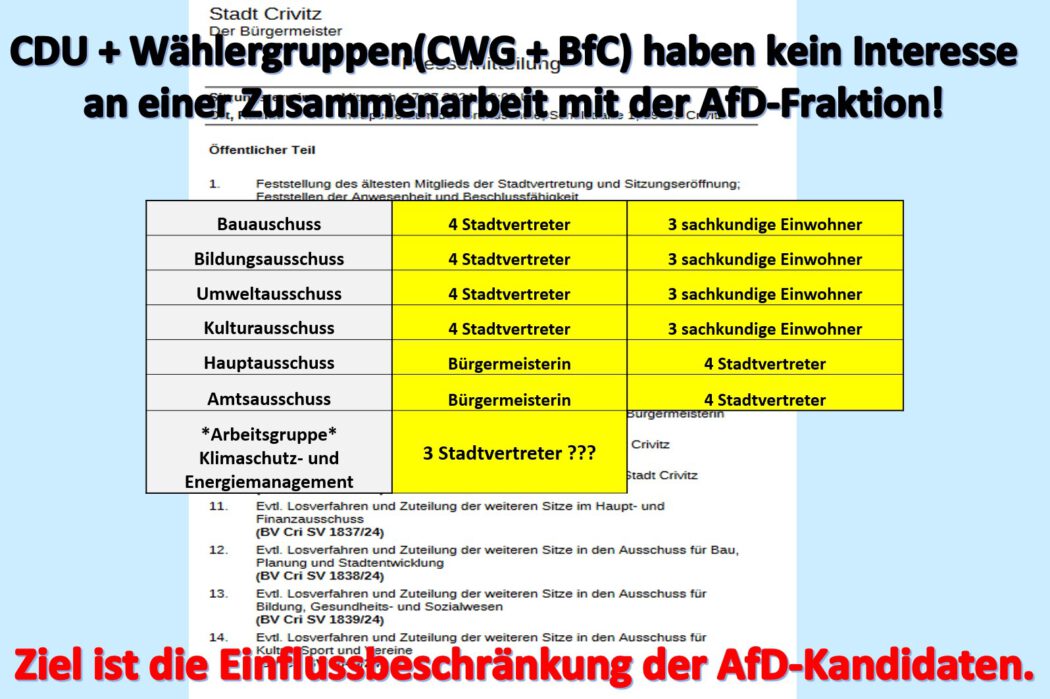
Auch in Crivitz herrscht Blockadestimmung!
Höhere Teiler bei Wahlen, Zuteilungen + Benennungen für die Fraktionen sollen nicht gewählte Akteure von CDU und Wählergruppen CWG + BfC wieder auf alte Positionen verhelfen! Dazu findet in Crivitz auch ein Postengerangel um die Macht in den Ausschüssen im Separee oder im Dunkeln statt, ähnlich wie in Schwerin, um die AFD gänzlich auszubooten?
Beim Wahlsystem in der Crivitzer Stadtvertretung werden einfach die höheren Teiler 1,3,5,7 verwendet, um die größte Oppositionskraft (AfD-Fraktion) bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen zu verhindern. Wie in Schwerin ist eine einvernehmliche Lösung und Diskussion mit der AfD-Fraktion gänzlich nicht erwünscht.
Trotz schriftlicher Aufforderungen seit mehreren Wochen und mündlicher Nachfragen der AfD-Fraktion besteht seitens der Altparteien und Wählergruppen in Crivitz kein Interesse, sich mit der AfD-Fraktion über die Besetzung der Ausschüsse einvernehmlich zu einigen. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, hat die AfD-Fraktion die Stadtspitze schriftlich aufgefordert, frühzeitig mit den Fraktionen Gespräche zu führen, um eine einvernehmliche Lösung für die Kandidaten in den Ausschüssen und die 1.+2. Bürgermeisterkandidaten zu finden. So hatte sie sogar schon frühzeitig einen Antrag für die konstituierende Sitzung zum Inhalt der neuen Hauptsatzung am 17.07.2024 eingebracht.
Es war wohl nicht erwartet worden, dass die größte prozentuale Oppositionskraft (21,34 %) AfD-Fraktion in Crivitz die neue Wahlperiode mit einem gemeinsamen Ansatz von Lösungen gestalten würde und dazu auch noch Gespräche anbietet. Bedauerlicherweise ist das Gegenteil eingetreten, da die Entwürfe der neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung bereits fertiggestellt sind und der Inhalt eine andere Sprache spricht. Es kam bisher nicht zu einer Abstimmung unter den Fraktionen, zumindest nicht mit der AfD-Fraktion, wie es aus AfD-Kreisen zu hören war.
Es wurde sicherlich eine Einigung zwischen CDU und Bürgerbündnissen erzielt, die dann auf das sogenannte Zuteilungs- und Benennungsverfahren setzen werden, um den AfD-Kandidaten einen möglichst geringen Einfluss in den Ausschüssen zu gewähren.
Die Zuteilung (für die Sitze in den Ausschüssen) richtet sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zueinander. Das Verhältnis wird gemäß § 9a der Geschäftsordnung dadurch ermittelt, dass die Mitgliederzahl der jeweiligen Fraktion nacheinander durch eins, drei, fünf, sieben usw. geteilt wird und die Sitzverteilung nach den so ermittelten Höchstzahlen erfolgt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. Da auch die CDU-Fraktion und das Bürgerbündnis BfC die gleichen Höchstzahlen wie die AfD-Fraktion haben, wird es vermutlich viele Losverfahren zu den einzelnen Ausschüssen geben. Die Fraktionen erklären gegenüber dem Bürgermeister, mit welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze besetzen. Dies können Mitglieder der Partei oder des Bürgerbündnisses sein oder auch andere Bürger.
Und schon sind wieder die alten bekannten Akteure im Spiel und können wieder weiterhin fünf Jahre lang schalten und walten. In der Regel wird das in der Sprache der schreibenden Zunft und der Medien als Brandmauer gegen die AfD bezeichnet.
Alle gegen einen, nicht nur als Samstagsshow, sondern täglich fünf Jahre lang!
Kommentar/Resümee – die Redaktion
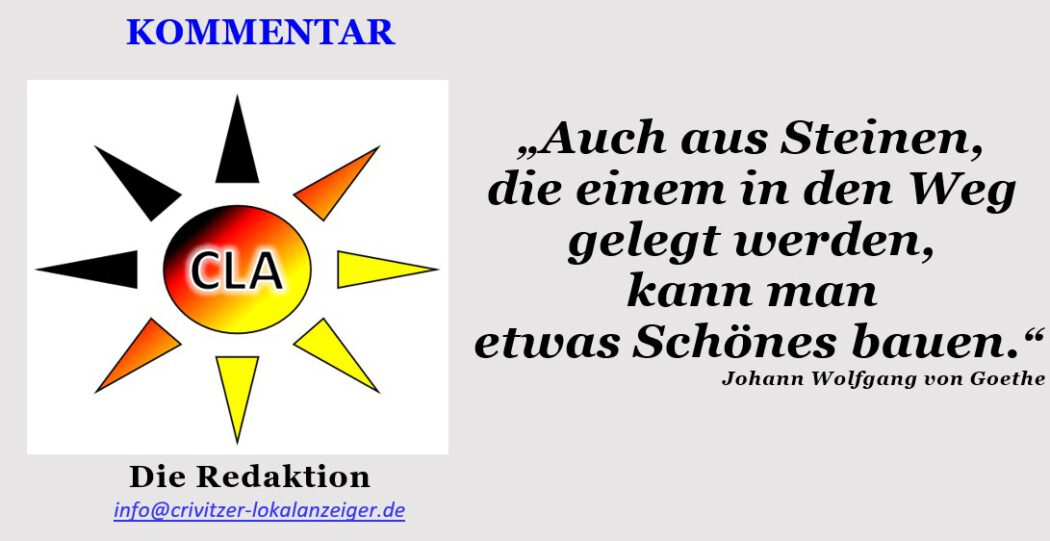
Wie auch in Schwerin zur Oberbürgermeisterwahl 2023 haben sich alle Parteien gegen die AfD gestellt. Dies gilt auch für die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung 2024 in Schwerin bei der Besetzung der Ausschüsse und des Stadtpräsidenten, um die AfD zu verhindern. So schreibt auch der Landtag MV in seinem umstrittenen Beschluss vor wenigen Tagen vor, dass alle gewählten Vertreter in MV aufgefordert werden, die Kandidatinnen und Kandidaten antidemokratischer Parteien oder Vereinigungen nicht in Ämter oder Funktionen zu wählen und nirgendwo in MV mit der AfD zusammenzuarbeiten. In allen Belangen sollte man sich gegen die AfD stellen. Ungeachtet dessen handelt es sich um eine Art Doppelmoral, denn auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gibt es Ausschussvorsitzende der AfD.
Nur wem nützt diese undemokratische Herangehensweise bei der Lösung von Problemen in den Gemeinden sowie Städten und ist es nicht ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung?
Auch die CDU – Crivitz und Umland sowie die Wählergruppen der CWG + BFC haben diesen Aufruf bisher befolgt und fühlen sich dabei hervorragend. Was man sicherlich in der Stadtvertretung in den kommenden Tagen erleben kann.
Wie immer geht es vorrangig um die Sicherung von alten Posten und die Wiederherstellung des alten Status der Macht! Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern ist von einer bestimmten Endlichkeit geprägt, was die Bürger sicherlich bei den kommenden Wahlen wie Bundestag oder Landtag erfreuen wird.
Ein bekannter Chefredakteur hat in seiner Kolumne vor wenigen Monaten die folgenden Aussagen getroffen: „Wie schrieb gestern ein Leser in der ‚Bild‘ sinngemäß?“ Die AfD braucht gar nichts zu sagen. Die Wahlwerbung für sie liefern die anderen Parteien frei Haus.“
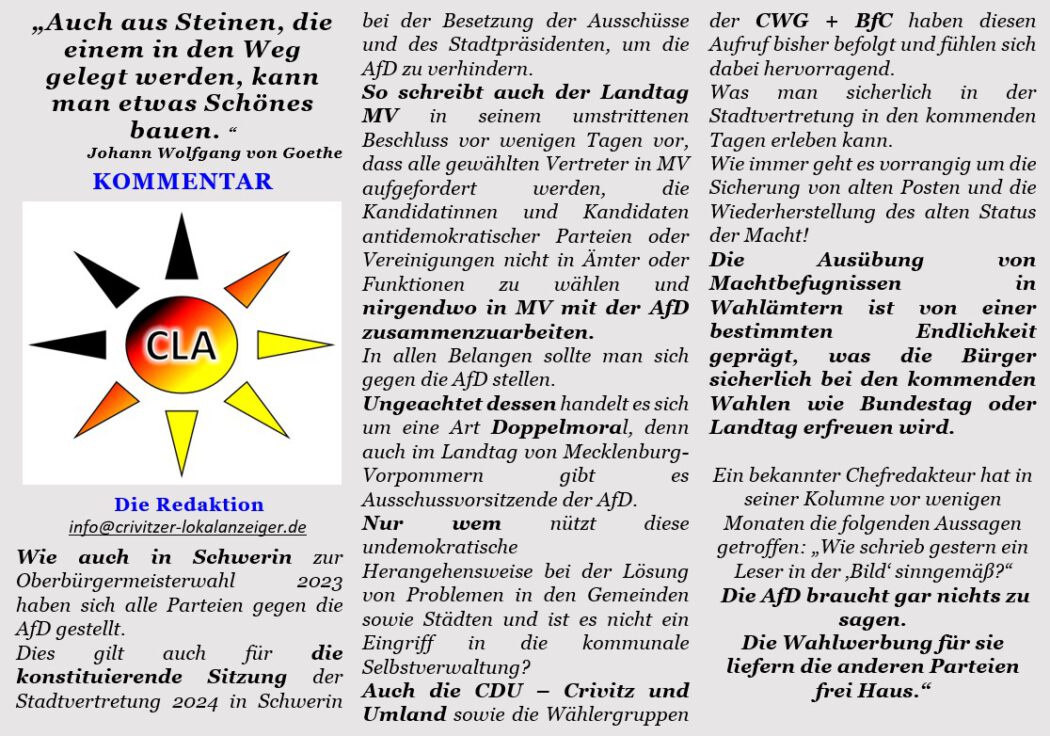
12.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./399[163(38-22)]/CLA-235/74-2024

Seit fünf Jahren wird das Schul- und Kita-Essen von den Mehrheitsfraktionen der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und der Fraktion DIE LINKE/ Heine mit einem bestimmten Essenanbieter dominiert. Jede Kritik an diesem Projekt wurde im Keim erstickt, indem die Verträge per Order de Mufti verlängert und Preiserhöhungen jeglicher Art sofort genehmigt wurden. Die CDU-Fraktion Crivitz und Umland, die damals noch die stärkste Oppositionskraft in der Stadtvertretung stellte, beteiligte sich auch an diesem Hin und Her, ohne dass einzelne Vorgänge hinterfragt wurden.
Die Verträge mit der Fa. Schwerin Menü GmbH und der Stadt Crivitz wurden für den Zeitraum ab 01.08.2019, mit einer Option auf Verlängerung bis zum 31.07.2023, abgeschlossen. In den vergangenen 60 Monaten ist im Bildungsausschuss so viel Ungeklärtes und Verschleiertes zum Thema Schul- und Kita-Essen aufgetaucht, wie schon lange nicht mehr. So informierte der Bildungsausschussvorsitzende Jörg Wurlich (selbst Lehrer in der Grundschule in Crivitz) bereits im Dezember 2021 über Mängel in der Essensversorgung der Schüler, vordergründig in der qualitativen Versorgung und über bevorstehende Preiserhöhungen. Er schilderte damals, dass die Qualität des Schulessens in der Grundschule sehr nachgelassen hat. Die vereinbarten Qualitätsstandards für das Büfettessen und die Problematik Einweg/Mehrweg wurden nicht eingehalten.
Zu diesem Zeitpunkt gab es auch das erste Mal ein Eingeständnis, dass man 2019 viel zu früh und voreilig die Verträge mit der Firma UWM in Demen gekündigt hatte. Eine verspätete Einsicht.
Im Jahr 2022 hat das Unternehmen Schwerin Menü GmbH einen Antrag auf eine erstmalige Preiserhöhung in der Essensversorgung an die Bürgermeisterin gestellt. Aufgrund der gestiegenen Preise für Gas, Strom und Kraftstoff sowie der Lieferengpässe bei Lebensmitteln, dem Fachkräftemangel und den gestiegenen Lohn- und Produktionskosten. Der Antrag wurde innerhalb von 10 Tagen von der Bürgermeisterin sofort genehmigt. Erst im Nachgang wurden dann einige Gesprächstermine für die Einrichtungen vereinbart. Schließlich wurde im März 2023 eine erneute Ausschreibung für das Essen in der Schule und Kita beschlossen. Das Ausschreibungsverfahren sollte ab Mai 2023 beginnen.
Im Juli 2023 wurde das angekündigte Ausschreibungsverfahren durch die Bürgermeisterin und ihre Stellvertreter in ein angebliches „Interessenbekundungsverfahren“ umgewandelt, da sich angeblich niemand gemeldet hat, außer dem jetzigen und derzeitigen Anbieter „Schwerin Menü“. So wurde per oder de Mufti von der Stadtspitze kurzerhand der Vertrag mit dem Unternehmen Schwerin Menü verlängert und lediglich die Tatsache nur noch bekannt gegeben.
Nach eingehender Recherche unserer Redaktion im Amtsbereich Crivitz und im Landkreis LUP bei anderen Anbietern für Schul- und Kita-Essen im August 2023 wurde festgestellt, dass sie nicht über das Interessenbekundungsverfahren informiert waren oder gar beteiligt wurden.
Der Bildungsausschuss wollte das Thema bis zum Januar 2024 nicht auf die Tagesordnung setzen, obwohl er wusste, dass die Firma „Schwerin-Menü“ erneut eine Preiserhöhung ab Januar 2024 angekündigt hatte. Die Erhöhung der Löhne durch das Tarifvertragsgesetz und die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 7 % auf 19 % waren die angeblichen Hauptgründe für die Preiserhöhung für Speisen in Schulen und Kitas!
Nach einer kurzen Recherche wurde festgestellt, dass in der Kita „Uns Lütten“ keinerlei Essenskommissionen mehr existieren. Die entsprechenden Eltern waren ausgeschieden, da deren Kinder zur Schule gekommen sind. Bei Problemen mit dem Essen sollten sich die Eltern oder andere Betroffene an die Leiterin wenden, um ein persönliches Gespräch zu führen. Was das sollte und wozu versteht kein Mensch, aber sicher, um alle kritischen Meinungen vorher zu filtern und kleinzureden.
Im April 2024 bemängelte der Landkreistag MV, dass er die Elternmitsprache stärken wolle, unter anderem auch bei der Verpflegung, für die die Eltern zahlten, aber bisher kein Mitspracherecht bei der Auswahl des Essensanbieters hätten, obwohl sie Vertragspartner seien. Insofern ist der Wunsch der Eltern nachvollziehbar, hier entscheidend Einfluss zu nehmen.
So ist es im neuen vierten Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes MV seit Mai 2024 § 22 Abs. 4 geregelt: „Im Vorfeld der Entgeltverhandlungen und bei zwischen zeitlichen Änderungen muss der Träger der Kindertageseinrichtung mit dem Elternrat das Benehmen über die Essensversorgung der Kinder, einschließlich der Auswahl des Essensanbieters, und die Höhe der Verpflegungskosten herstellen.“ (…..) „Darüber hinaus ist dem Elternrat unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die nach § 24 Absatz 1 und 3 getroffenen Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt und deren Umsetzung sowie die Anzahl und den Umfang des im Entgelt verhandelten Personals zu erteilen.“ Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber in MV den Wunsch hegt, dass Eltern mitreden können. Zum Beispiel bei Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Bezahlung“
Wahrscheinlich war dies der Grund für die stillschweigende Vertragsverlängerung der Stadtspitze der Altfraktionen der CWG und der LINKE/Heine mit der Firma Schwerin Menü, da sonst zu viele Fragen oder Kritik entstehen würde, oder?
Kommentar/Resümee – die Redaktion
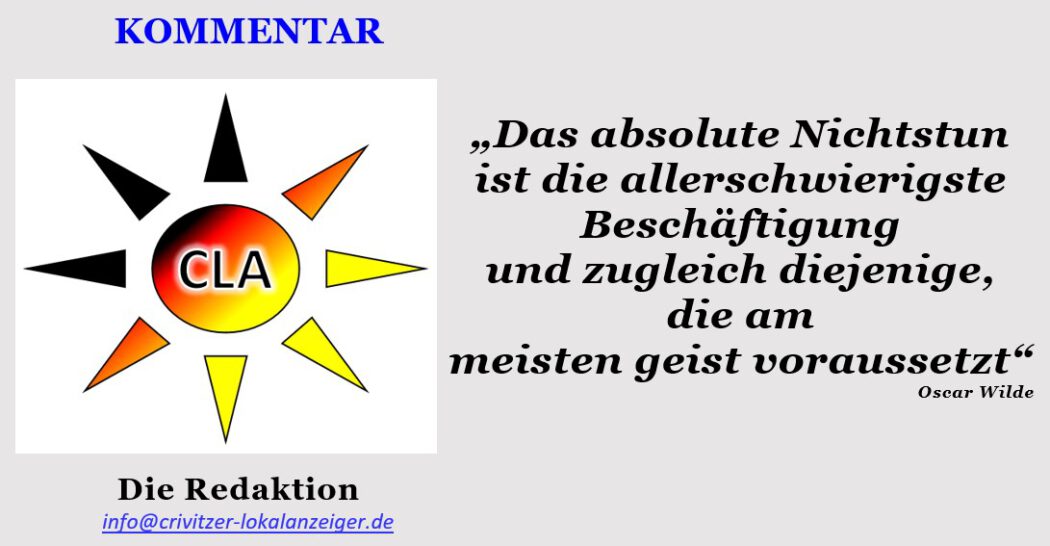
Obwohl die Stadt Crivitz der Schul- und Kitaträger ist, hat sie genügend Gremien geschaffen, wie z. B. die Essenskommissionen, die regelmäßig in den Ausschüssen der Stadt über ihre Arbeit berichten sollten, als Schnittstelle zwischen Essensanbieter und Einrichtung.
Es ist an der Zeit, die Essenskommission in der Kita neu zu aktivieren und zu wählen, da steigende Kosten auch eine entsprechende Qualität des Essenanbieters mit sich bringen müssen! Zu diesem Zweck müssen die Eltern auch ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Essensversorgers in jeder Einrichtung haben. Nach etwa fünf Jahren mit demselben Essenanbieter könnte ein Preisvergleich verschiedener Anbieter von Vorteil sein und dringend empfohlen werden. Eine Privilegierung eines Angebots aufgrund persönlicher Befindlichkeiten einzelner Mandatsträger in der Stadtvertretung bei der Auswahl des Essensanbieters sollte vermieden werden.
Es ist tatsächlich notwendig, sich angesichts der finanziellen Schwierigkeiten vieler Eltern, die sich derzeit mit dem Thema befassen, Gedanken darüber zu machen, ob es sinnvoll wäre, das Schul- und Kita-Essen von der Stadt Crivitz zu subventionieren.
Wieso trägt nicht die Stadt Crivitz die Kostensteigerung von 1,00 € pro Mahlzeit für die Eltern? Es ist unbestritten, dass das Geld im Haushalt ausreichend vorhanden ist. Wenn man nur an die jährlichen 60.000 € Repräsentationskosten denkt, kann man auch die Preissteigerungskosten für die Eltern tragen. Oder?
Also zögern Sie nicht, es einfach zu tun, sehr geehrte neuen Stadtvertreter. Einfach mal machen! Oder?
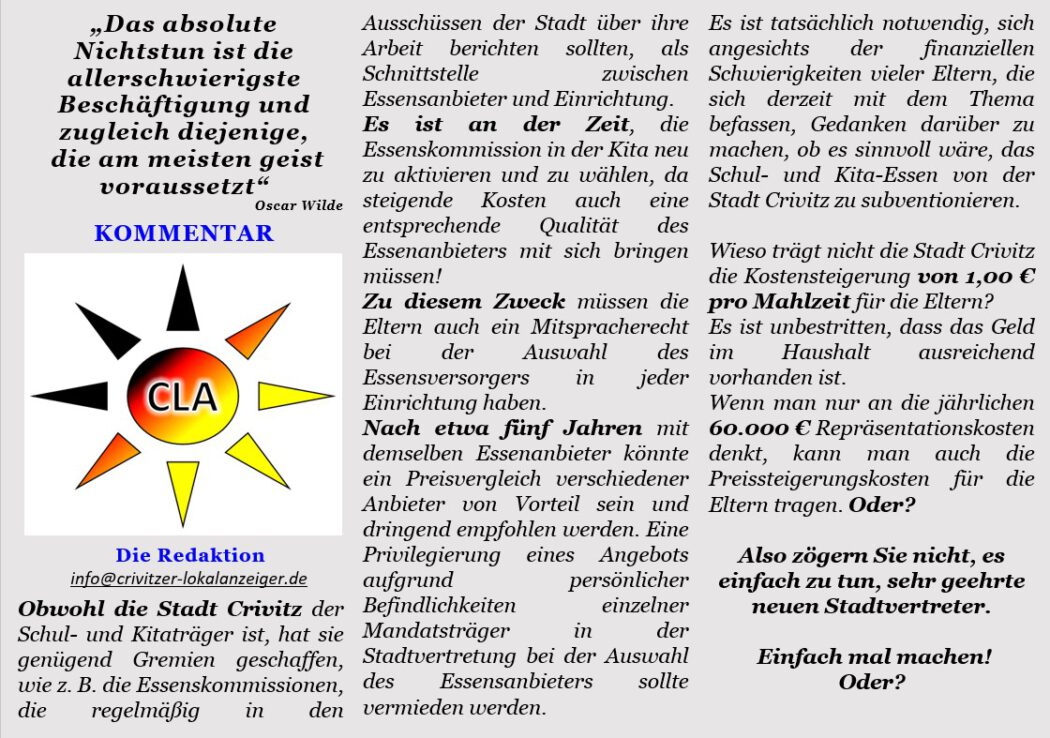
10.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./398[163(38-22)]/CLA-234/73-2024
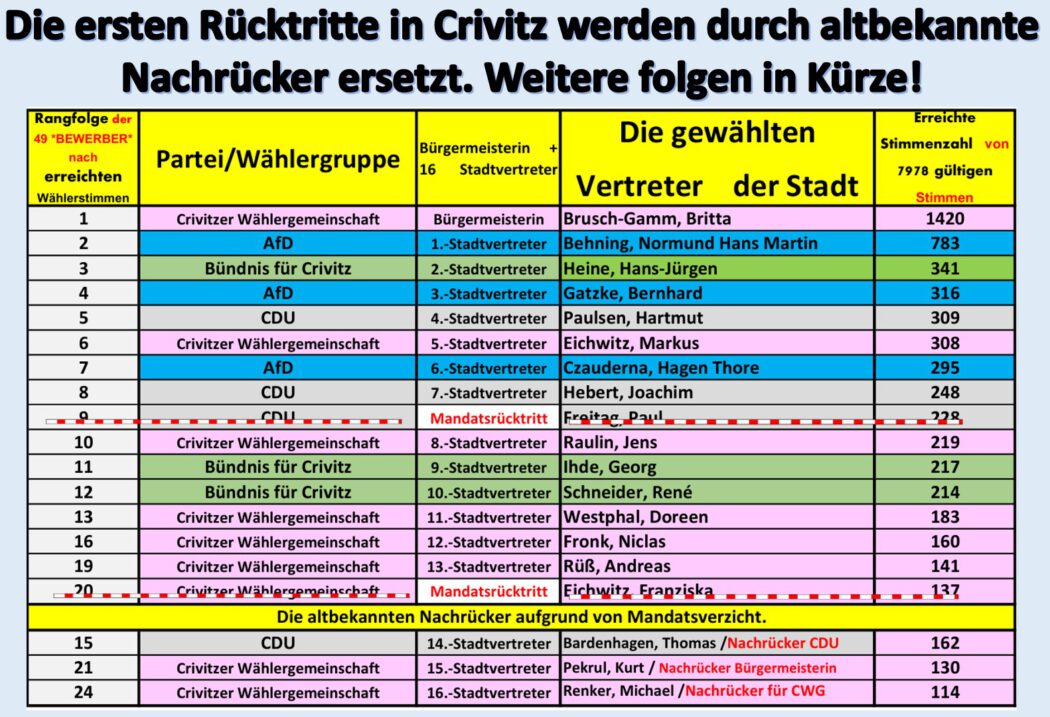
Ist es ein Postengeschacher der Altfraktionen oder ein Betrug am Wähler?
Bei der Besetzung eines Mandatsverzichts werden wie gewohnt die altbekannten taktischen Nachrücker auf den Listen begünstigt, anstatt sie gleich mit befähigten Personen zu ersetzen?
Das sogenannte bekannte Stühlerücken (Mandatsverzicht) ermöglicht es altbekannten Akteuren, ihre bisherigen Positionen erneut als Nachrücker im Stadtparlament zu besetzen. Obwohl sie eigentlich deutlich weniger Stimmen erhalten haben, geht es ihnen eben um Macht. Das Wählerinteresse wird durch die Tatsache zusätzlich verzerrt, dass der eigentlich gewählte Abgeordnete einen Auftrag erhalten hat und nicht der sogenannte Nachrücker. Diese Tatsache wird auch als sogenannte Zugkraft (Publikumsmagnet) bezeichnet, die das Schiff verlassen. Doch genau das ist das Versprechen vor der Wahl und danach!
Um die Situation zu verdeutlichen.
Ein gewählter Abgeordneter in einem Stadtparlament hat von seinen Wählerinnen und Wählern einen Auftrag erhalten. Er oder sie sollte die Interessen der Wähler und Wählerinnen im Stadtparlament vertreten. Sofern ein gewählter Abgeordneter eines Stadtparlaments sein Mandat nicht annimmt, verzichtet er auf sein Mandat (den Auftrag, den die Wähler ihm gegeben haben). Das ist dann ein Mandatsverzicht.
Es ist zu erwarten, dass die CDU-Fraktion erneut Änderungen an der Zusammensetzung der Fraktion vornehmen wird, da der gewählte Stadtvertreter Herr Hartmut Paulsen sowohl Mitglied des Kreistags als auch gleichzeitig Bediensteter der Stadt im ARBORETUM ist. Dies führt zwangsläufig zu Befangenheiten in vielen verschiedenen Sachthemen und Angelegenheiten und wird sicherlich zu einem Mandatsverzicht in der Stadtvertretung führen, was jedoch vermutlich bereits vor der Wahl einkalkuliert wurde. Allerdings wurde dem Wähler diese Information bestimmt vorenthalten.
In der Fraktion des Bürgerbündnisses Bündnis für Crivitz werden sich möglicherweise ebenfalls Veränderungen ergeben. Einerseits macht Herr Alexander Gamm von Hinten mächtig Druck, andererseits ist Herr Georg Ihde wieder in den Kreistag gewählt worden und wird mit großer Sicherheit auch als weiterer Vertreter der Stadt Crivitz in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweriner Umland gewählt. Er hat beide Funktionen sehr lange ausgeübt, und diese erfordern viel Aufmerksamkeit, sodass auch hier sicherlich ein Mandatsverzicht in der Stadtvertretung von Crivitz erfolgen wird.
Die Redaktion/Fazit:
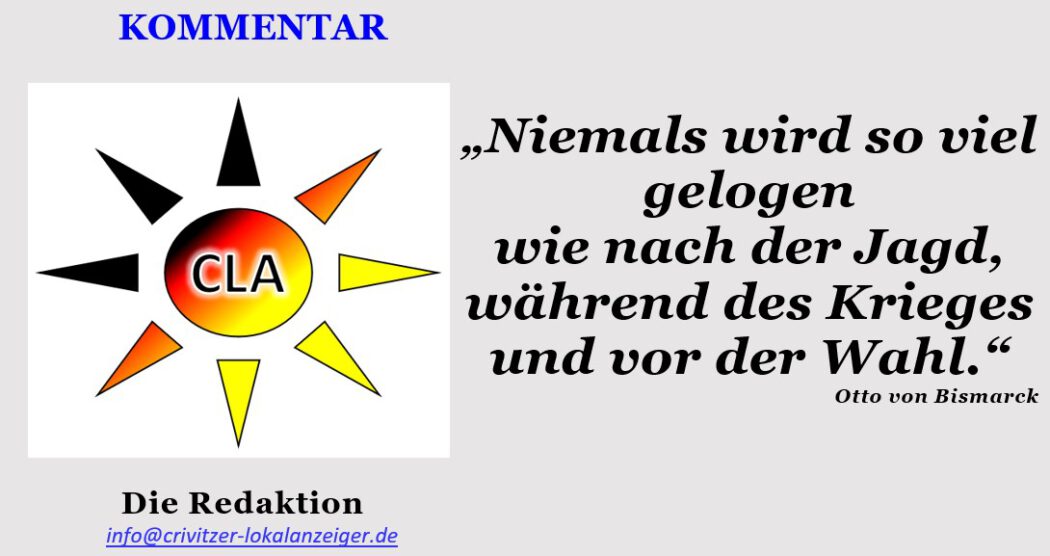
Schauen wir uns mal an, welche Abgeordneten in der Stadtvertretung von Crivitz bis zum Beginn der ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause (im Monat August 2024) noch verblieben sind. Die ehemaligen Gewählten, die einen Auftrag vom Wähler erhalten haben, und die Nachrücker, die neu hinzugekommen sind.
Bis dann endlich die alte Stadtvertretung wieder komplett ist wie vor der Wahl.
Danach ist dann bestimmt alles wieder beim Alten!
Also ein weiter so!
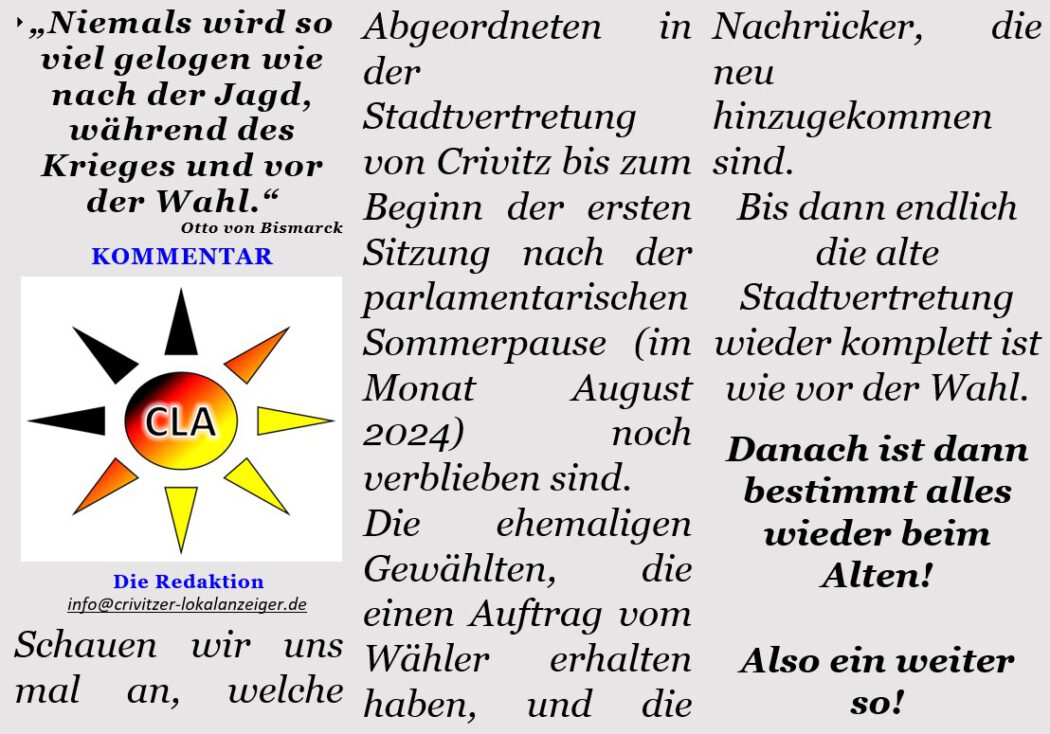
07.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./397[163(38-22)]/CLA-233/72-2024

Die Anschlussfähigkeit einer Windkraftanlage an das Stromnetz ist die neue Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung.
Zur Freude der WEMAG und E.DIS AG stellt die Netzanschlussfähigkeit nun ein wichtiges Kriterium für Baugenehmigungen bei Windanlagen dar! 10 Jahre lang suchte der Planungsverband Westmecklenburg nach dem Zauberwort, gegen das man sich nicht mehr wehren kann und das schnellere Genehmigungsverfahren für Windeignungsflächen ermöglicht. Der regionale Planungsverband Westmecklenburg hat bereits am 19. Juni bis 15. September 2024 eine öffentliche Auslegung in der vierten Stufe des Beteiligungsverfahrens beschlossen. Dazu gehört der Entwurf für die Teilfortschreibung des regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg für das Kapitel 6.5 Energie und der dazugehörige Umweltbericht.
Die Schwierigkeiten im regionalen Planungsverband Westmecklenburg beim Thema Windenergie sind hausgemacht. Das ganze Hin und Her geht schon seit 2014 und inzwischen steht der Verband vor einem Scherbenhaufen seines eigenen Handelns! Damals hatten der ehemalige Vorsitzende des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Herr Rolf Christiansen und sein Stellvertreter Thomas Beyer (beide SPD-Fraktion) einen Beschluss im Verband mit herbeigeführt, ein ganz bestimmtes Windeignungsgebiet zu streichen. Gegen diese Herangehensweise wurde erfolgreich geklagt wegen eklatanter verwaltungsrechtlicher Fehler und seitdem wird an diesem Plan herumgebastelt, mit fatalen rechtlichen Folgen. Der Plan hat bis heute keine Rechtskraft oder eine vergleichbare Zielsetzung. Eine neue überarbeitete Planung bis 2027, die sowohl neue Flächen als auch stark aufgeweichte Artenschutzkriterien und ein neues Kriterium, die „Netzintegrationsfähigkeit“ berücksichtigt, soll soeben die Rettung bringen.
Das war der O-Ton auf der letzten Sitzung des Planungsverbandes im Monat April 2024. Hierzu wurde eigens ein neues Kriterium im Plan für die Abwägung geschaffen, ob bereits eine geeignete Stromnetzinfrastruktur in Windparkgebieten vorhanden ist oder nicht, um Windeignungsgebiete gesamtsystemisch effizient mit der geeigneten Stromnetzinfrastruktur erschließen zu können.
Das bedeutet, wo bereits Netzverknüpfungspunkte existieren (früher Umspannwerke) oder Leitungen vorhanden sind, sollen verstärkt Solar- und Windeignungsgebiete ausgewiesen und geplant werden. Dies betrifft insbesondere Görries (Schwerin – Süd), Parchim – Süd, den Ortsteil Wessin (Stadt Crivitz) und das Umland. Es geht primär darum, neue Kapazitäten für die Integration der neuen Windenergieanlagen in das Netz zu erschließen, wobei es nicht um die Synchronität von Erzeugung und Verbrauch geht, sondern nur die reine Anschlussfähigkeit.
Somit dürfte bereits das Urteil für Gemeinden und Ortsteile wie den Tourismus-Ortsteil Wessin, die sich direkt an Netzverknüpfungspunkten (früher Umspannwerke) befinden, ergangen sein. Denn das bedeutet, dass sämtliche Solar- und Windenergieanlagenplanungen [ENERGIEPARK – Wessin] an diesen Orten äußerst intensiviert werden und diese bald schon ihre endgültigen Genehmigungen erhalten.
Die abgehobene Arroganz des Entwurfs des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wird im Dokument für die Zusammenfassung der wesentlichen Argumente unter dem Absatz: „Schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept, Ausschluss- und Restriktionskriterien“ zum Bereich der „Großvögel“ zum Ausdruck gebracht. Zitat: „Eine regionsweite Durchführung von Funktionsraumanalysen überall dort, wo ein erhöhtes Kollisionsrisiko vermutet wird, ist auf Ebene der Raumordnung zudem weder leistbar noch geboten bzw. sinnvoll.“
Man könnte das auch so deutlich übersetzen, dass es im Prinzip so heißt: Wir haben keine Lust, eine genaue Untersuchung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durchzuführen sowie auch nicht die Mittel. Daher planen wir einfach und fertig! So einfach ist es im Jahr 2024!
Ist die Gewinnmaximierung wirklich wichtiger als unser Naturerbe?
Kommentar/ Resümee
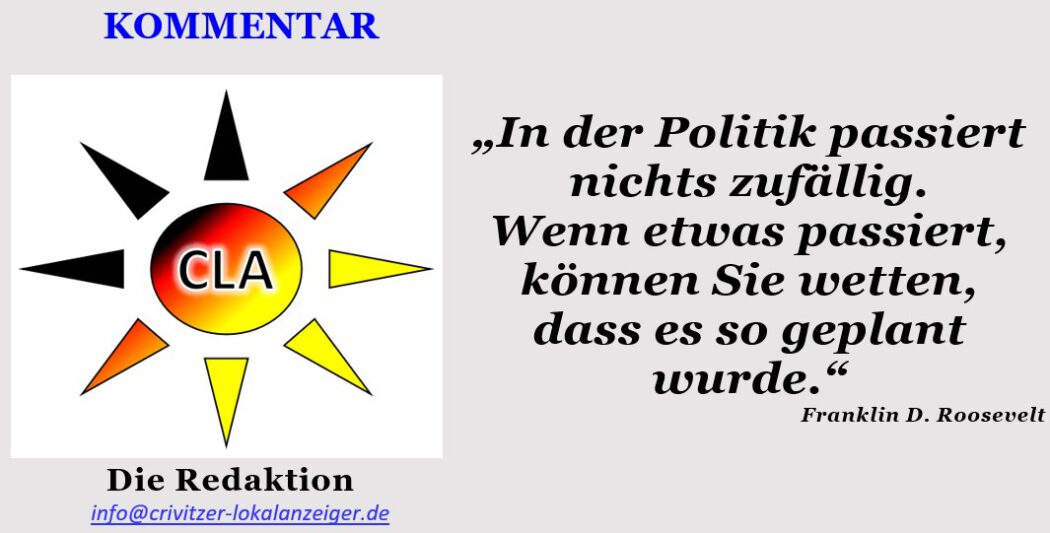
„In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie wetten, dass es so geplant wurde.“ Franklin D. Roosevelt!
Der teils dramatische Rückgang von Vogelpopulationen hat unterschiedliche Gründe: Lebensraumverlust, Pestizide, Nahrungsmangel, Prädatoren, Landschaftsfragmentierung, Straßen- und Eisenbahnverkehr, Verkabelung, Stromschlag, Glas-Kollisionen und als neue gravierende Todesursache die Windkraft.
Doch was geschieht heute?
Windkraft um jeden Preis: Anti-Naturschutzgesetze und Verordnungen: – Investitionsbeschleunigungsgesetz; Wind-an-Land-Gesetz (WaLG); vierte Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes; EU-Notfall-Verordnung; Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; Änderung des Baugesetzbuchs Änderung des Raumordnungsgesetzes; Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes usw. … usw. …
„Alternative Energieerzeugung ist sinnlos, wenn sie das zerstört, was man durch sie schützen will: Die Natur.“ Reinhold Messner!
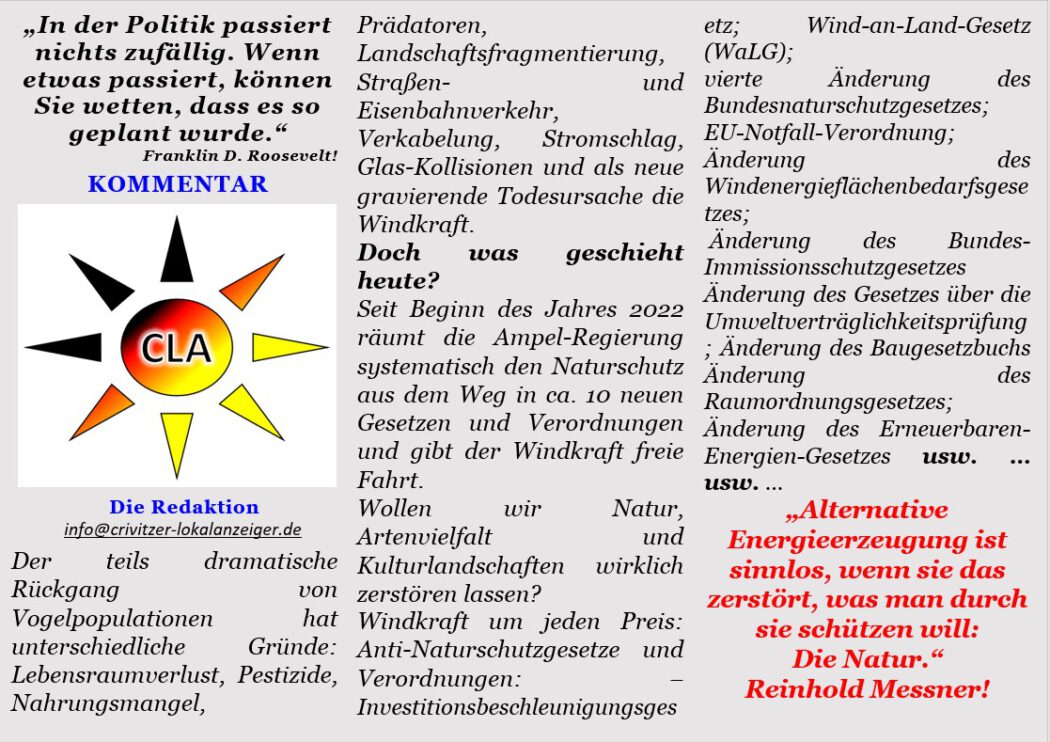
04.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./396[163(38-22)]/CLA-232/71-2024

Mit Fingerfood und ganz privat (außerhalb des Protokolls) persönlich mit der Chefin. Oder handelt es sich wieder um ein Sponsoring der ganz besonderen Art? Natürlich sind interne Absprachen unvermeidlich!
Unsere Erinnerung wird wach!
Am 29.10.2022 fand der erste Workshop Perspektive Bürger* zum Thema Innenstadt *Marktplatz im Volkshaus Crivitz statt. Eine überschaubare Anzahl von 26 Besuchern waren gekommen (wenn man die Mandatsträger und Bediensteten abzieht, waren es sogar nur 13). Ob das eine repräsentative Bürgerbeteiligung für Planungsentscheidungen darstellte, ist jedem selbst überlassen! Es stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Teilnehmer nicht in der Innenstadt von Crivitz wohnte und auch nicht mehrmals wöchentlich in der Stadt einkaufen ging! Ist das nicht merkwürdig? Sind dann Aussagen zum Thema noch repräsentativ? Der Hinweis, dass zunächst die Grundsatzfrage (Parkplatz) geklärt werden sollte, wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber stand nicht mehr zur Diskussion.

Es wurde eine Laudatio auf den erreichten Titel „Die engagierte Stadtgesellschaft“ gehalten und ein Film gezeigt, der bereits in den sozialen Medien veröffentlicht worden war. Also, wir sind wirklich großartig! Wir sind fantastisch! Danach bestand die Möglichkeit, allgemeine Anregungen, Ideen und Probleme zum Thema darzulegen. Plötzlich traten einige Mandatsträger (Alexander Gamm, ehemaliger Bauausschussvorsitzender und Andreas Rüß, Fraktionsvorsitzender CWG) aus den Teilnehmern hervor und erklärten – alles „WAS NICHT GEHT“! Also 30 km/h-Zone ist nicht machbar! Innenstadt-Verkehrsfluss ordnen als 30 km/h. Geht auch nicht. Ein Verkehrskonzept oder Parkraumkonzept wird erst im Jahr 2023 beauftragt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen. Es ist schon ungewöhnlich, wenngleich am Anfang der Veranstaltung ein Deckel aufgesetzt wurde, was alles unmöglich macht. WIE es gehen würde, wäre hilfreicher gewesen!
Was sollte das Ziel sein?
Folglich befand man sich mit der damaligen Veranstaltung bereits in einer vorgezogenen Bürgerbeteiligung, die einmal die Perspektive der *Bürger*, *Unternehmer* und Mandatsträger darstellte, um daraus einen Vorentwurf zu erstellen und in Auftrag zu geben. Anschließend soll dann die Stadtvertretung eine Entscheidung treffen und einen Grundsatzbeschluss fassen. Danach erfolgt unmittelbar eine Auftragserteilung für eine Planung. Nach Erhalt des Entwurfs versucht man dann, auf unbekannte Weise einen Fördertopf für Altstädte oder Städtebauförderung zu finden, um hierfür eine Beschreibung und Planung darzustellen. Erst dann sollten finanzielle Mittel in die praktische Umsetzung fließen, weil man selbst keine mehr zur Verfügung stellen kann.
So wurden Entwürfe in verschiedenen Gruppen erarbeitet und präsentiert. Die folgenden Gemeinsamkeiten als Schwerpunkte enthielten: – eine Vielzahl von Fischen soll platziert werden – keine parkenden Autos auf dem Marktplatz – viel mehr Bäume sollten gepflanzt werden; –mehr Rosensträuchern an den Häusern – mehr Bänke sollten aufgestellt werden – ein Brunnen soll installiert oder die Fischregenskulptur aufgestellt werden – Barrierefreiheit soll geschaffen werden – Mehr Platz für die außen Gastronomie soll ermöglicht werden– Möglichkeiten für Spaziergänger und Spielmöglichkeiten sollen geschaffen werden. So war auch zu hören, dass der heutige Marktplatz von den damaligen Stadtvertretern ca. 1993 (die auch aktuell 2024 ein Mandat in der Stadtvertretung wieder erhalten haben) nur deshalb so entworfen und gestaltet wurde (also die sog. Höher Setzung des Marktplatzes), um die vielen Autos fernzuhalten. Was Ihnen bisher jedoch nicht gelungen ist!
Es ist erstaunlich, kurios und erneut skurril, dass die Mehrheitsfraktionen der CWG-Fraktion in Einheit mit der Fraktion DIE LINKE /Heine bereits im Februar 2023 im Haushaltsplan beschlossen haben, eine Entwurfsplanung längst in Auftrag zu geben, ohne die Unternehmer zu fragen. „Die Stadt Crivitz plant die Umgestaltung des Marktplatzes. Der derzeitige Zustand in Verbindung mit der Bereitsstellung von Parkmöglichkeiten unterliegt nur einer zeitlich begrenzten Genehmigung. Zudem soll der Platz ebenerdig hergestellt werden. Im Jahr 2023 werden Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt.“ Hier ist klar, dass der Marktplatz ebenerdig hergestellt werden soll und es keine Diskussion mehr gibt, da bereits Gelder für einen Planentwurf bereitgestellt wurden. Auch im Februar 2024 wurden noch einmal 10.000 € im aktuellen Haushaltsplan eingeplant, aber dieses Mal für den Umbau vom Marktplatz!
Die Unternehmer werden wahrscheinlich die Ersten sein, die einen Entwurf der Planung am 17. Juli 2024 im Bürgerhaus zu Gesicht bekommen werden, natürlich ganz privat, mit der Chefin und ohne die Stadtpolitik. Es fällt auf, dass man bereits plant, diese in Gruppen einzuteilen, um so ihre Vorstellungen vorzutragen, wie es bei den ersten Veranstaltungen vor etwa 36 Monaten der Fall war. So ganz ohne die Politik, mithilfe von Repräsentationskosten von wem auch immer!
Kommentar/Resümee
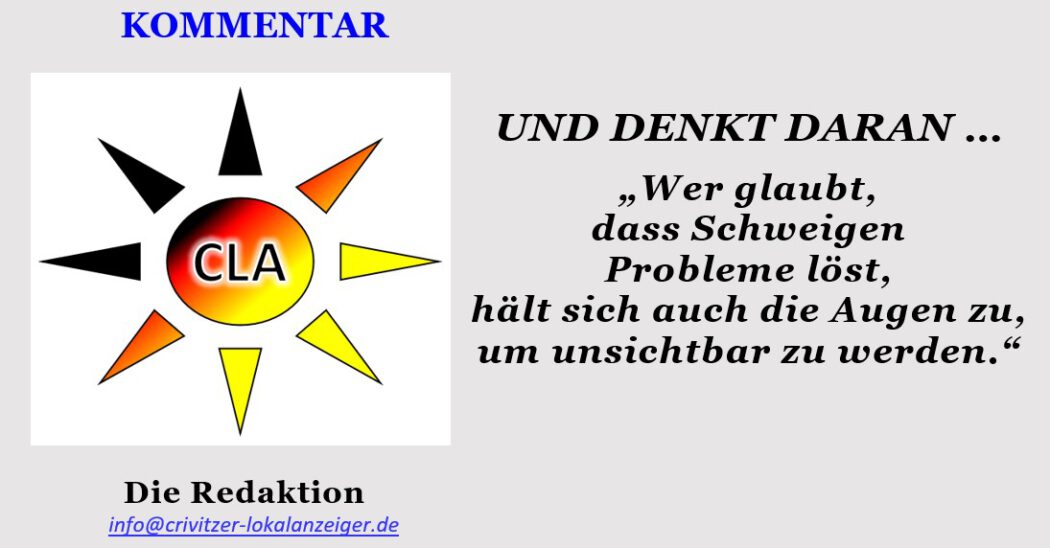
UND DENKT DARAN … „Wer glaubt, dass Schweigen Probleme löst, hält sich auch die Augen zu, um unsichtbar zu werden.“
Die Stadt Crivitz hat bisher kein Verkehrs- und Parkraumkonzept erarbeitet, sondern lediglich die Parkdauer in einigen Straßen verlängert. Alles nur Augenwischerei, oder ist das Geld bereits ausgegeben worden? Es ist schon erstaunlich, dass die Bürgerbefragung bereits als abgeschlossen betrachtet wurde und nun die sogenannten „Macherinnen und Macher“, wie es in der Einladung heißt, das Entscheidende Wort haben über diese Angelegenheit, natürlich ganz ohne die Stadtpolitik und ganz privat mit der Chefin.
Ist es nicht merkwürdig, dass der vor 36 Monaten angekündigte Workshop Perspektive Unternehmer gerade jetzt nach der Wahl 2024 so kurz vor der Konstituierung der Gremien ganz privat stattfinden soll und dazu nicht öffentlich?
Oder handelt es sich hier wieder um ganz persönliche und funktionale Repräsentationskosten?
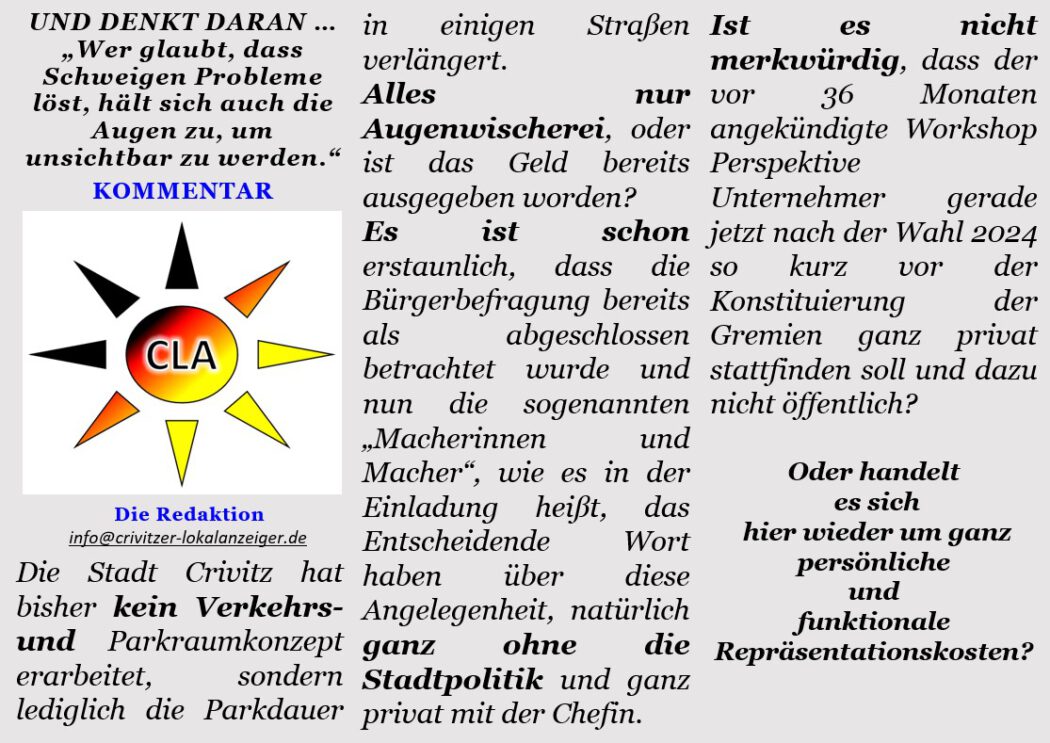
01.Juli -2024/P-headli.-cont.-red./395[163(38-22)]/CLA-231/70-2024
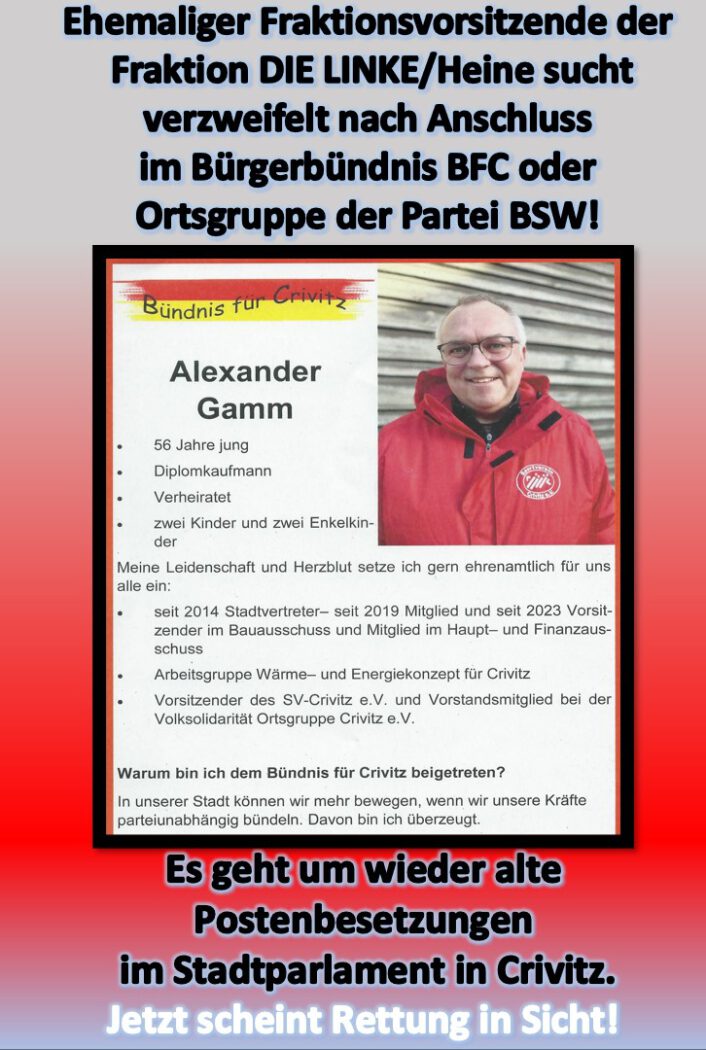
Nach zahlreichen Eskapaden als ehemaliger Stadtvertreter in den vergangenen Wahlperioden gegenüber Bürgern und einem erlittenen Wahldebakel im Juni 2024 mit lediglich 67 Wählerstimmen von 7978 gültigen Stimmen wird nun der Versuch eines *Comebacks* durch Hilfestellung unternommen.
Zunächst schien es, als ob der ehemalige Fraktions- und Bauausschussvorsitzende Herr Alexander Gamm (Die Fraktion DIE LINKE/HEINE und Ehemann der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm) bei seinen ehemaligen Kollegen im „Bündnis für Crivitz“[BfC] Zuflucht gefunden hätte. Auch schien es so, dass die politische Zweisamkeit seit dem Jahr 2019–2024, bestehend aus Herrn Hans-Jürgen Heine (Einzelbewerber) und Herrn Alexander Gamm (Partei DIE LINKE), erneut zu einem Jungbrunnen zum Wahltermin im Juni 2024 wird!
Man muss einfach nur betrachten, wie Herr Alexander Gamm als Leiter des Bauausschusses in seinen Sitzungen mit den Bürgern in der Vergangenheit umgegangen ist, die eine andere Meinung zu bestimmten Themen hatten. Bisher jedenfalls kam kein Dialog zustande, geschweige denn, dass Bürger mit anderen Ansichten sprechen durften; sie wurden allenfalls als dumme Schuljungen in Sitzungen abgestempelt. Ein Raum für den Bürger oder Dialoge wurde in der Vergangenheit nicht gelassen; man wollte eben nur den Bürger anleiten, dirigieren und maßregeln, aber sich keinesfalls in die vorher eigenen festgelegten Regeln sowie Richtlinien hineinreden lassen.
Der selbst ernannte Experte Herr Alexander Gamm will also im BfC eine Wärmekonzeption der Stadt Crivitz und eine gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG AG ausloten, um sich hier vermutlich selbst einzubringen. Die wesentlichen Absprachen wurden 2023 bereits getroffen, um eine Karbonisierungsanlage im Gewerbegebiet der Stadt Crivitz als Strom- und Wärmeerzeuger für die Neustadt in Crivitz zu etablieren. Es könnte sich hier lediglich um eine künftige Postensicherung und Auftragsverteilung zwischen verschiedenen Akteuren handeln. So schwärmte er in der Vergangenheit in Facebook (auch als Paul Hermann unterwegs) vom Bündnis für Sahra Wagenknecht und verhöhnte seinen eigenen linken Parteivorsitzenden in seinen Tweets. Inzwischen präsentiert er sich im roten Gewand auf Fotos als Mitglied des Bündnisses für Crivitz und kandidierte erneut für die Stadtvertretung.
Es wurde jedoch aus den Unterstützerkreisen des BSW mitgeteilt, dass man eine Ortsgruppe in Crivitz gründen wollte, um eigenständig an der Kommunalwahl im Juni 2024 teilzunehmen. Herr Alexander Gamm sollte das fünfte Mitglied und somit Spitzenkandidat werden, jedoch wurde daraus nichts.
Warum?
Es ist ganz einfach, weil die BSW-Partei eine sehr geheimnisvolle Mitgliederauswahl trifft und die Unterstützer in der Ortsgruppe Crivitz noch keine Mitglieder sind und nur Parteimitglieder kandidieren dürfen. „Die BSW-Partei achtet peinlich genau darauf, Schwärmer, Glücksritter, Irrlichternde und AfD-U-Boote zu vermeiden“,Herr Christian Grimm hat dies in seinem Artikel sehr gut beschrieben. Sie nimmt immer eine Distanz zu skandalträchtigen Personen ein, die ihren Ruf beeinträchtigen könnten. So ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass Herr Alexander Gamm noch kein Mitglied bei der Partei BSW geworden ist. Nachdem er drei Strafanzeigen in den vergangenen 18 Monaten von Bürgern erhalten hat wegen Beleidigung und Volksverhetzungen auf öffentlichen Sitzungen als Funktionsträger. Zwei der drei Verfahren wurden erst kurz vor der Wahl beendet. Ein Verfahren läuft noch und es wird wahrscheinlich noch ein Nachspiel geben.
So war er wahrscheinlich auch bei der Partei DIE LINKE in Ungnade gefallen war, da man sich sicherlich an das Spektakel seines Brandbriefs von 01.12.2018 erinnerte (Vorwahlkampf). Indem er seine eigenen Genossen unter Druck setzte, einen anderen Kandidaten von der Liste zu streichen, da er sonst mit eigener Liste für die Stadtvertretung 2019 kandidieren würde. Einzig und allein der ehemalige Kollege Hans-Jürgen Heine hatte ihm nun bei der Kandidatur für die Stadtvertretung 2024 geholfen.
Im Juni 2024 kam nun die Kommunalwahl, und der Souverän hat gewählt und entschieden. Jedoch kam es anders als erwartet, genauer gesagt geplant, und er hatte die Stimmung der Wähler gänzlich falsch eingeschätzt und konnte auch durch seine eigene Person beim Wähler nicht überzeugen. Es war ein Desaster für Herrn Alexander Gamm, der lediglich 67 Wählerstimmen erhielt und auf Rang 33 landete von den insgesamt 49 Kandidaten. Anscheinend war er schon zu sehr vom verwaltungstechnischen System vereinnahmt worden und in dem politischen Überbau aktiv, ohne den Kontext mit den Bürgern zu suchen.
Somit war der Traum von Posten und Macht vorbei, keine direkte Wahl in die Stadtvertretung und die Nachrücker Positionen im eigenen Bündnis für Crivitz sind auch zu zahlreich. Es scheint auch so, dass jetzt die Berufung als sachkundiger Bürger von dem Bündnis für Crivitz auch nicht wirklich gelingt, wie es aus gut informierten Kreisen verlautet wurde.
Was nun?
Plötzlich scheint sich eine andere Tür zu öffnen, und es sieht so aus, als ob eine berechnete Hilfestellung auch aus einem anderen Bürgerbündnis kommt. Zum einen vom Gesetzgeber und zum anderen aus der Wählergruppe der CWG – Crivitz, aus der heraus auch seine Ehefrau Britta Brusch-Gamm als Bürgermeisterin kandidierte und weiterhin angehört. Kurioserweise hat der Gesetzgeber im Mai 2024 die Kommunalverfassung geändert und so gibt es inzwischen ein Zuteilungs- und Benennungsverfahren der Fraktionen, die sachkundigen Einwohner ohne Wahl selbst benennen können.
So wurde aus gut informierten politischen Kreisen aus den jetzigen Hintergrundgesprächen mitgeteilt, dass derzeit die Absicht besteht, Herrn Alexander Gamm als sachkundigen Einwohner für die CWG-Fraktion erneut in den Bauausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes zu berufen. Nach seiner Berufung soll es vorgesehen sein, dass er erneut die Leitung des Bauausschusses übernimmt, um anschließend an den öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung in Crivitz teilnehmen zu können, damit er wieder ein Rede- und Antragsrecht erhält.
Was ist denn das für ein Schauspiel und Husarenstück?
Manche Protagonisten können einfach nicht loslassen. Sie setzen ihr ganzes Engagement ein, um die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu erlangen, als eigentlich notwendig.
Es geht schlichtweg wieder einmal nur um Posten, Geld und Aufträge.
Kommentar/Resümee-Die Redaktion
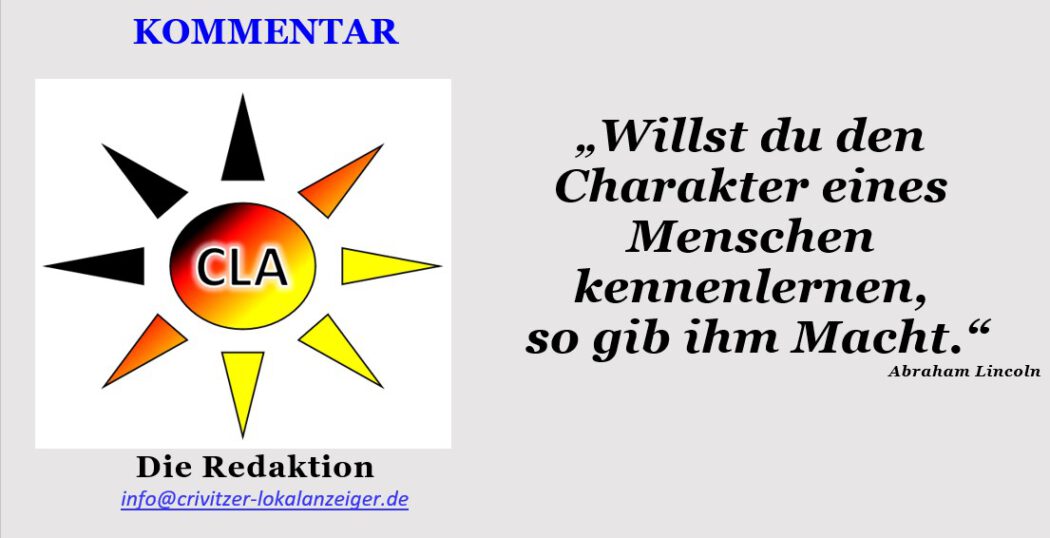
„Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht.“ Abraham Lincoln
Jedes Mal, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Wähler nach fünf Jahren zur Kommunalwahl zu gewinnen, ist das für manche Protagonisten ein besonderes Schauspiel. Man macht ein neues Kleid oder ein neues Bündnis. Dann ändert man schnell seine Meinung, um das Ziel zu erreichen.
Es wäre ein Skandal, wenn jetzt der Wähler, der auch Schlechtleistungen abgestraft hat, wieder betrogen wird, indem die gleichen Personen erneut an Schlüsselpositionen der Macht sitzen wie zuvor. So ist es anzunehmen, dass man als „Mann“ im Schatten der eigenen Ehefrau nicht stehen möchte, sondern etwas zu sagen haben will, um herausragen als Ehemann. Hätte der Wähler vorher davon Kenntnis gehabt, wäre die Wahl sicherlich anders verlaufen. Es geht wie immer ausschließlich um die Sicherung von alten Posten und die Wiederherstellung des alten Status der Macht!
Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern ist von einer bestimmten Endlichkeit gekennzeichnet, was die Bürger sicherlich bei den kommenden Wahlen erfreuen wird!
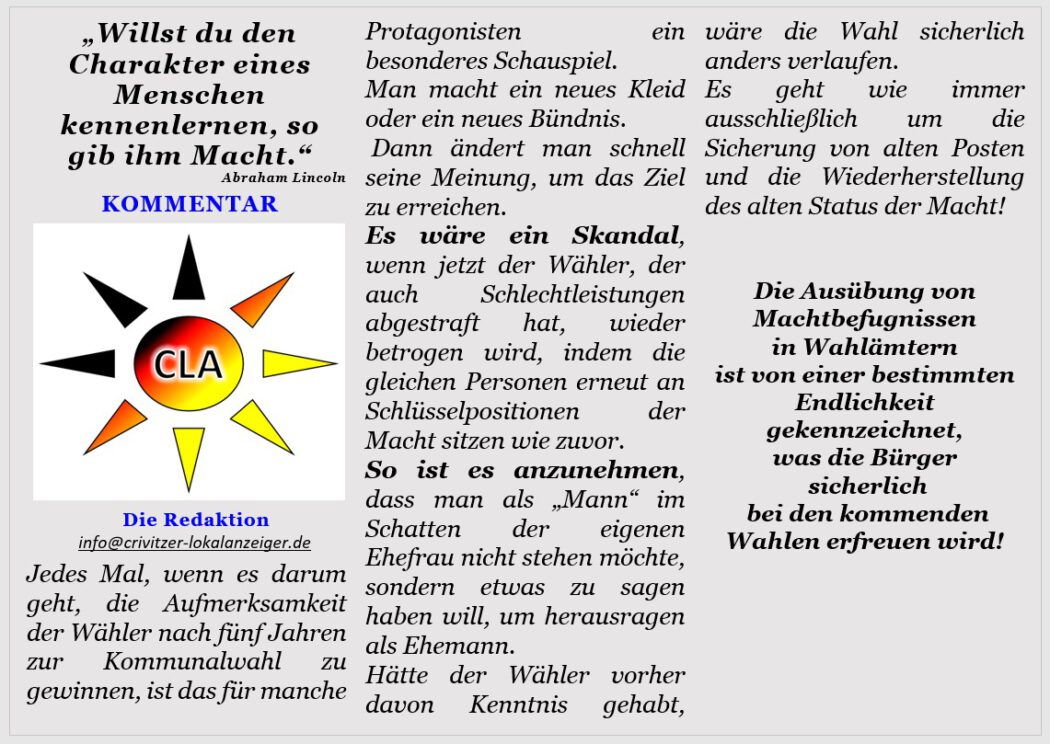
29.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./394[163(38-22)]/CLA-230/69-2024

Die Bürger und die Kurzzeitpflege am Tulpenbaum in Wessin werden seit Monaten mit ihren Anfragen und der Zusage auf Prüfung für eine Verkehrsberuhigung (Zone) auf 30 Km/h hingehalten und vom Bauausschuss in Crivitz verschaukelt.
Es ist erstaunlich, wie viele Autos und Transporter in der Ringstraße am Tulpenbaum unterwegs sind. Nicht nur die Lieferdienste, die um die Kurve rasen, sondern auch Landmaschinen, die hier zügig vorankommen wollen. Es geht nicht nur um die Anlieger, die eine Rennstrecke vor der Haustür haben, sondern auch um den anliegenden Kinderspielplatz und einen Bolzplatz, der vorrangig von der Jugend im Ortsteil Wessin genutzt wird.
Besonders Frau Bettina Fritzsche, selbst Anwohnerin und Mitglied des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Crivitz, bemüht sich seit ca. 10 Monaten darum, im Auftrag der Bürger in den verschiedenen Gremien Gehör zu verschaffen. Zunächst einmal im Bauausschuss oder Umweltausschuss und in der Ortsteilvertretung in Wessin. Der Umweltausschuss fühlte sich nicht zuständig und die Ortsteilvertretung in Wessin nahm das Ganze gelassen und hatte auch keinen so großen Druck auf die Stadtvertreter ausgeübt.
Im Bauausschuss im Nov. 2023 versprach ihr der ehemalige Vorsitzende (Alexander Gamm–Fraktion die LINKE/Heine – Ehemann der Bürgermeisterin) sich um die Sache zu kümmern und das Anliegen zu prüfen. Herr Michael Renker, der erste Bürgermeister der Stadt, äußerte sich sofort ablehnend und machte sofort keine Hoffnung und lehnte sofort eine 30 Km/h-Zone ab.
Als Ende Januar 2024 nach weiteren zwei Sitzungen des Ausschusses aufgrund der erneuten Nachfrage nach dem Ergebnis der Prüfung erfolgte, war Herr Gamm sehr erstaunt und konnte keine Antwort geben. Er beabsichtigte, einen Vertreter des Amtes in den Ort Wessin zu entsenden. Als im Monat Februar und März 2024 erneut Fragen zur Verkehrsberuhigung in der Ringstraße in Wessin auftauchten im Bauausschuss, wiederholte sich das Prozedere der Antwort wie im Monat Januar und man war generell überrascht von solch einer Fragestellung.
Bis zum heutigen Tag gibt es keine Diskussion in einem Gremium dazu oder eine Antwort für die Bürger, geschweige denn, dass ihr Anliegen überhaupt ernst genommen wurde. Jeder normale Bürger würde sich hier als veralbert oder verschaukelt vorkommen von den kommunalen Gremien, insbesondere vom Bauausschussvorsitzenden, der vermutlich schon tief im Wahlkampf steckte.
Ist also das Anliegen der Bürger zur Verkehrsberuhigung in der Ringstraße im Ortsteil Wessin ein Opfer des Wahlkampfes oder war es die Arroganz der Macht einzelner Funktionsträger in der Stadt Crivitz, das nicht ernst zu nehmen?
Kommentar/Resümee –Die Redaktion
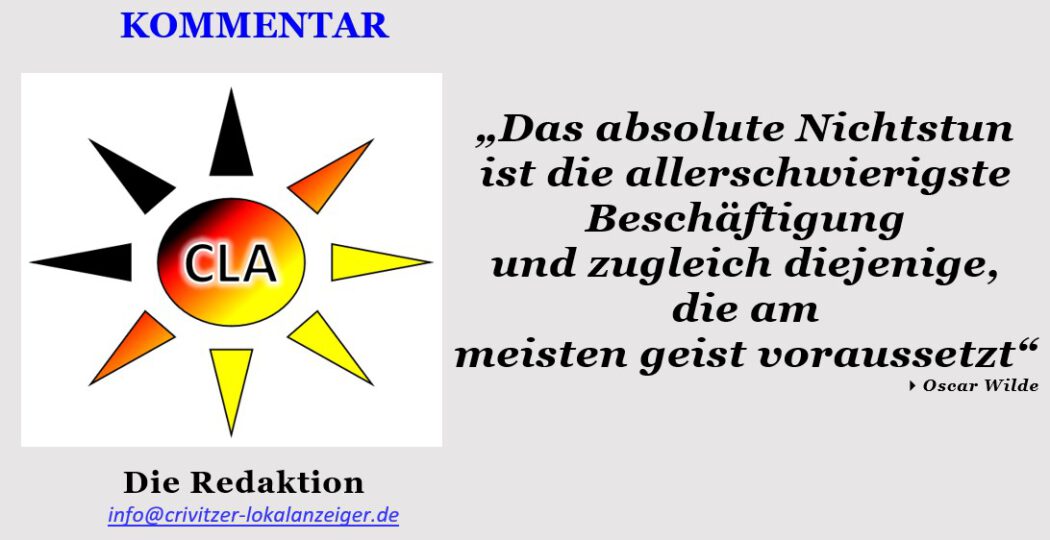
„Das absolute Nichtstun ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten geist voraussetzt“ Oscar Wilde
Alles könnte so unkompliziert sein. Nur eine kurze Nachfrage beim Kreis ergab, dass die Stadt das Hoheitsrecht hat, eine Verkehrsberuhigung zu beschließen und einen Antrag an die Verkehrsbehörde jederzeit zu stellen. Nach einer Prüfung und im Einvernehmen mit der Stadt könnte es sich nicht nur um eine generelle 30 km/h Zone handeln, sondern auch um andere verkehrstechnische Maßnahmen, die zur Beruhigung beitragen können.
Die bisherigen Gremien und einige äußerst unqualifizierte Personen haben versagt. Es ist symptomatisch für das sporadische unkontrollierte Handeln der letzten fünf Jahre der herrschenden CWG-Fraktion, die stets alles verändern wollte, mit Macht aufgrund ihrer absoluten Mehrheit. Doch nie wusste man, wie es weitergehen sollte und hatte für die kleineren Anliegen meistens kein offenes Ohr. Sondern die stets nur ihre eigenen großen Ziele im Blick hatte. Hauptsache, Augen zu und durch.
Es ist zu hoffen, dass die Bürger des Ortsteils sich nach der Konstituierung der Ortsvertretung in Wessin im Monat August oder September 2024 für ihre Anliegen starkmachen. Allerdings sind dann bereits 12 Monate für dieses Anliegen vergangen und der Amtsschimmel (Bürokratismus) kommt noch hinzu!

26.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./393[163(38-22)]/CLA-229/68-2024

Die Vereinsarbeit ist in einem kritischen Zustand.
Vom HSV Crivitz Eichholz e. V. wurde ein sogenanntes Nutzungsverbot verhängt. Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Stadt Crivitz hat einen privilegierten Pachtvertrag mit einem Hundesportverein (HSV Crivitz Eichholz e. V.) abgeschlossen, in dem auch ehemalige Abgeordnete (sachkundige Einwohner der CWG – Fraktion) tätig sind. Das alles wurde noch kurz vor der Wahl von den ehemaligen Mehrheitsfraktionen CWG und DIE LINKE/Heine so festgelegt und schriftlich umgesetzt!

So schafft die Stadt Crivitz damit ein tiefes Spannungsfeld zwischen zwei Hundesportvereinen. Es ist selbstverständlich, dass der HSV Crivitz Eichholz e. V. nun gestärkt wurde und sowohl in seiner Kommunikation als auch im gesamten Auftreten hart gegen seinen unmittelbaren Konkurrenten vorgeht und ihn konsequent aus dem Trainingsgelände verbannt.

Kurios ist nur, dass der Hundesportverein Crivitz Eichholz e. V. den Trainingsplatz selbst nur an *ZWEI* Tagen in der Woche nutzt. Welche Bedeutung haben also die Machtspiele des Eichholzvereins e. V. und persönliche Interessen gegenüber den anderen Hundesportvereinen Lewitzrand? Könnten Sie vielleicht politisch motiviert sein, oder geht es lediglich darum, einen Kontrahenten auszuschalten?
Erinnern wir uns!
Es könnte alles ganz leicht sein! Wieder einmal ging es um personenbezogene Befindlichkeiten und um direkte Kontakte zur Stadtverwaltung und eine Machtdemonstration der Wählergruppe der CWG. Zwei Hundesportvereine besitzen lediglich einen Trainingsplatz, jedoch besitzt nur einer einen Vertrag. Die Mehrheit der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine lehnten öffentliche Diskussionen ab und hatten den abgeschlossenen Pachtvertrag geheim gehalten. So wurde kurz vor der Wahl der Pachtvertrag mit dem Crivitz – Eichholz e. V. von der jetzigen und zukünftigen Stadtspitze unterzeichnet, ohne die Zustimmung der Stadtvertretung einzuholen und ohne jegliche Diskussion zu haben. Immer mehr Details über den Inhalt gelangten an die Öffentlichkeit. Die Mehrheit der CWG-Crivitz und die Linke/Heine versuchen seit zehn Monaten, öffentliche Diskussionen bis zur Wahl zu unterbinden. Sie taktierten und spielten auf Zeit, um den Hundesportverein Lewitzrand e. V. zu verhindern.

So wurde bereits im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine der Stadt Crivitz am 11. Juli 2023 über das Thema Pachtvertrag für die Hundesportvereine diskutiert. Dabei wurde von Frau Diana Rommel, die damalige Vorsitzende des Hundesportvereins „Crivitz – Eichholz“ e. V., darauf mehrmals hingewiesen, dass es für den Verein wichtig ist, „dass der Pachtvertrag weiterhin so Bestand haben sollte“. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar erkennbar, dass hier seit Längerem ein Pflock und eine feste Position in den Boden gestemmt werden sollte zum Hundesportverein „Crivitz – Eichholz“ e. V.
Das Fatale an der Sache war nur, dass Frau Diana Rommel als sachkundige Einwohnerin in dem gleichen Ausschuss vertreten war (CWG – Fraktion) und natürlich einen direkten Einfluss innerhalb der Stadtvertretung besaß zu der Entscheidung zum abgeschlossenen Pachtvertrag. So wurde kurz vor der Wahl der Pachtvertrag mit dem Crivitz – Eichholz e. V. von der jetzigen und zukünftigen Stadtspitze unterzeichnet, ohne die Zustimmung der Stadtvertretung einzuholen und ohne jegliche Diskussion zu haben.
So unkompliziert ist also unsere parlamentarische Demokratie in Crivitz entwickelt!
Bisherige Bemühungen des Hundesportvereins Lewitzrand e. V. für eine Einigung oder die Suche nach einem neuen Standort für die Vereinsaktivitäten blieben bis jetzt erfolglos. So sendete der Hundesportverein nun SOS, weil seine Existenz bedroht ist, und schrieb an die Stadtpolitik! Aber in der Stadtpolitik tut sich zu diesem Thema nichts.
Zumindest vorerst, da die Konstituierung nach der Wahl und die Ausschüsse bislang nicht neu arbeitsfähig sind und dann kommt der Sommerurlaub; ob bis dahin oder darüber hinaus der Lewitzrand e. V. noch existieren wird, bleibt fraglich!
Kommentar/Resümee
„Des einen Leid ist des anderen Freud.“

Trotz der dargestellten Ereignisse und der Verweigerung von Informationen und Befangenheiten einzelner Ausschussmitglieder entstehen Fragen.
Warum ist es nicht zulässig, dass zwei Vereine auf einem Hunde-Trainingsplatz trainieren dürfen?
Selbst der Lewitz Hundesportverein e. V. appelliert in seinen Brandbrief an die Stadt Crivitz, die bestehende Option zu nutzen, um sicherzustellen, dass beide Vereine gleichermaßen den vorhandenen Trainingsplatz benutzen können, was ihm jedoch verwehrt bleibt. Der Lewitzrand e. V. hat schon lange Gesprächsbereitschaft angeboten, aber auch um vorrangig öffentliche Debatten gebeten, weil das Anliegen vom öffentlichen Interesse ist und um die emotionalen Einzelinteressen zu vermeiden.
Ist es tatsächlich so, dass alles im Dunkeln gelassen werden muss? Hatten einige Wählergruppen vor der Kommunalwahl Angst gehabt, sich mit den Bürgern und anderen Meinungen zu unterhalten?
Oder wollten Sie ihre Macht nutzen, um Entscheidungen zu beeinflussen? Es ist möglich, dass einmal die kritischen Aktiv- oder Vereinsbürger mit ihrer abweichenden Meinung recht haben. Falls dem so ist, was ist dann zu tun?
In einer Demokratie ist es von Bedeutung, die vorhandenen Interessen stets zu berücksichtigen, Kompromisse zu schmieden und sie auch zu finden, um möglichst viele Beteiligte zu befriedigen.
Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern ist von einer bestimmten Endlichkeit gekennzeichnet, was die Bürger sicherlich bei den kommenden Wahlen erfreuen wird!

23.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./392[163(38-22)]/CLA-228/67-2024
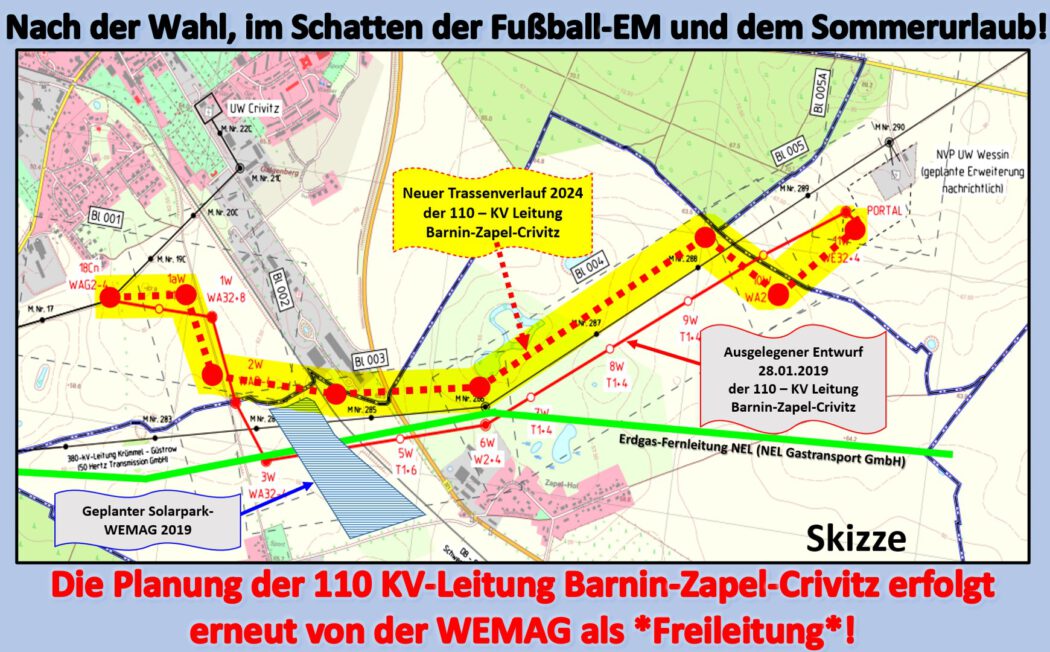
Die WEMAG Netz GmbH hat am 13.11.2018 den Antrag auf Planfeststellung für die Errichtung und den Betrieb der 3,5 Kilometer langen zweisystemigen Freileitung 110-kV Anschluss NVP Wessin beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gestellt.
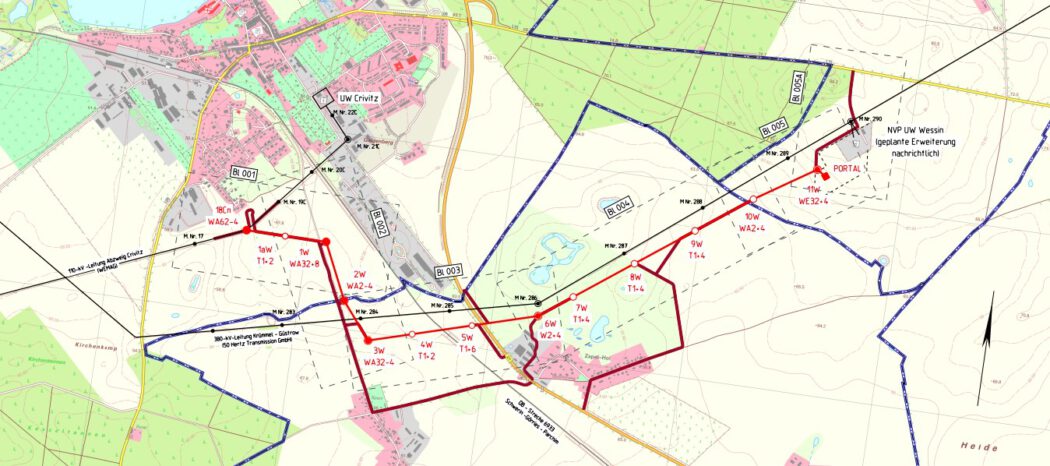
Sie begründete diesen Schritt folgendermaßen:
Aufgrund des Ausbaus von erneuerbaren Energien sowohl im vorbeschriebenen Bereich, als auch insbesondere in der Region Schwerin – Sternberg – Parchim hat die Einspeisung regenerativer Energie in das 110-kV-Verteilnetz der WEMAG NETZ GMBH in den vergangenen Jahren stark zugenommen und steigt weiterhin an. Folglich stößt das 110-kV-Verteilnetz an die Grenzen seiner sicheren Übertragungsfähigkeit. Die in der Region regenerativ erzeugte Energie muss vom 110-kV-Verteilnetz der WEMAG in das überlagerte 380-kV-Übertragungsnetz der 50Hertz Transmission transformiert werden, damit sie in die Verbraucherstarken-Regionen geführt werden kann.
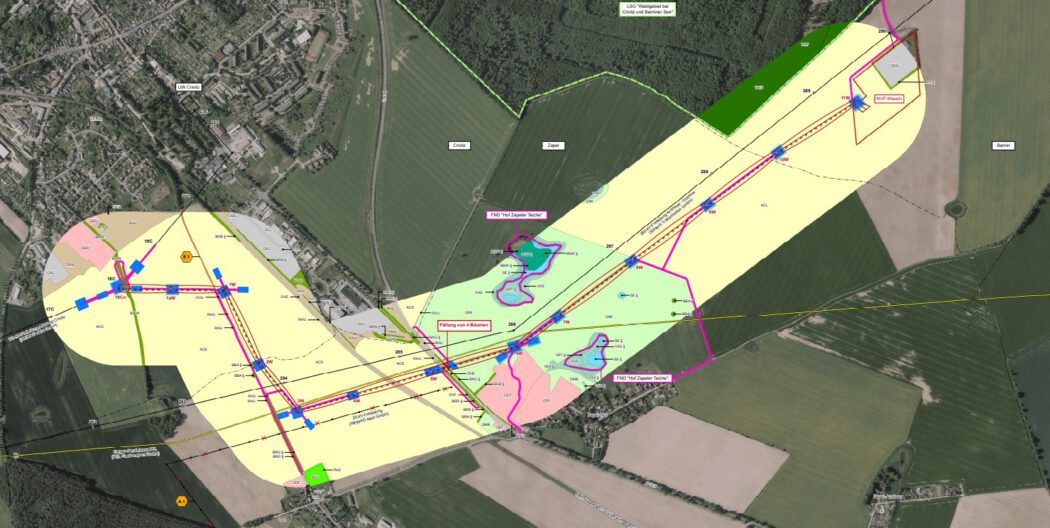
Für die Trasse sind Stahlgittermaste in Einebenenausführung analog zur bestehenden 110-kV-Freileitung Abzweig Crivitz mit Höhen bis zu max. ca. 25 Metern über Erdoberkante in Abhängigkeit von u. a. den topografischen Verhältnissen/technischen Erfordernissen geplant. Für das Vorhaben, einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, werden Grundstücke in den Gemarkungen Crivitz, Zapel und Barnin beansprucht.
Im Januar und Februar 2019 führte die WEMAG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine öffentliche Auslegung ihrer Planung durch. Da für das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes bestand, führte sie lediglich eine Potenzialanalyse der Umwelt/Natur durch.
In der Bürgerbeteiligung tauchten plötzlich Avifaunistische Gutachten von Vereinen auf, die einerseits detaillierte Untersuchungen und Analysen des Gebietes für Brut-Rast- und Zugvögel beinhalteten. Die Untersuchungen enthielten auch die Bewertung des Kollisionsrisikos zu der geplanten Freileitung im Bereich Zapel und Barnin sowie zur Kombination mit den geplanten 20 Windrädern im Windpark Wessin.
Hierbei wurde im Fazit festgestellt, dass ohne Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotsbestände eine Umsetzung nach dem derzeitigen Planungsstand (Freileitung) nicht möglich ist.
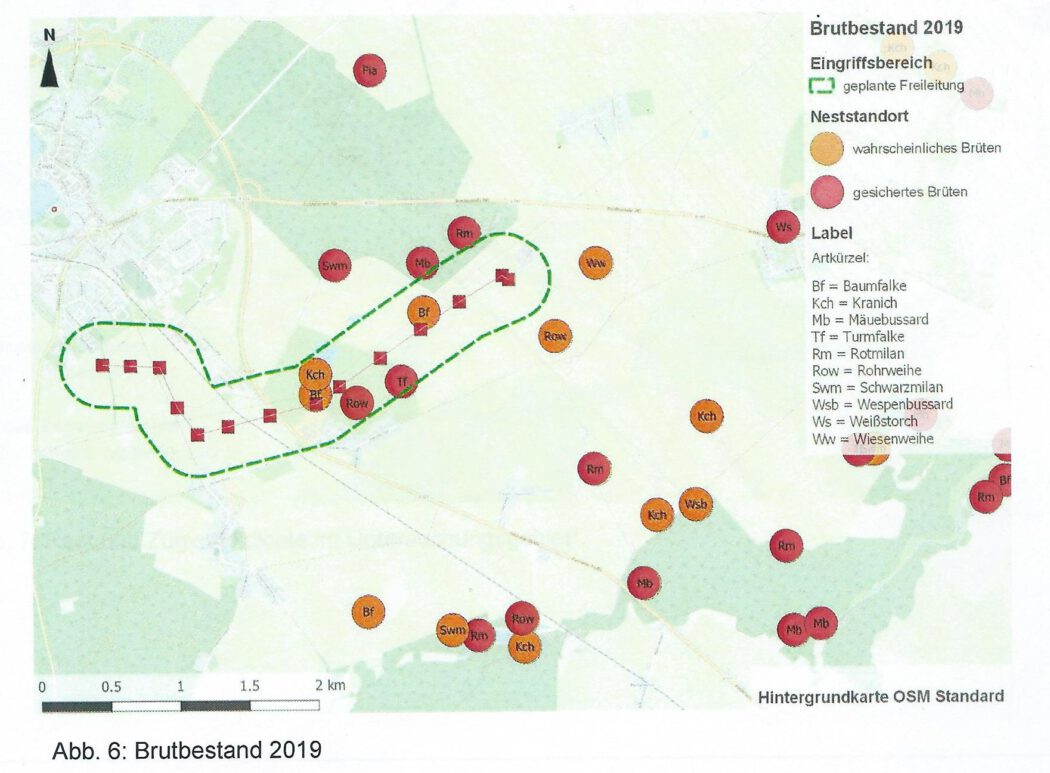
Angesichts dessen wurde im zwischen dem Gebiet der B 392 und der B 321 (also Barnin und Zapel Hof) eine Erdkabelstrecke als Lösung dargestellt.
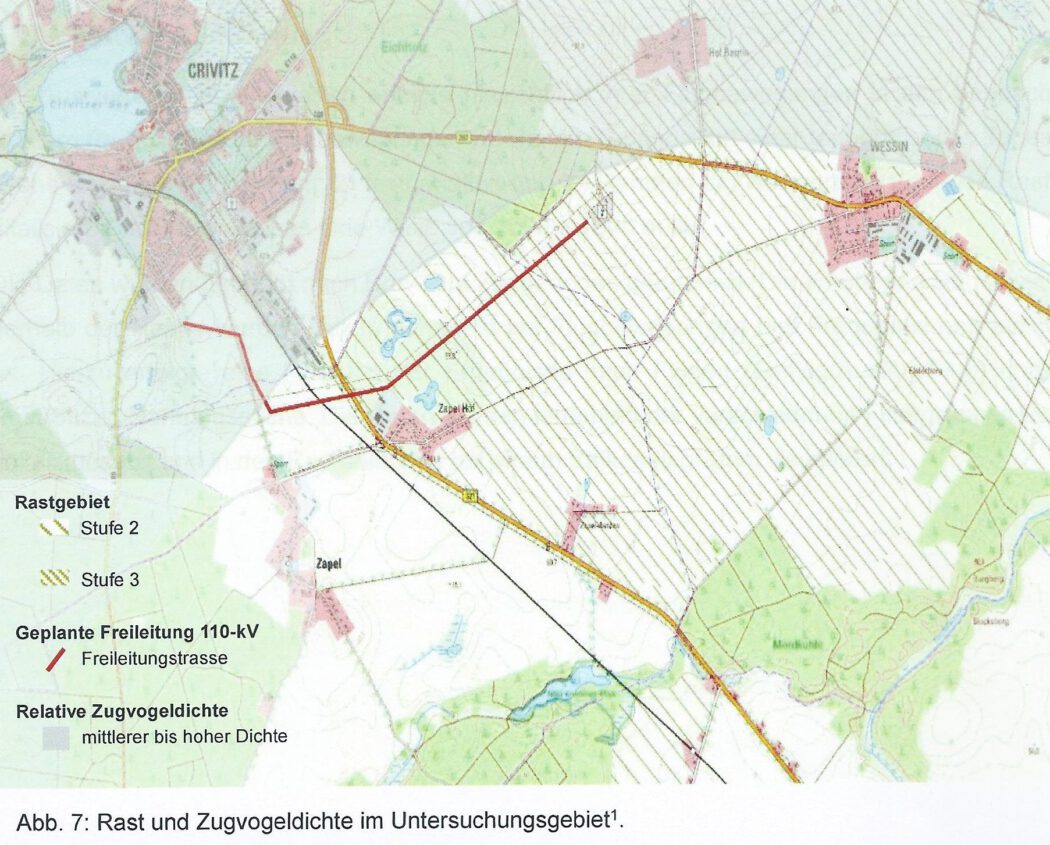
Im Bericht wurde dargelegt, dass bei den verschiedenen Planungen wie Windkraft mit 20 Anlagen, Neubau 110 KV Freileitung und dem geplanten Ausbau/Neubau der 380-KV-Freileitungen die Mortalitätsrisiken (Sterblichkeit) wesentlich erhöht werden. In diesem Gebiet, mit durchschnittlich 88 Arten, von denen sich ca. 44 % in einem prekären Zustand befinden, würde bei der Umsetzung aller Vorhaben mit einem hohen Verlust dieser Diversität (Vielfalt) gerechnet werden.
Das war ein harter Brocken für die WEMAG und damit hatte sie auch nicht gerechnet, dass nach der neuesten wissenschaftlichen Methode solche Untersuchungen vorliegen. Sie lehnte es stets in Ankündigungen im Vorfeld der Planungen ab, Erdkabelleitungen zu akzeptieren, da sie viel zu teuer wären.
Der Termin für die Abgabe einer Stellungnahme für die Stadt Crivitz als Träger der öffentlichen Belange wurde bis zum 17.05.2019 verlängert. Aufgrund dieser unerwarteten Gutachten durch Vereine hat die Stadt Crivitz, die sich im Wahlkampfmodus im April 2019 befand, in dem das Thema Windkraft mit den dazugehörigen Demos dominierte, einen Beschluss gefasst. Zunächst gab der Bauausschuss seine Erklärung ab (wie zuvor erwähnt im Wahlkampf) und verkündete seine Empfehlung: „Der Errichtung der 100 KV-Leitung wird zugestimmt unter der Voraussetzung, dass das letzte Drittel der Leitung unterirdisch verlegt wird und statt einer Bepflanzung des Zapeler Weges eine Wegsanierung erfolgt.“ Es wurde keine gutachterliche Einschätzung vorgenommen, sondern lediglich eine verwaltungsrechtliche.
Man wollte hier ein Pokerspiel beginnen, um das Beste für sich herauszuholen, was jedoch wenig dem Natur- und Artenschutz hilft. Als dann die Stadtvertretung am 13.05.2019 endgültig abstimmen wollte, wurde zwar abgestimmt, dass man eine Stellungnahme abgeben wolle, aber die angekündigte schriftliche Stellungnahme lag bislang nicht vor. Das ist eigentlich nicht möglich, da es eine öffentliche Stellungnahme war.
Diese Herangehensweise wurde zwar von auch von der CDU-Opposition moniert, dass man etwas beschließt, was man nicht kennt. Jedoch war es für die Zeit symptomatisch, gewissermaßen ein Schaufenster (Wahlkampf), da auch die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) ihre ganz eigenen Ziele mit der WEMAG verfolgte. Die öffentliche Stellungnahme und die Position der Stadt Crivitz wurden bis heute geheim gehalten und sind somit nicht einsehbar. Diese öffentliche Methode wurde seit fünf Jahren von den Mehrheitsfraktionen CWG – Crivitz und Die Linke/Heine mehrfach bei verschiedenen anderen Planverfahren angewandt.
Als die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) sich im Mai 2021 als Opposition empfand und eine Auskunft von der Bürgermeisterin öffentlich erzwang, wurde seitens der Mehrheitsfraktion der CWG die Auskunft verweigert. Es wurde auf ein geheimes Treffen im März 2021 mit der WEMAG der drei angrenzenden Bürgermeister verwiesen und keine Informationen darüber bis heute erteilt.
Die Konsultationen im Ministerium mit den Vereinen wurden indessen fortgesetzt und es wurde mitgeteilt, dass die WEMAG nun eine andere Variante vorlegen sollte, was nun im Juli/ August 2024 voraussichtlich der Fall sein wird. Da die Vermessungsarbeiten im Gebiet zu dieser neuen Variante eben beendet wurden!
Die Redaktion: Fazit
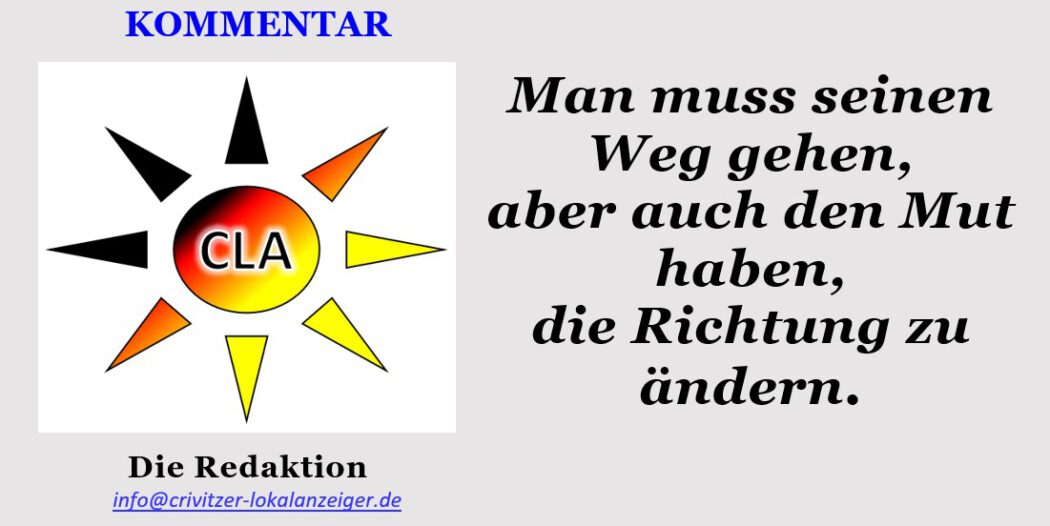
Man muss seinen Weg gehen, aber auch den Mut haben, die Richtung zu ändern.
Die WEMAG hofft, durch die neuen gesetzlichen Voraussetzungen und Erfordernisse schneller an ihr Ziel heranzukommen, mit der neuen Variante im Trassenverlauf, ohne dass es zu vielen Einwänden und Diskussionen kommt. Obwohl diese Variante tatsächlich einen noch größeren, negativen und weitreichenderen Einfluss auf den Natur- und Artenschutz in diesem Gebiet hat.
Nach der Kommunalwahl und im Schatten der Fußball-EM geht es ganz unvermittelt und unerwartet los im Monatstakt mit der Umsetzung der Planprojekte der erneuerbaren Energien und Trassenleitungen. Es beginnen düstere Zeiten für Naturschutz und Artenschutz! Die Belastungen für die Bürger durch Wind-, Solar- oder neue Stromtrassen werden in den kommenden Monaten und Jahren erheblich sein.
Es wird sicherlich nicht möglich sein, diese Belastungen einfach durch mehr Geldzahlungen im (dann neuen) Bürgerbeteiligungsgesetz bei den Betroffenen und deren Zustimmung einfach zu erkaufen. Was einmal in der Natur zerstört wurde, bleibt auch in der Tourismusregion um Wessin/ Zapel in den nächsten Jahrzehnten zerstört.
Warum sollte ein Erdkabel in diesem Gebiet so teuer sein? An dem Geld bei der WEMAG dürfte es nicht scheitern, bei den heutigen Strompreisen. Oder?

21.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./391[163(38-22)]/CLA-227/66-2024

Er ist jedoch nicht in der Lage, 1500 € für einen mobilen Pavillon zu finanzieren.
Es herrscht ein völliges Chaos bei der Hauptsatzung in Crivitz bezüglich der Entschädigungen und Befugnisse des SBB. Eine nicht amtliche Lesefassung der Hauptsatzung enthält Dinge, die nie diskutiert oder beschlossen wurden. Es gibt eine 4. Änderung seit 8 Monaten, die nicht von der Bürgermeisterin ausgefertigt und gesiegelt wurde. Diese ist auch nicht veröffentlicht worden, aber sie existiert angeblich. Somit konnte diese 4. Änderung der Hauptsatzung auch keine Rechtskraft erlangen, aber es wurde nach dieser stets gehandelt.
Es ist symptomatisch für das sporadische unkontrollierte Handeln der letzten fünf Jahre der herrschenden CWG-Fraktion, die stets alles verändern wollte, mit Macht aufgrund ihrer absoluten Mehrheit. Doch nie wusste, wie es weitergehen sollte. Hauptsache, Augen zu und durch. Es ging um die Streichung des Sockelbetrages von 50,00 € monatlich für die Stadtvertreter und die eigentlichen Befugnisse des SBB, ob er nun Rederecht bekommt oder nur sprechen sollte in der Einwohnerfragestunde. Ob die Amtszeit des SBB indessen fünf Jahre beträgt oder lediglich der Wahlperiode der Kommunalwahl entspricht, bleibt bis heute ungeklärt.
Alles in allem ein Kauderwelsch, das sich sehen lassen kann.
Das Amt Crivitz verbirgt seine Verantwortung für die Veröffentlichung der Änderungen der Satzung hinter der Bürgermeisterin, während diese sich wiederum bei diesem Thema zurückzieht hinter dem Sitzungsdienst des Amtes. Dies wurde zumindest aus gut informierten Kreisen mitgeteilt. Und so schließt sich der Kreis immer wieder. Seit Jahren führt das dazu in der Stadtpolitik, dass die anderen immer Schuld haben. Wer die anderen sind, wird immer gerade in der vorherrschenden Situation ausgewählt oder festgelegt.
Es ist selbstverständlich in dieser Situation, dass es zu Verwirrungen bezüglich der zu entrichtenden Aufwandsentschädigungen kommt, die einerseits durchaus gerechtfertigt sind, aber andererseits jedoch nicht sein sollen.
Die überwiegende Mehrheit im SBB verzichtet jedoch auf die Aufwandsentschädigungen, was darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2022 bei der Kandidatenauswahl eine Handverlesung der Mehrheitsfraktionen CWG/Heine und der Linken/Heine dominierte. Dies führt natürlich zu jährlichen Einsparungen von 4.000 € in der Stadtkasse (10 Sitzungen a. 10 Teilnehmer zu 40,00 €) am Sitzungsgeld.
Natürlich ist es kurios, dass der SBB seinen mobilen Pavillon (Kosten ca. bis 1.500 €) aus seinem eigenen Budget bezahlen muss. Der SBB nutzt sein Budget für Flyer oder Veranstaltungen mit Zelten usw.
Und so läuft er seit 8 Monaten seinem Projekt hinterher und bettelt bei den Mehrheitsfraktionen. Sie lehnten zunächst ab, mit der Begründung: Da der SBB in Crivitz bereits ein festes Budget von 1000 € erhält und es ihm jährlich neu zugesagt wird, muss er mit diesem Budget auskommen. Es ist unmöglich, es ständig aufs Neue zu variieren, da es sich immer nur um einen kurzen Zeitraum handelt. Außerdem ist es eine Investition, und die kann nach der Satzung nicht als solche verauslagt werden. Dies wurde während der Diskussion im Umweltausschuss so verdeutlicht. Was also tun, um diesen Pavillon zu erhalten, der ca. 1500 € kostet?
Nun wartet also der SBB auf eine Förderung, die am Ende des Jahres kommen soll und dann hat die Stadt Crivitz endlich Geld, um diese Investition auszuzahlen. Bei Angelegenheiten zur Feuerwehr ist alles wesentlich schneller und unkomplizierter.
Die Redaktion/Fazit:
„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“ Lucius Annaeus Seneca
Was ist eigentlich aus dem Vorhaben geworden, Straßen und Plätze auch für mobilitätseingeschränkte Menschen ohne Barrieren zugänglich zu machen?
Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden, sich für die Herstellung und den Ausbau barrierefreier öffentlicher Parkanlagen und Treppen einzusetzen?
Wie hat sich das Projekt seit drei Jahren entwickelt, um den barrierefreien Zugang zum Marktplatz zu gewährleisten?
Sicherlich ist alles in Arbeit und wird beim nächsten Gesundheitstag ausgewertet.
18.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./390[163(38-22)]/CLA-226/65-2024

Das sogenannte bekannte Stühlerücken (Mandatsverzicht) ermöglicht es altbekannten Akteuren, die viel weniger Wählerstimmen erhalten haben, ihre alten Positionen erneut als Nachrücker im Stadtparlament einzunehmen.
Das Wählerinteresse wird durch die Tatsache nebenbei bemerkt verzerrt, weil der eigentlich gewählte Abgeordnete einen Auftrag erhalten hat und nicht der sogenannte Nachrücker. Aber das ist eben das Versprechen vor der Wahl und danach!
Oder war es dann eben wieder ein VERSPRECHER vor der Wahl?
Zum Verdeutlichen!
Ein gewählter Abgeordneter in einem Stadtparlament hat von seinen Wählerinnen und Wählern einen Auftrag erhalten. Er oder sie soll die Interessen von den Wählern und Wählerinnen im Stadtparlament vertreten. Wenn also ein gewählter Abgeordneter eines Stadtparlaments darauf verzichtet, seinen Platz im Stadtparlament einzunehmen, verzichtet er auf das Mandat (den Auftrag), den ihm die Wähler gegeben haben. Das ist dann ein Mandatsverzicht.
Die Redaktion/Fazit:
Schauen wir mal, welche Abgeordneten in der Stadtvertretung von Crivitz bis zur konstituierenden Sitzung noch übrig sind, von den einst Gewählten, die einen Auftrag erhielten, und welche Vorgehensweise die altbekannten Nachrücker nun plötzlich neu haben.
16.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./389[163(38-22)]/CLA-225/64-2024
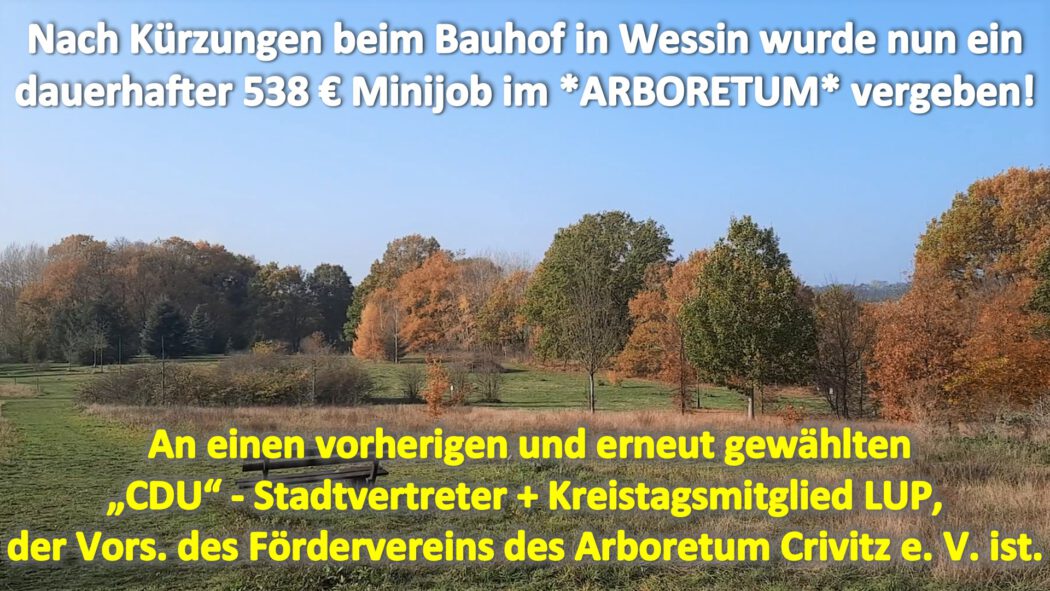
Man kennt sich bestens vor und nach der Wahl!
Schon kurz nach der Wahl wird die Geduld des Wählers auf eine harte Probe gestellt.
Aus gut informierten Kreisen wird empört berichtet, dass kurz vor der Wahl durch die alten Fraktionen der CWG+, die LINKE/Heine und natürlich auch die CDU-Fraktion noch schnell ein dauerhafter 538 € Minijob im ARBORETUM vergeben wurde.
Der gleichrangige Vorsitzende des Fördervereins des Arboretums Crivitz e. V., Herr Hartmut Paulsen, ist nun neuer Mitarbeiter der Stadt Crivitz und gleichzeitig wiedergewählter neuer Abgeordneter der Stadt + Kreistages der CDU-Fraktion. Zusätzlich zu den insgesamt monatlichen Aufwandsentschädigungen von 300,00 € der Stadt und des Kreises zuzüglich des Sitzungsgeldes+ Reisekosten (abgabenfrei) kommt indessen noch 538 € vom Minijob hinzu. Überdies fallen auch die Vergütungen für die Tätigkeiten als Mitglied der Gesellschafterversammlung des LUP-Klinikums am Crivitzer See gGmbH und der Ludwigslust-Parchimer Rettungsdienst GmbH für ihn ins Gewicht. Über die Höhe dieser Vergütungen wurde eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen, sodass hierzu keine Informationen vorliegen.
Alles in allem hat dann Herr Hartmut Paulsen, der auch noch Vorsitzende des Evangelischen lutherischen Kirchengemeinderates in Crivitz ist, eine ganz besondere Bedeutung in der Stadt erlangt.
Das klingt alles wie ein schlechter Roman aus den tiefsten Verstrickungen in Italien, ist jedoch auch in Crivitz bei der Vergabe von Positionen noch immer die Realität. Man kennt sich eben schon eine lange Zeit und man genießt es eben, einander einen Gefallen zu tun.
Bis 2014 mobilisierte die Stadt Crivitz ca. 150.000 € für die Errichtung und Herstellung eines Arboretums als eine Institution *für Forschung, Lehre und Bildung verschiedenartiger Gehölze *. Seit dem 22.06.2015 werden die jährlichen Ausgaben des Arboretums Crivitz e. V. nicht mehr als freiwillige Leistungen deklariert, sondern als Pflichtaufgaben; damit müssen diese Ausgaben auch in Zukunft bei einer Haushaltsschieflage trotzdem ausbezahlt werden. Der damalige Sachbearbeiter im Amt Crivitz im Bürgeramt, Herr Hartmut Paulsen, hat die Beschlussvorlage des Pflege- und Entwicklungskonzepts (BV Cri SV 083/15) erstellt. Bereits bei der Diskussion über diesen Beschluss wurde von der SPD-Fraktion die Frage gestellt, ob die zusätzlichen aufgeführten Pflegeaufwendungen unbedingt ein Bestandteil des Pflege- und Entwicklungskonzepts sein sollten. Schon damals kam es zu einer heftigen Debatte, in der auch Enthaltungen zu verzeichnen waren. Verzweifelt wurde nun in den vergangenen 10 Jahren versucht, sehr kostenintensiv dort nordamerikanische Bäume z. B. Dorn-Gleditschie, Tulpenbaum, Schwarznuß, Weymouts-Kiefer, Sitka-Fichte oder asiatische Bäume z. B. Zweilappiger Ginkgo, Nikkotann anzupflanzen jedoch, wie wir seit 2023 nun endgültig wissen, leider vergebens.
So wurden auch danach bis 2024 allein in die fortlaufende Unterhaltung (Pflegekonzept) insgesamt ca. 100.000 € durch die Stadt Crivitz investiert. Ab 2024 werden noch einmal jährlich ca. 6.500 € Personalkosten durch einen Minijob anfallen. Die Finanzierung dieser Kosten für das Arboretum erfolgte schon immer durch die Einnahmen der jährlichen Stadtwaldbewirtschaftung. Zusätzlich wurde noch in die Ausstattung mithilfe von Fördermitteln investiert (Holzbrücke, Lehr- und Wanderpfad, Holz-Pavillon, Hinweisschilder und Sitzgarnituren) mit bis zu ca. 120.000 €. Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass für die *Institution für Forschung, Lehre und Bildung verschiedenartiger Gehölze (Arboretum)* in den vergangenen Jahren insgesamt ca. 360.000 € aufgewendet wurden.
Seit Ostern 2024 ist der Bauhof in Wessin geschlossen, weil angeblich höhere Kosten befürchtet wurden. Dabei verbrauchte er nur im Jahr ca. bis zu 35.000 € an Aufwendungen; circa die Hälfte davon waren Personalkosten. Die anderen großen Posten waren die Aufwendungen für Strom ca. 4.000 €, Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz ca. 5.500 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 3.000 € und Betriebs- und Schmierstoffe Kfz ca. 2.000 €.
Wenn schon ein permanentes und unüberhörbares „Miteinander-Füreinander“ seitens der CWG-Fraktion und der CDU-Fraktion propagiert wird, warum werden dann in dem Ortsteil Wessin die Kosten drastisch reduziert? Gleichzeitig aber werden für das ARBORETUM zusätzliche Ausgaben bereitgestellt durch einen eigenen Mitarbeiter (Vorsitzender des Fördervereins vom Arboretums Crivitz e. V.), der möglicherweise ebenfalls noch zum Bauhof in Crivitz hinzugerechnet wird! Die jährlichen Kosten für den Crivitzer kommunalen Bauhof belaufen sich auf etwa 630.000 €.
Es stellt sich die Frage, wie eng die Verbindungen zur Stadtspitze sind, von der derzeitigen kleinsten Oppositionskraft als CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) im Stadtparlament von Crivitz, bei der Besetzung von neuen Positionen.
Ist es lediglich eine Frage der Begierde oder handelt es sich hier um ein politisches Kalkül?
Kommentar/Resümee
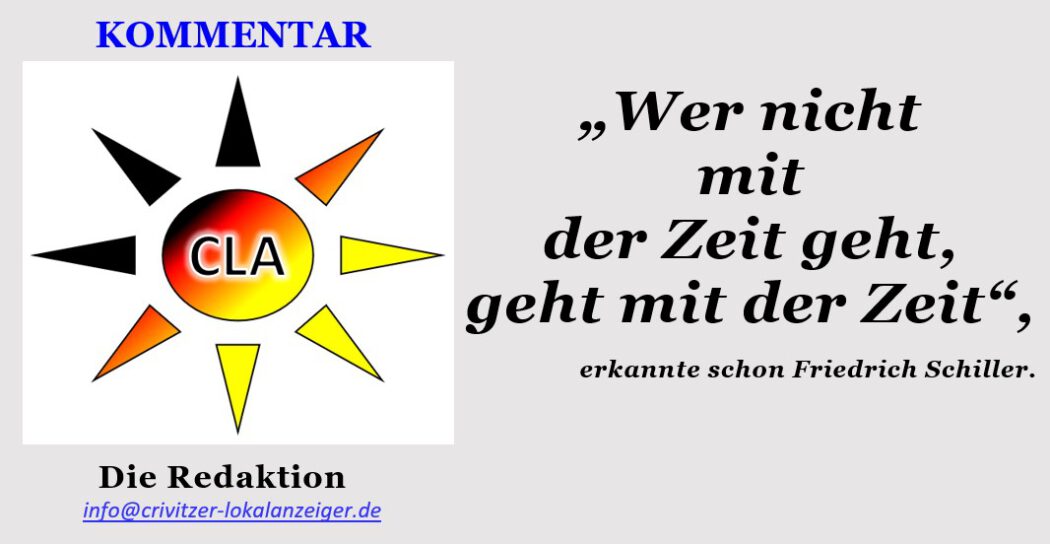
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, erkannte schon Friedrich Schiller.
Eigentlich wollte doch die CDU-Fraktion als Opposition auftreten, aber so gesehen ist man gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode in den Dschungel der Befangenheit und des Mitwirkungsverbots nun selbst eingefangen worden. Die CDU-Crivitz und Umland plakatierten noch großartig vor der Wahl, den Haushalt in Crivitz retten zu wollen und sich für eine verantwortungsbewusste Infrastrukturpolitik sowie Sozialpolitik einzusetzen. Wie bereits erwähnt, ist dass alles vor der Wahl geschehen.
Was für eine Darbietung für den Wähler! Wie auch immer, der Start in die neue Wahlperiode der CDU-Fraktion als kleinste Oppositionskraft ist gelungen und an Peinlichkeit kaum zu übertreffen!
Die Begierde ist ein leidenschaftliches Verlangen, aber einige Protagonisten verleihen diesem Begriff durch ihr Handeln eine gänzlich neue Gestaltungsmöglichkeit in allen Lebensbereichen.
Nach der Wahl ist vor der Wahl!
Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern stellt eine gewisse Endlichkeit dar, weshalb die Wähler bei den kommenden Wahlen sicherlich ein frischeres Auge haben werden!

14.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./388[163(38-22)]/CLA-224/63-2024

Nachdem die Stadtverordneten und die Bürgermeisterin gewählt wurden, geht es nun um die Ortsteile der Stadt Crivitz.
Bereits in wenigen Wochen findet die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung Crivitz statt, auf der auch die Ortsteilvertretungen durch die neuen Stadtvertreter gewählt werden. Leider ist es nach der jetzigen (alten) Hauptsatzung der Stadt Crivitz nicht möglich, dass die Einwohner der jeweiligen Ortsteile selbst ihre Ortsteilvertretung wählen können. Es liegt in der Verantwortung der Stadtvertretung von Crivitz, diese Entscheidung zu treffen, basierend auf der gültigen Hauptsatzung und den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen.
Die Ortsteilvertretungen sorgen dafür, dass die Belange des jeweiligen Ortsteils nicht im Schatten der großen Stadtvertretung der Stadt Crivitz stehen. Die bisherigen Ortsteilvertretungen haben dies bisher gut verstanden. Sie sind verpflichtet, in Angelegenheiten, die den Ortsteil besonders betreffen, ein Votum abzugeben und haben zudem das Recht, Einwände gegen Beschlüsse einzubringen, die den Ortsteil betreffen oder Bestimmungen aus dem Eingemeindungsvertrag betreffen.
Die neue Kommunalverfassung (seit 09.06.2024 in Kraft) sieht allerdings neu vor (im § 42 c Absatz 3): „In der Hauptsatzung kann auch bestimmt werden, dass die Mitglieder der Ortsteilvertretung abweichend von Satz 2 unmittelbar von den Bürgerinnen und Bürgern des Ortsteils gewählt werden.“
Auch ist neu geregelt im § 42 b Absatz 2, dass die Ortsteile selbst eine Einwohnerversammlung einberufen können. „Soweit die Hauptsatzung dies vorsieht, können die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen Einwohnerversammlungen für ihre Ortsteile einberufen, zu denen die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister einzuladen ist.“
Neu ist allerdings auch, dass (nach § 42 c Absatz 3) keine Wahlen erfolgen müssen sondern Zuteilungen erfolgen: „Die Besetzung erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren. In der Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass sich die Zuteilung der Sitze abweichend von § 32a Absatz 2 Satz 1 nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen im Ortsteil richtet.“
Das ist wirklich eine gute Sache, über die unsere Landesvertreter wirklich intensiv nachgedacht haben. Die Anpassung der Hauptsatzung in diesen Punkten wird immer Monate in Anspruch nehmen. Zunächst muss die neue Stadtvertretung ab Juli eine Debatte über die neue Hauptsatzung führen und eine Einigung mit den Fraktionen erzielen. Anschließend muss alles noch einmal von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Es ist zu erwarten, dass das Amt Crivitz bei der Durchführung solcher Wahlen an ihre Grenzen ihrer Belastbarkeit und rechtlichen Aufnahmefähigkeit stößt. Doch das gilt erst einmal nur für die ZUKUNFT, denn unsere bisherige Hauptsatzung (alte – noch gültige) der Stadt Crivitz enthält etwas anderes.
Angesichts dessen gilt das, was in der derzeitigen Fassung der Hauptsatzung steht. Und hier ist nun einmal formuliert:
Für die Ortsteile Gädebehn, Kladow, Basthorst, Augustenhof und Muchelwitz wird nur eine Ortsteilvertretung *Gädebehn* gewählt. Das Gremium besteht aus fünf Mitgliedern; je Ortsteil wird ein Vertreter gewählt. Sollten keine Vertreter aus den einzelnen Ortsteilen gewählt werden, können weitere Vertreter aus den anderen Ortsteilen gewählt werden. Die Wahl findet nach den Grundsätzen der Verhältniswahl statt, wählbar sind Einwohner vorgenannter Ortsteile und Stadtvertreter. Die Wahl des Vorsitzenden der Ortsteilvertretung erfolgt aus der Mitte der Mitglieder.
Für die Ortsteile Wessin, Badegow und Radepohl wird *eine Ortsteilvertretung Wessin*gewählt. Das Gremium besteht aus fünf Mitgliedern, je einem Vertreter der Ortsteile Badegow und Radepohl und drei Vertretern des Ortsteils Wessin. Wenn keine Vertreter aus den einzelnen Ortsteilen gewählt werden, können entsprechend weitere Vertreter aus den anderen Ortsteilen gewählt werden. Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Wählbar sind Einwohner der vorgenannten Ortsteile und Stadtvertreter. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung wird durch die Mitglieder der Ortsteilvertretung aus der Mitte der Mitglieder gewählt.
Wir bitten Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger:
Bitte engagieren Sie sich mit Zuversicht für die Stärkung Ihres Ortsteils! Helfen Sie mit, Ihren Ortsteil zu stärken!
Wir bitten Sie, Ihre formlose und schriftliche Kandidatur frühzeitig an die folgende Adresse zu übermitteln:
Amt Crivitz, Amtsstraße 5,19089 Crivitz: Zu Händen der Amtsvorsteherin Frau Iris Brincker oder Zu Händen der Bürgermeisterin von Crivitz.
Bitte lassen Sie sich den Eingang Ihrer schriftlichen Kandidatur bestätigen.
Vielen Dank
Die Redaktion
13.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./387[163(38-22)]/CLA-224/62-2024
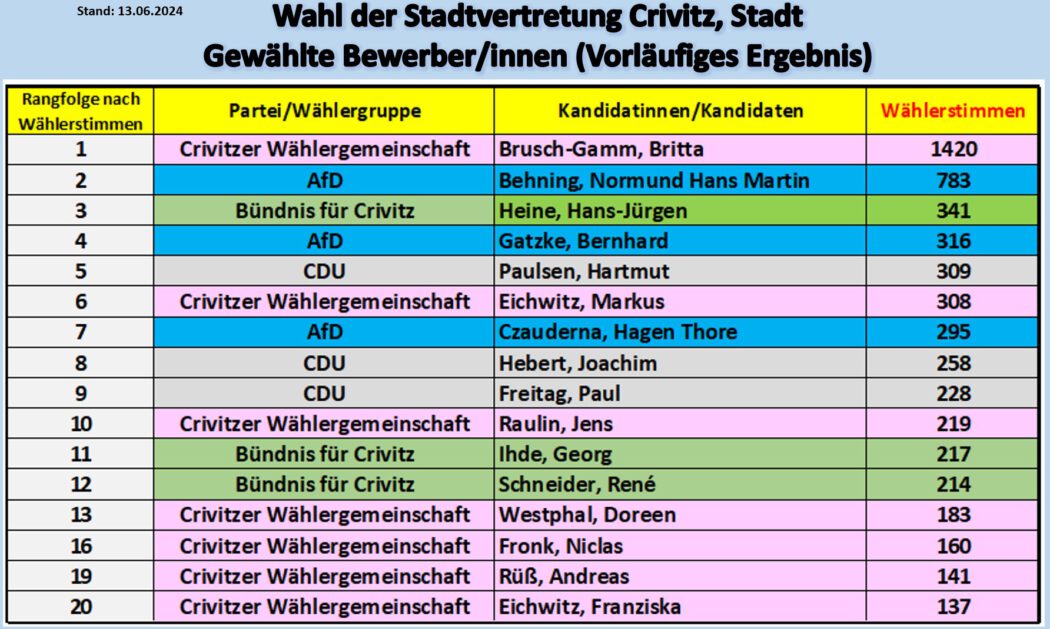
10.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./386[163(38-22)]/CLA-223/61-2024
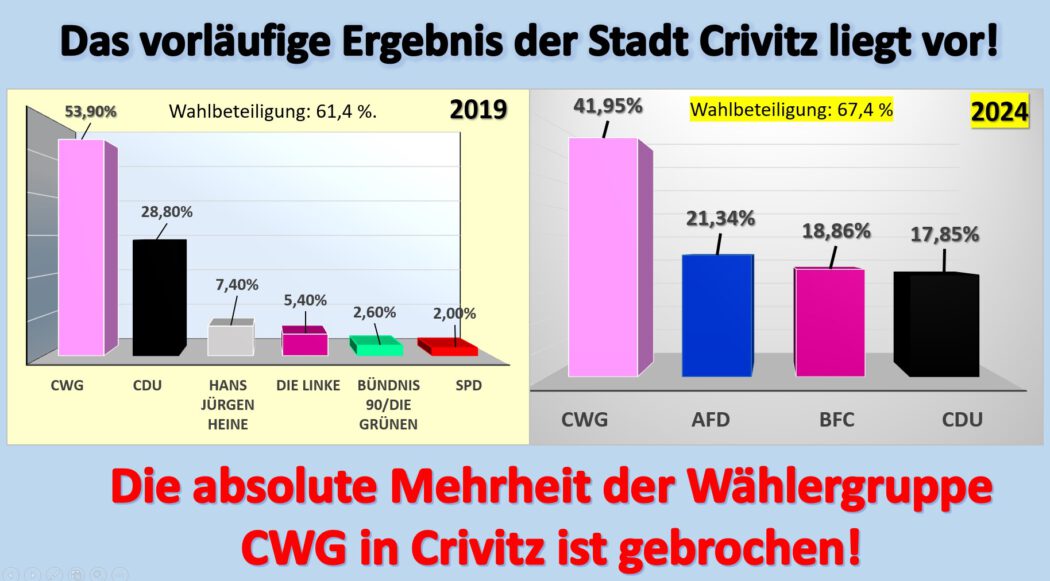
Das große Stühlerücken beginnt, um Posten und Nachrücker zu platzieren, damit die altbekannten Protagonisten wieder auf die Bühne zurückkehren können.
08.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./385[163(38-22)]/CLA-222/60-2024
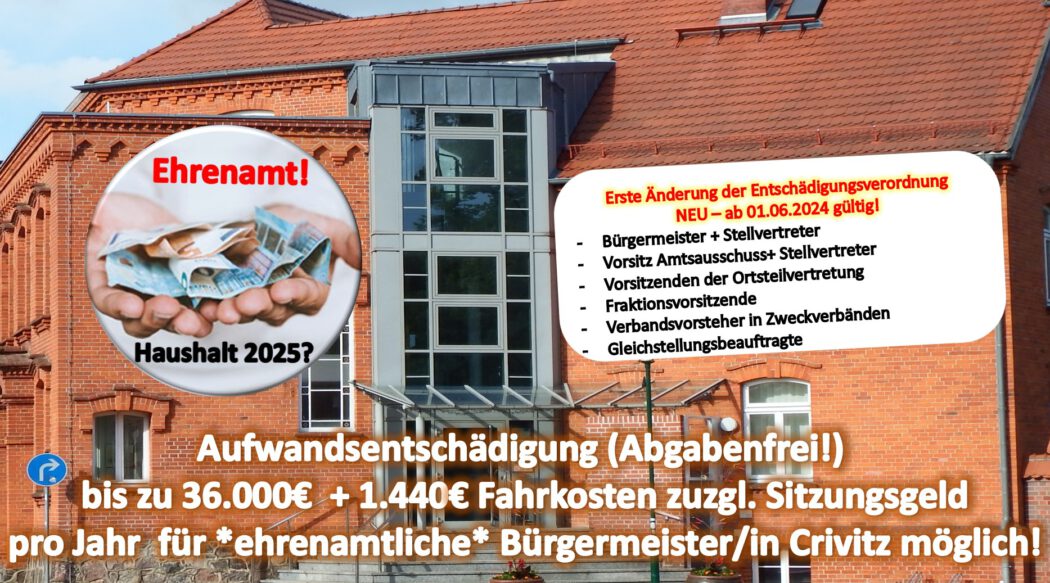
Die Attraktivität eines Wahlamtes soll erhalten bleiben!
Wie bereits die Landräte in MV erhalten auch die Bürgermeister nun mehr Geld.
Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung verordnete bereits am 15.05.2024 eine neue Entschädigungsverordnung. Sie trat am 1. Juni 2024 in Kraft. Demnach können Bürgermeister/innen in *ehrenamtlich* verwalteten Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 4.001 bis zu 5.000 höchstens 3.000 € monatlich erhalten. Das entspricht ca. 36.000 € Aufwandsentschädigungen (abgabenfrei!) pro Jahr.
Für die Stadt Crivitz ergeben sich bei den Entschädigungen als ehrenamtlicher Bürgermeister/in und Fahrkostenerstattung sowie Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + Fraktion + Besuch bei Ausschüssen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen] pro Jahr somit einen Gesamtbetrag von ca. 38.440 €. (36.000 € =Entschädigungen + 1.000 €= Sitzungsgeld + Fahrkosten =1.440 € p. a.).
600 € für den 1. Stellvertreter des/der Bürgermeister/in. Das entspricht ca. 7.200 € Aufwandsentschädigungen (abgabenfrei!) pro Jahr. In Crivitz kommen noch Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + Fraktion + Besuch bei Ausschüssen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+12⌀Ausschusssitzungen] pro Jahr hinzu, das ergibt das einen abgabenfreien Gesamtbetrag von ca. 8.240 €. (Entschädigung= 7.200 € + 1.040 € Sitzungsgeld)
Die Stellvertreter der Bürgermeister/in können eine *monatliche* Aufwandsentschädigung erhalten in Höhe von:
300 € für den 2. Stellvertreter des/der Bürgermeister/in. Das entspricht ca. 3.600 € Aufwandsentschädigungen (abgabenfrei!) pro Jahr. In Crivitz kommen noch Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + Fraktion + Besuch bei Ausschüssen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+12⌀Ausschusssitzungen] pro Jahr, ergibt das einen abgabenfreien Gesamtbetrag von ca. 4.640 €. (Entschädigung= 3.600 € + 1.040 € Sitzungsgeld)
Der oder die Vorsitzende/in des Amtsausschusses können bei über 15000 Einwohnern (das ist im Amt Crivitz der Fall) höchstens 1.800 € monatlich erhalten. Das entspricht ca. 21.600 € Aufwandsentschädigungen pro Jahr.
Welche Motivation treibt Menschen dazu, ein solches Ehrenamt zu übernehmen? Ist es wirklich nur das alte Tauschmittel *Geld*?Eine andere Lösung wäre die erhöhte Anerkennung durch den Landkreis oder das Land oder die Bewohner vor Ort. Es gibt eine Vielzahl von Ehrenämtern in Städten und Kommunen.
Sollten die zahlreichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die ehrenamtlichen Pflegehelfer und die vielen Trainer/innen in Sportvereinen nicht auch mehr Geld bekommen?
Kommentar/Resümee
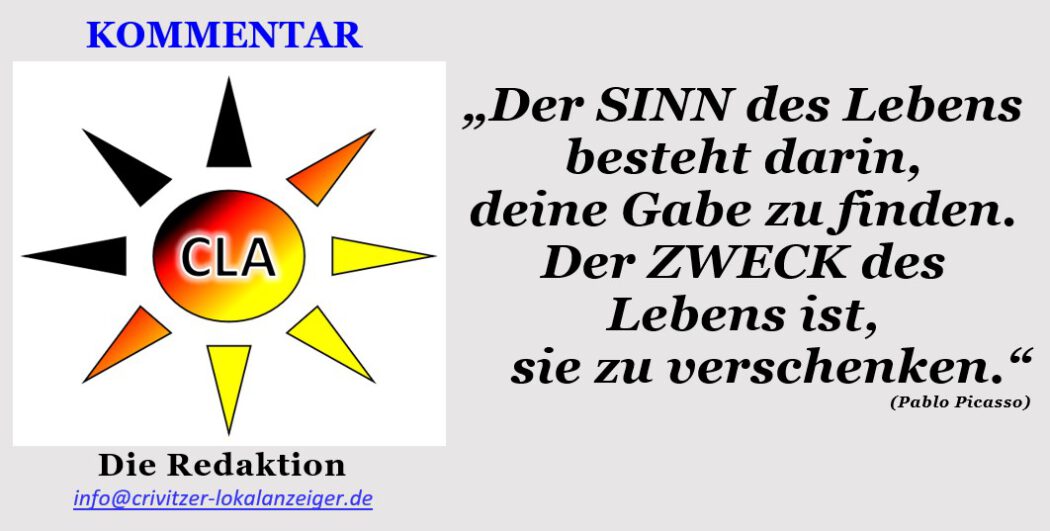
Im Jahr 2015 wurde noch angekündigt, dass man auf 50,00 € bis 100 € pro Monat verzichten möchte, solange sich Crivitz in einer schlechten Haushaltslage befindet. Wird es auch 2024 wieder passieren? Was denken Sie darüber?
Der Steuerzahler wird sicherlich aufmerksam die kommenden Debatten der neuen Abgeordneten verfolgen, da er bereits genügend Steuerlast in Crivitz trägt.
Warum spendet man nicht einfach die Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen an Vereine oder subventioniert das gerade erst erhöhte Essensgeld für Kindertagesstätten und Schulen? Zur finanziellen Entlastung der Eltern!
Dies könnte zumindest ein guter Ansatz nach der Wahl sein.
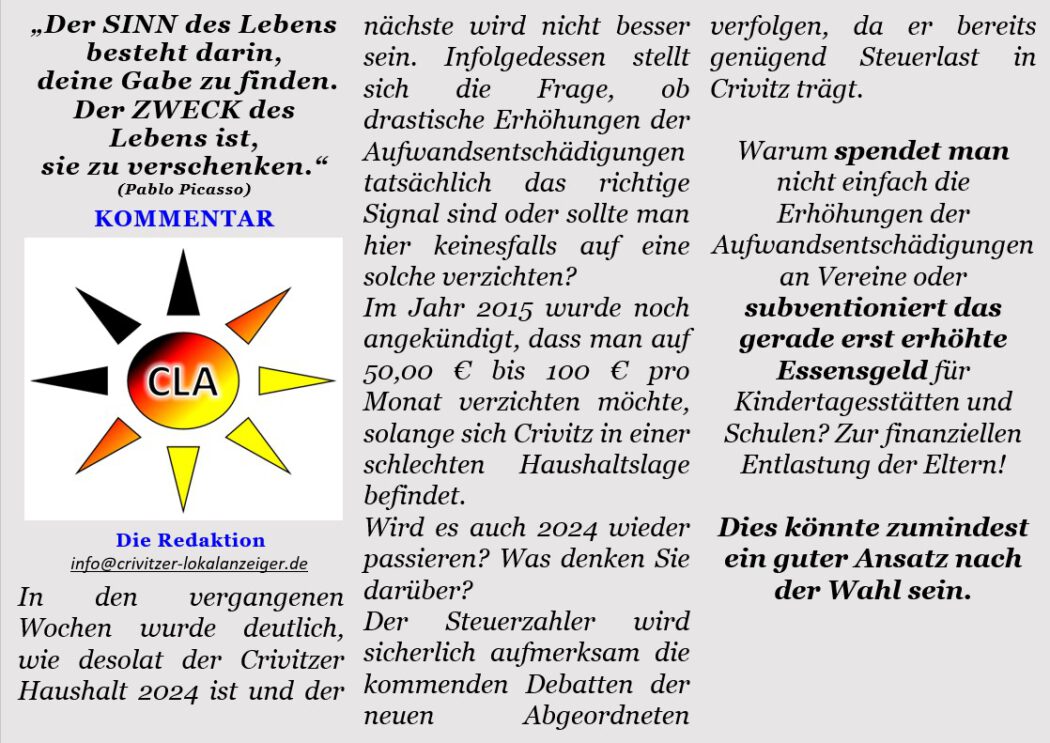
07.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./384[163(38-22)]/CLA-221/59-2024

Wir erinnern uns!
Das Förderprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern „Lebendige Innenstädte – Crivitz mittendrin – Auf der Spur der Fische“ wurde im Jahr 2022 mit einer Förderung von ca. 50.000,00 € gefördert.
So sind von den einst 50.000 € nicht mehr viel übrig und müssen bis Juli 2024 ausgegeben werden, da die Stadt 2023 eine Verlängerung der Ausgaben beantragt hatte nach dem Flop mit dem Citybus.
Die Stadt Crivitz beantragte auch ein „Aktivitätsbudget“. Die Stufe „C = 15.000 €“. Um die Stadtteile nachhaltig zu verbinden, benötigte man einen gebrauchten Bürgerbus (9 Sitze) mit ehrenamtlichen Fahrern für die dauerhafte Verbindung zwischen Alt- und Neustadt sowie Ortsteilen. Aber schon am 26. Juni 2023, also zwei Monate später, wurde festgestellt: Das Projekt wird nicht angenommen. Es entstehen nur Kosten. Trotz allem entschied man sich dafür, die scheinbar geringen Ausgaben, die niemand kennt und die auch nicht veröffentlicht wurden, weiterhin zu finanzieren. Die Anzahl der Fahrmöglichkeiten wurde nun ausschließlich auf den Donnerstag beschränkt.
Kurz darauf wurde aber beschlossen, dass die Stadt Crivitz im Rahmen des Aktivitätsbudgets 10.000 € für einen Bürgerbus beantragt hatte das Projekt einzustellen. Ziel war die Verbindung der Alt- und Neustadt mit ehrenamtlicher Betätigung (Fahrer des Busses). Da sich dieses als schwierig erweist, soll davon Abstand genommen und die Mittel auch für die Imageverbesserung verwendet werden. Die Stadtvertretung beschloss daraufhin, den Bürgerbus nicht weiterzuverfolgen und einen Antrag an den Fördermittelgeber zu stellen, um die geänderte Verwendung der Mittel zu beantragen.
Im Aktivitätsbudget Stufe a = war nun vorgesehen:
– „Jetzt sind die Verkehrsinseln von Schwerin und Parchim stadteinwärts grau gepflastert und zeitweise mit Unkraut bewachsen. Diese wollen wir mit hiesigen Gärtnereiprodukten schöner und so die Stadteingänge einladender gestalten für ca. 4.000 €.“
– „Außerdem benötigen wir ein kleines Werbebudget für Flyer- z.B. für das Angebot des Monats, Straßenverkaufs-Events, aber auch für Werbung auf Social Media. Wir wollen eine Eigenmarke entwickeln und Einkaufstaschen, evtl. auch Mehrwegbecher für Veranstaltungen bedrucken lassen. Dafür benötigen wir etwa 3.500 €.“
-„Imagefilm über die Stadt Crivitz: Zur Mitarbeitergewinnung, aber auch zur Werbung wollen wir in einem Kurzfilm die Stärken und Charme unserer Stadt hervorheben. Das kostet etwa 3.500 €“
– „Stadtspaziergang und Wegweiser: In diesem Jahr haben wir anlässlich unseres Stadtjubiläums begonnen mit einem historischen Stadtrundgang. Einwohner, Heimatvereinsmitglieder und Bürgerhausteam bringen seit einigen Monaten alte Geschichte und Geschichten in einem jährlich erscheinenden Chronikheft zusammen- Hierfür planen wir 5.000 € ein. Der Heimatverein wird spezielle Führungen durchführen, um unser Crivitz bekannter zu machen und zusätzliche Besucheranreize zu geben.“
Die Idee, im Dezember 2021 einen Imagefilm über Crivitz zu drehen, Crivitz-Papiertüten und Trinkbecher mit Logo, stammt nicht aus der Crivitzer Ideenschmiede der CWG und der LINKE/Heine, sondern stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Grabow.
Jetzt also auch in Crivitz ein Werbespot von Bürgern oder mit bekannten Darstellern wie beim letzten Film und sogar eine Wahlwerbung finanziert vom Steuerzahler.
Kommentar/Resümee
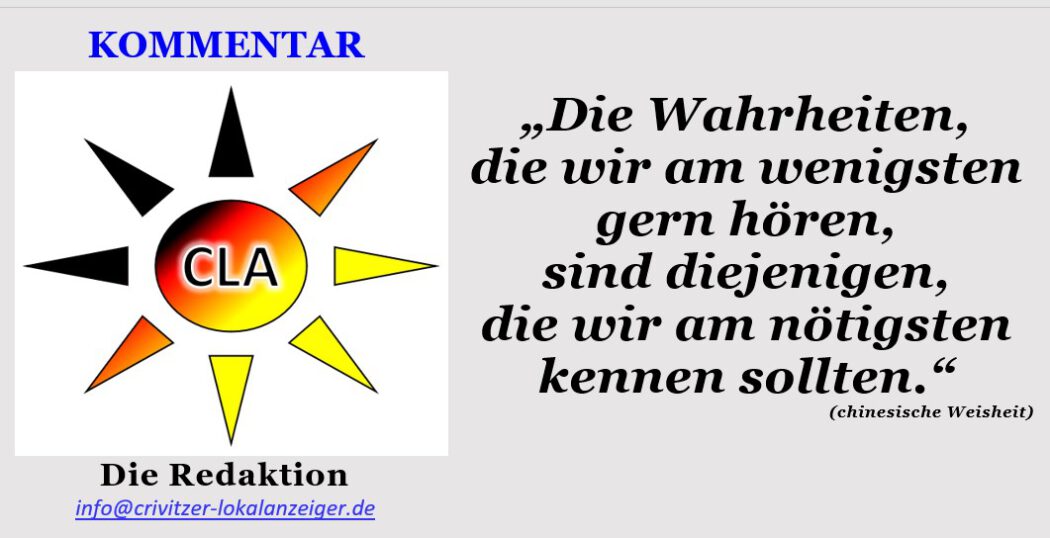
„Die Wahrheiten, die wir am wenigsten gern hören, sind diejenigen, die wir am nötigsten kennen sollten.“ (chinesische Weisheit)
So verkündete bereits am 09.12.2021 der Wirtschaftsförderer (Marc Brendemühl) aus Grabow gegenüber der SVZ: „So würden spezielle ‚Grabow-Einkaufstaschen‘ in größerer Stückzahl produziert und kostenfrei an sie herausgegeben. Wir reden hier von mindestens 1000 großen und ebenso vielen kleinen Taschen. Die Dinger werden richtig gut aussehen. Viele Unternehmer werden sicher nachordern wollen, so der Wirtschaftsförderer. Kunststoffbecher für mehr Nachhaltigkeit. Zudem solle ein neuer Imagefilm für den Standort Grabow produziert werden.“
Da auch Herr Brendemühl eine intensive Beziehung zu Crivitz pflegt und aktiv am Projekt lebendige Innenstädte – Crivitz mittendrin – Auf der Spur der Fische beteiligt war, bot sich eine offensichtliche gemeinsame Ideenfindung an.
Überraschenderweise wird das erst kurz vor der Kommunalwahl durch die Medien beworben und das Bürgerbündnis CWG als Initiatoren hervorgehoben. Richtigerweise sollte die Opposition der CDU-Fraktion ( Crivitz und Umland) nicht vergessen werden, denn sie trug die gesamten Stadtkosten für das Citymanagement mit. Auch im Kulturausschuss war die Opposition aktiv an den Projekten beteiligt.
Wer ist denn nun „WIR“ in dieser Berichterstattung zu dem Projekt?
Allerdings ist gerade Wahlkampf und es ist nur ein Darsteller auf der großen BÜHNE verfügbar.
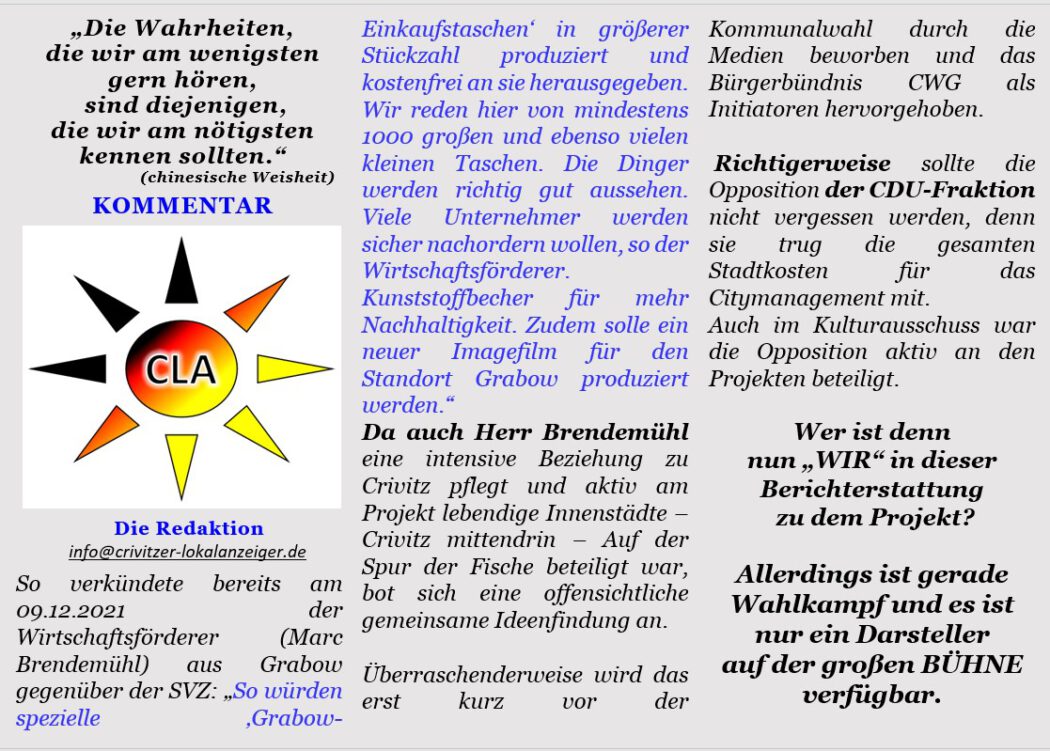
04.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./383[163(38-22)]/CLA-220/58-2024
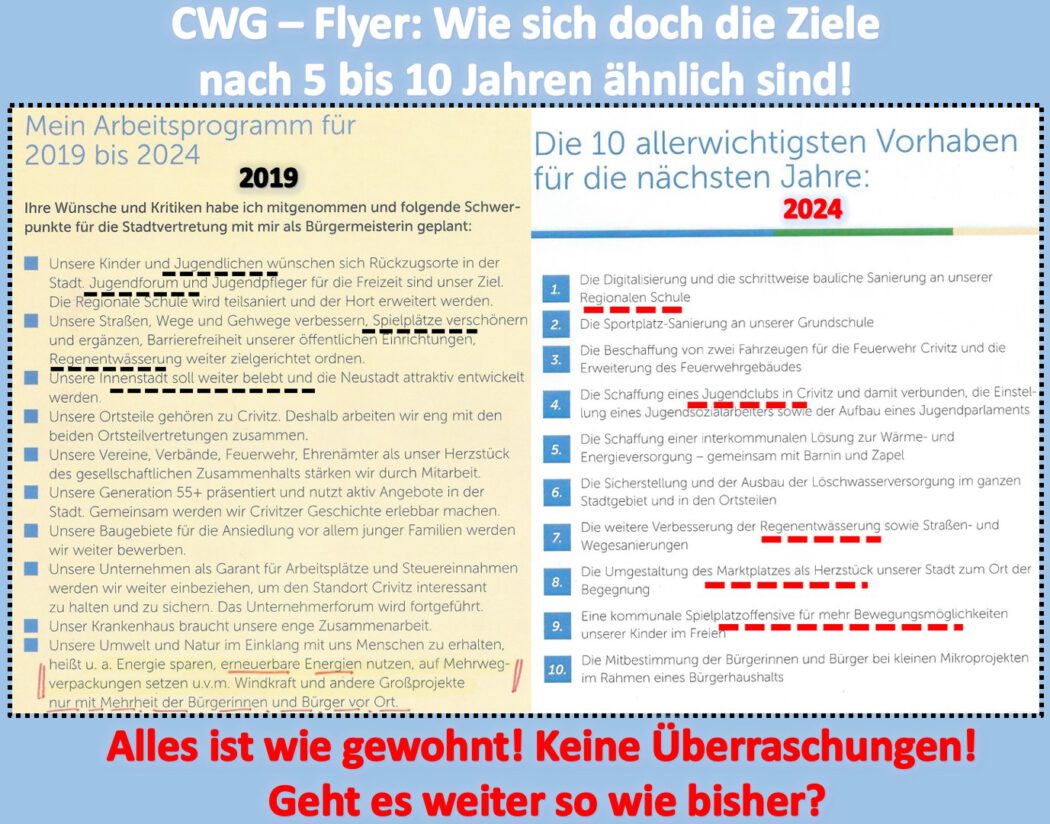
Wo ist das Zukunftsentwicklungskonzept für die Stadt Crivitz? Wir haben es nicht gefunden. Vielleicht ist es Ihnen möglich, es zu entdecken!
Sorry, aber das ist alles andere als neu:
– Die Sportplatzsanierung an der Grundschule ist längst bestätigt und aus den einst veranschlagten 300.000 € sind nun etwa 500.000 € geworden.
– Die Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr wurde bereits beschlossen und wird in den kommenden Jahren in die Haushaltspläne aufgenommen.
– Auch die Einstellung eines Jugendsozialarbeiters wurde bereits im Jahr 2023 beschlossen. Dabei geht es nur noch um die Eigenleistung (Personalkosten) der Stadt Crivitz.
– Der Aufbau eines Jugendparlaments bzw. Jugendbeirates wurde bereits von der CDU-Opposition im Jahr 2021 gefordert und wurde von der CWG und der Fraktion Die Linke/Heine abgelehnt, mit der Begründung, dass dafür auch Leute gefunden werden müssen.
– Die interkommunale Wärmeplanung wurde bereits 2023 beschlossen und muss frühestens 2029 fertig sein. Dann gibt es auch neue Kommunalwahlen.
– Für die Sanierung der regionalen Schule wurden bereits Beschlüsse im Jahr 2023 gefasst, die bis ins Jahr 2028 reichen. Dies ist wirklich keine Neuigkeit.
Könnte es möglich sein, dass diese Themen bereits vor fünf oder zehn Jahren diskutiert wurden:
– Die Umstrukturierung des Marktplatzes ist seit 10 Jahren ein Thema, vom Parkplatz zum Marktplatz als einen Ort der Begegnung zu ebener Erde? Das Springbrunnenprojekt ist noch immer in aller Munde!
– Die Regenwasserentwässerung ist seit 10 Jahren ein Thema, das jedoch zuerst am Geld und am Zweckverband scheitert.
Was ist denn nun wirklich NEU?
– Die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet sowie die Ortsteile. Tja, das steht aber schon im Brandschutzbedarfsplan 2019 und 2024 und scheiterte bis jetzt an den Planungskosten und dem Geld!
– Die Mitbestimmung der Bürger bei Mikroprojekten im Rahmen des Bürgerhaushalts! Dies ist jedoch nicht neu, da es bereits 2021 beschlossen wurde und 15.000 € umfassen sollte. Welches bereits für das Jahr 2022 von der CWG-Crivitz und der Fraktion die LINKE/Heine angekündigt wurde und ebenfalls am fehlenden Geld scheiterte.
Im Wahljahr 2024 soll nun plötzlich alles anders sein, obwohl der Haushalt von Crivitz in eine völlige Schieflage geraten ist, was für eine sonderbare Sichtweise aus dem ideologischen Überbau von oben herab ist. Es handelt sich auch nicht um eine Mitbestimmung für die Bürger, sondern vielmehr um eine Empfehlung der Bürger an die Stadtvertreter!
Was ist seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr vorhanden:
– Die Begriffe Bürgernähe und Transparenz sind in der Beschreibung des CWG- Flyers nicht mehr aktuell enthalten und dass die Mehrheit der Bürger bei Windkraft- und anderen Großprojekten mitreden dürfen, fehlt gänzlich. Schau an!
– Die Barrierefreiheit aller öffentlichen Einrichtungen war noch 2019 ein Renner, aber aufgrund der zunehmenden Demografie und des Seniorenbeirats spielt es nun plötzlich im Wahljahr 2024 keine Rolle mehr für die CWG-Crivitz. Es ist offensichtlich, dass Versprechen hier nicht von Nutzen wären und es zu kostspielig für alle anderen Prestigeprojekte werden könnte.
Es ist alles in allem eine Wandlung der Ansichten und viele Wiederholungen der vergangenen Jahre! Ist dies jetzt wirklich der Fall? Gibt es ein weiteres fünfjähriges „Füreinander und Miteinander“?
So stehen wir wie immer selbst enttäuscht da und sind betroffen – der Vorhang ist bald zu und alle Fragen bleiben offen!
„Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden.“Albert Einstein
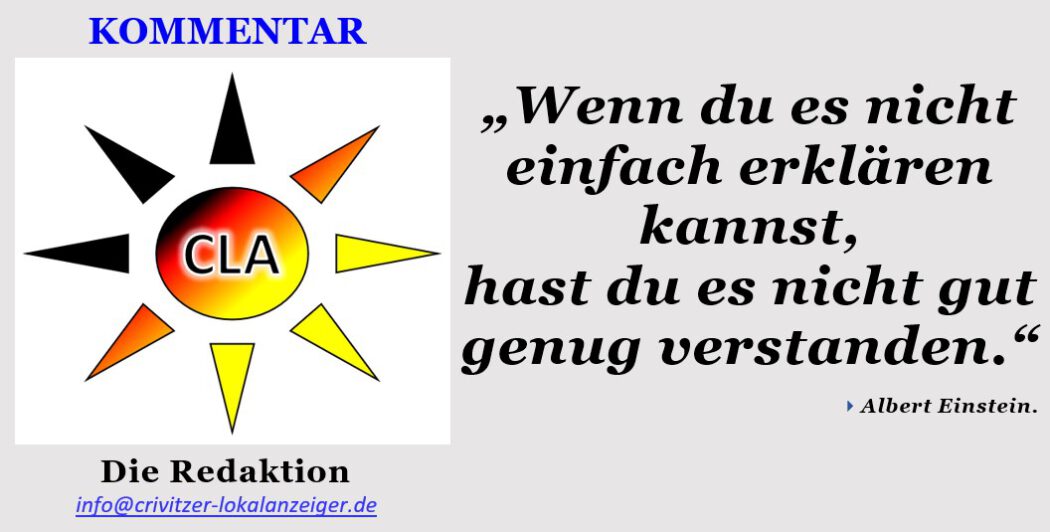
Eine Methode, die von der CWG – Crivitz bereits vor 5 Jahren gewählt wurde: einfach weiterzumachen.
Im Sinne von: Die Dinge fügen sich schon.
Ein einfaches *Weiter so* nach alten Mustern mit „10 wichtigsten Vorhaben für die nächsten Jahre“ wird nicht mehr lange funktionieren und spätestens im Mai 2029 endgültig enden. Es scheint, als ob bereits 2024 Gelder an alle Stellen fließen, die für die Gewinnung von Wählerstimmen wichtig sind.
Was nützen also alle diese bunten Papierflyer für die Wahl im Briefkasten, wenn sich in der realen, wahrnehmbaren Situation für den Bürger nichts ändert? Seit 10 Jahren werden die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Diäten exorbitant erhöht und trotzdem bleibt kein Geld mehr übrig in der Stadtkasse?
Es bleibt zu hoffen, dass die Bewerber für die Ortsteilvertretung nicht ausschließlich aus Handverlesenen von der neuen Stadtvertretung ausgewählt werden, sondern sich auch frei bewerben können.
All das zeigt, die Kommunalwahlen in 5 Tagen sind dringend nötig im Stadtparlament für die Stadt Crivitz. Neue Bürger, neue Argumente wären nicht das Schlechteste für transparente Debatten und Entscheidungen.
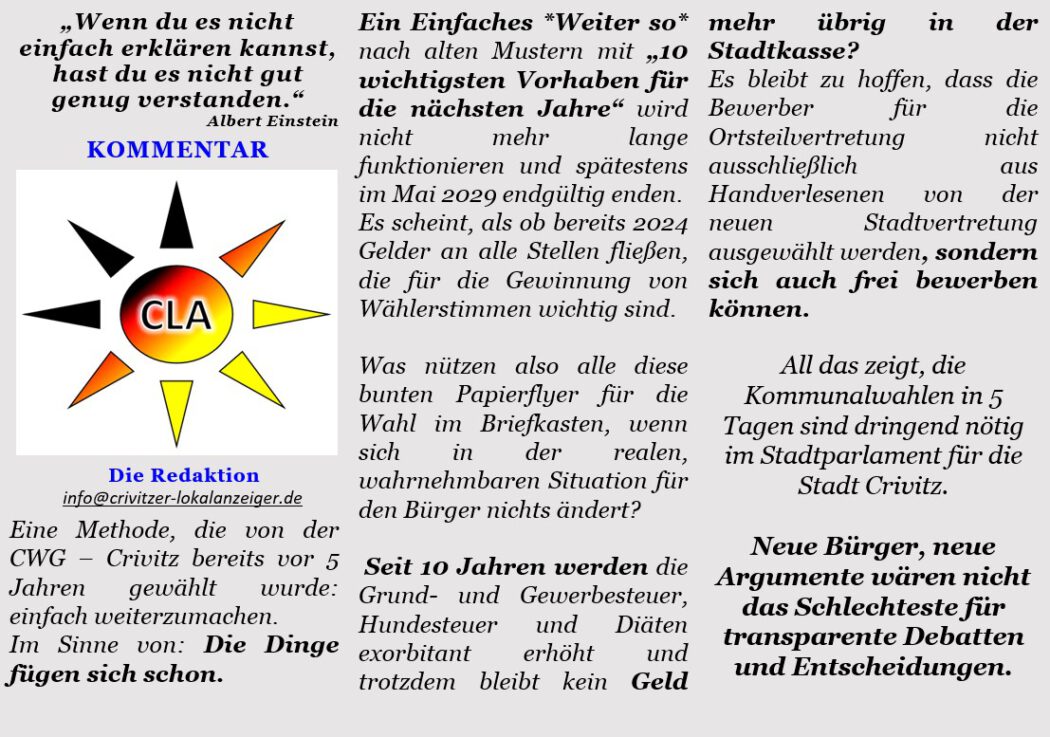
01.Juni -2024/P-headli.-cont.-red./382[163(38-22)]/CLA-219/57-2024
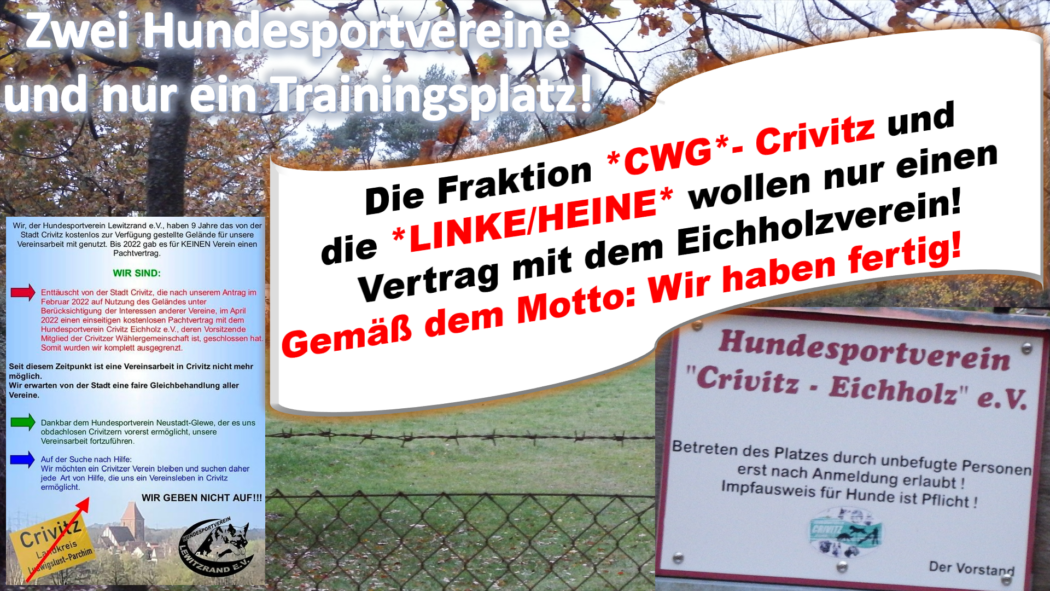
Der Hundesportverein Lewitzrand e. V. schaltet den Bürgerbeauftragten und die Kommunalaufsicht LUP ein.
Das Drama um den Vertrag für die Trainingsstätte in Crivitz!
Es könnte alles so unkompliziert sein! Wieder einmal geht es um personenbezogene Befindlichkeiten und um direkte Kontakte zur Stadtvertretung und eine Machtdemonstration einer Wählergruppe. Zwei Hundesportvereine haben lediglich einen Trainingsplatz, jedoch besitzt nur einer einen Vertrag. Die Mehrheitsfraktionen der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine sind gegen öffentliche Debatten und beabsichtigen, den Vertrag geheim zu halten. Seit einigen Monaten wird über einen eigenmächtig unterzeichneten Vertrag von der Stadtspitze ohne die Zustimmung der Stadtvertretung diskutiert.
Immer mehr Details über den Inhalt wurden bekannt. Seit sieben Monaten bemühen sich die Mehrheit der CWG und der Linken/Heine, öffentliche Diskussionen zu unterbinden, taktieren und spielen auf Zeit bis zur Wahl, um den Hundesportverein Lewitzrand e. V. zu verhindern. Es gibt keinen Grund dafür oder es handelt sich lediglich erneut um persönliche Befindlichkeiten gegenüber Personen.
So auch bei der letzten Sitzung der Stadtvertreter in dieser Woche. Es wurde erneut versucht, den Pachtvertrag mit dem Hundesportverein Crivitz Eichholz e. V. öffentlich zu verhandeln. Die Darstellung der Stadtspitze, dass sie sich in einem vorgerichtlichen Verfahren befindet und daher keine öffentliche Diskussion führen möchte, war wie ein dunkler Schleier. Die CDU-Opposition konnte diesen Argumenten nicht entgegentreten, da man sich wie üblich nicht ausreichend auf seinen eigenen Auftritt vorbereitet hatte. Dennoch besteht weiterhin ein beträchtliches öffentliches Interesse, welches man einfach ignorieren möchte. Fakt ist jedoch, dass es bereits einen Vertrag gibt, der von der Stadtvertretung ohne Legitimation vergeben wurde.
Es waren zahlreiche Mitglieder des Crivitzer Hundesportvereins Lewitzrand e. V. anwesend auf der letzten Stadtvertretersitzung, um ihren Ärger über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wurde, zum Ausdruck zu bringen. Ihre Argumente wurden jedoch ignoriert und schließlich verworfen.
Bereits im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine der Stadt Crivitz wurde am 11. Juli 2023 über das Thema Pachtvertrag für Hundesportvereine debattiert. Dabei wurde von Frau Diana Rommel, damals Vorsitzende des Hundesportvereins „Crivitz – Eichholz“ e. V., darauf hingewiesen, dass für den Verein wichtig ist, „dass der Pachtvertrag weiterhin so Bestand haben sollte“. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar erkennbar, dass hier seit Längerem ein Pflock in den Boden gestemmt werden sollte und eine klare Richtung zum Hundesportverein „Crivitz – Eichholz“ e. V. herrschte. Es ist unverständlich, dass Frau Diana Rommel als sachkundige Einwohnerin im gleichen Ausschuss (CWG – Fraktion) vertreten war und natürlich eine direkte Einflussnahme innerhalb der Stadtvertretung hatte.
Die Mehrheit der Fraktionen der CWG-Crivitz und der Linken /Heine meint, dass der Vertrag ausschließlich mit dem Hundesportverein Crivitz – Eichholz e. V. abgeschlossen wurde und nicht mehr verändert werden darf. Der Hundesportverein Lewitzrand e. V. hat indessen den Bürgerbeauftragten und die Kommunalaufsicht eingeschaltet, um sein Recht einzufordern. Während die Anhörung des Hundesportvereins Lewitzrand e. V. ca. im November 2023 stattfand, hatte die Stadtspitze bereits den Pachtvertrag mit dem anderen Hundesportverein Crivitz – Eichholz e. V. fertig ausgehandelt.
Trotz der dargestellten Ereignisse und der Verweigerung von Auskünften und Befangenheiten einzelner Mitglieder in den Ausschüssen entstehen Fragen.
Es stellt sich die Frage: Warum dürfen nicht zwei Vereine auf einem Hunde-Trainingsgelände trainieren?
Kommentar/Resümee
„Im Dunkeln sieht man nicht so gut, dafür hört man umso besser.“ Marion Gitzel

Ist es tatsächlich so, dass alles im Dunkeln gelassen werden muss?
Haben einige Wählergruppen vor der Kommunalwahl Angst vor einer Kommunikation mit den Bürgern und anderen Meinungen?
Oder wollen sie ihre noch bestehende Position nutzen, um Entscheidungen unumkehrbar zu machen?
Es ist möglich, dass der kritische Aktiv- bzw. Vereinsbürger mit seiner eigenen Meinung recht hat. Und falls es so ist, was ist dann der Fall? Die Darstellung einer Nichtöffentlichkeit zu den Tagesordnungspunkten wird häufig sehr persönlich und einseitig von der Versammlungsleiterin in der Stadtvertretung (Bürgermeisterin Frau Brusch-Gamm) dargestellt und ausgelegt, laut KV M-V. Es ist offensichtlich, dass sich die Stadtspitze hinter der KV M-V versteckt.
So ist man froh darüber und vermeidet Diskussionen mit dem Bürger in den vergangenen fünf Jahren. In einer Demokratie ist es wichtig, die vorhandenen Interessen stets zu berücksichtigen, Kompromisse zu suchen und sie zu finden, um möglichst vielen Beteiligten gerecht zu werden.
Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern stellt eine gewisse Endlichkeit dar, weshalb die Wähler bei den kommenden Wahlen sicherlich ein frischeres Auge haben werden!
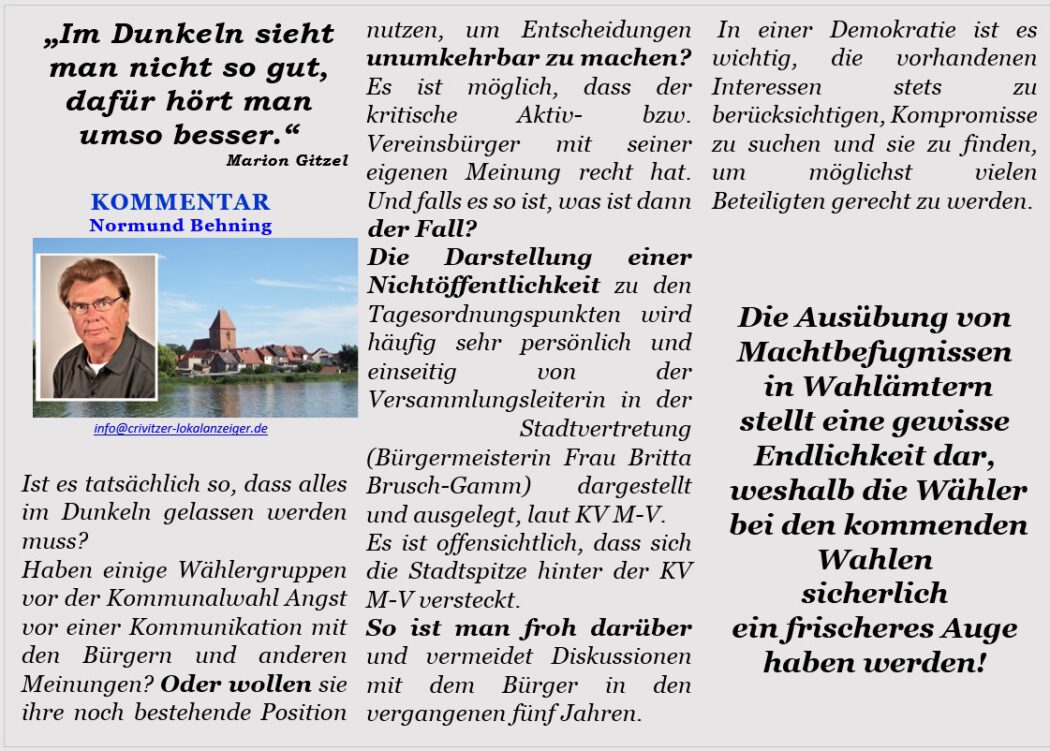
29.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./381[163(38-22)]/CLA-218/56-2024
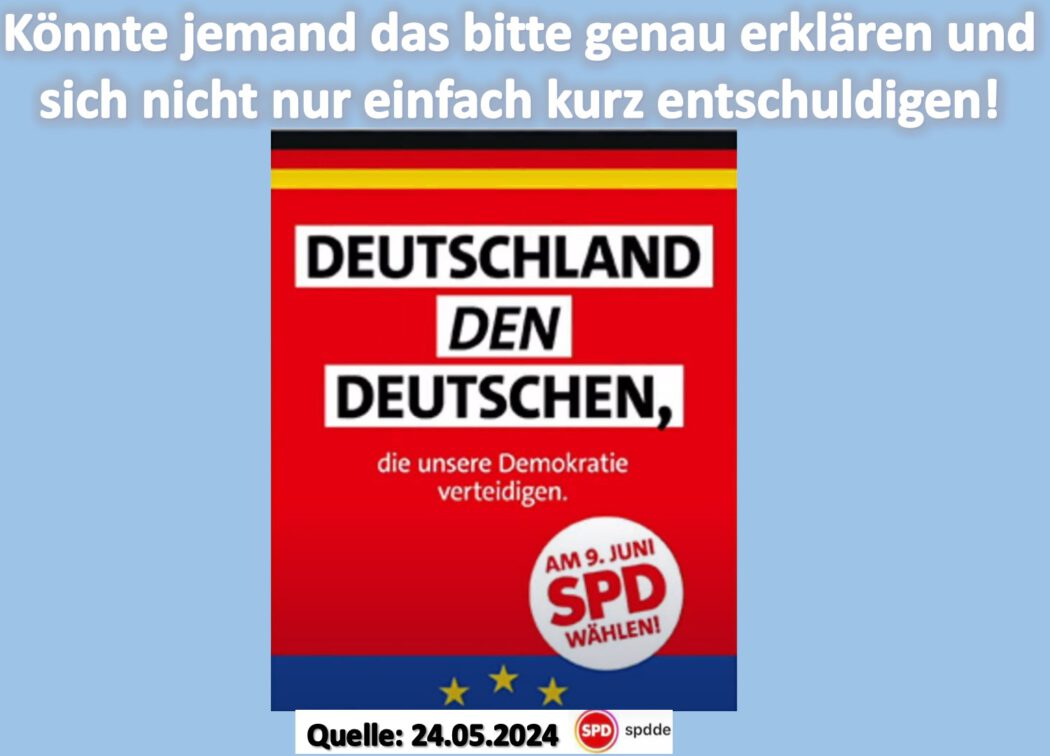
Die SPD entschuldigte sich, weil sie es nicht geschafft habe, „einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt!“.
Ist die simpel formulierte Begründung ausreichend, um das Ganze wieder ins Lot zu bringen?
Soll dies nun ausreichend sein, um eine Erklärung zu liefern, wenn in der gegenwärtigen Wahlkampfphase einige Gerichtsverfahren wegen ganz anderer Angelegenheiten durchgeführt wurden?
Oder handelt es sich hierbei um eine Legalisierung von Sprachgut, gegen die man eigentlich selbst protestiert bzw. demonstriert?
Das Internet vergisst nicht und wird sicherlich den Werbepost so schnell nicht aus den Augen verlieren!
27.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./380[163(38-22)]/CLA-217/55-2024
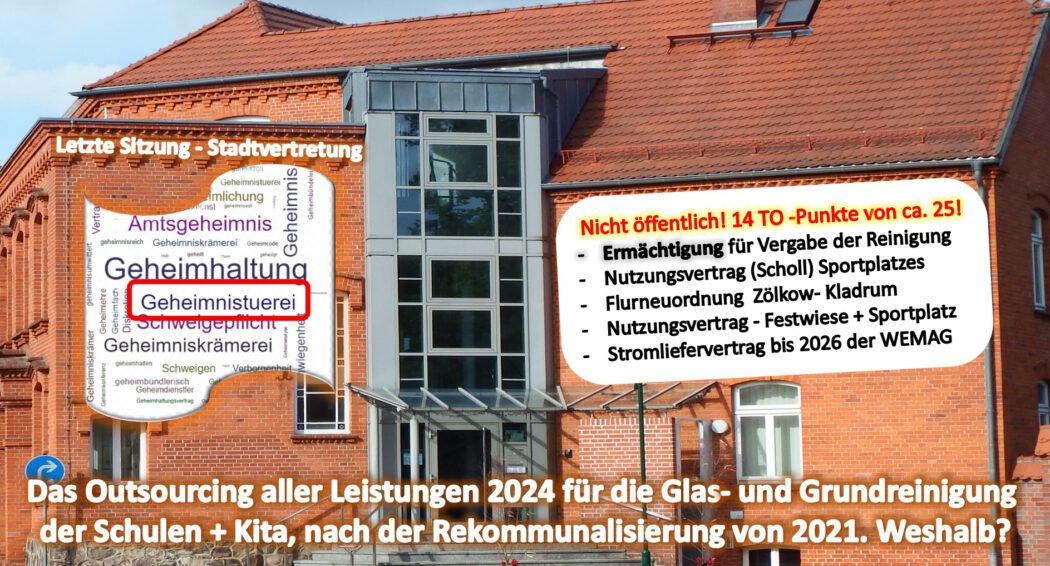
In der Regel gewähren Kommunen in Gremien Einblick in ihre Entscheidungen.
Dennoch wird immer wieder der Vorwurf erhoben, zu viel passierte hinter verschlossenen Türen. In einigen Crivitzer Sitzungen ist es mittlerweile so professionell, dass man plötzlich und unerwartet schützenswerte Daten (also Datenschutz) entdeckt und diese sofort in den nicht öffentlichen Teil der Sitzungen integriert. Der Bauausschuss (Vorsitzender Alexander Joachim Gamm-Fraktion die LINKE/Heine) hat bereits eine sehr effektive Strategie entwickelt in seinen Sitzungen, während die Stadtvertreterversammlung (Versammlungsleitung Frau Britta Brusch-Gamm) im Deklarieren ebenfalls nicht nachlässig ist. Es ist auch in der jüngsten und letzten Sitzung der Stadtvertretung so, dass lediglich fünf öffentliche Tagesordnungspunkte abgehandelt werden, sicherlich wie immer in 16 Minuten. Doch im nicht öffentlichen Teil der Sitzung versammeln sich plötzlich bis zu ca. 16 Tagesordnungspunkte.
Die Voraussetzungen für den Ausschluss der Öffentlichkeit sind allgemein als unbestimmte Rechtsbegriffe „das öffentliche Wohl“ und „berechtigte Interessen Einzelner“. Dies impliziert, dass diese Begriffe nicht durch einen fest definierten Sachverhalt ausgefüllt werden. Ihre Anwendung erfordert eine Einzelfallprüfung auf einen gegebenen Tatbestand. Daher ist es rechtlich problematisch, durch Geschäftsordnungen oder allgemeine Beschlüsse einzelne Tatbestände aus öffentlicher Verhandlung zu eliminieren. Es besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung des Öffentlichkeitsprinzips, da derartige Festlegungen stets einer öffentlichen Verhandlung entzogen werden könnten.
So ist in der Stadtvertretersitzung am 27.05.2024 plötzlich vorgesehen, dass eine Ermächtigung zur Ausschreibung und anschließenden Vergabe der Reinigungsleistungen für Schulen und Kitas im nicht öffentlichen Teil behandelt wird. Sicherlich, um unangenehme Fragen im öffentlichen Raum zu vermeiden.
Etwa 4190 m² an Leistungen für eine Grundreinigung der Grund- und regionalen Schule sowie zuzüglich 1623 m² der Glasreinigung an den Schulen + Kita werden jetzt ausgeschrieben, da die kommunale Reinigung völlig überfordert ist!
Mit einer Forderung einer Ermächtigung will die Bürgermeisterin im August 2024 die Reinigungsleistungen in den Schulen+ Kita von Crivitz ausschreiben!
– Die Grundschule Crivitzeinschl. Speiseraum – GRUNDREINIGUNG = 2.185 m² sowie Kita „Uns Lütten“ = 2.005 m²
– Die Grundschule Crivitzeinschl. Speiseraum – GLASREINIGUNG = 412 m² und Regionale Schule Crivitz = 733 m² sowie die Kita „Uns Lütten“ = 478 m²
Aufgrund der angeblichen Unzufriedenheit mit den ausgeführten Leistungen von beauftragten Reinigungsfirmen bis 2020 beschäftigt die Stadt Crivitz seit ca. 2020 eigenes Reinigungspersonal für die kommunalen Einrichtungen. Die Aufwendungen für 2021 belaufen sich auf ungefähr 377.000 €, für das Jahr 2024 belaufen sich die Kosten auf ca. 710.000 €.
In den Aufwendungen sind ca. 4.300 € auf Leasingkosten für zwei Reinigungsmaschinen, sowie ca. 11.000 € für Abschreibungen, Telefonkosten, Versicherungen, Reisekosten und Kfz-Steuer, Betriebsarzt und Arbeitsschutz enthalten. Die übrigen Ausgaben verteilen sich gesamt auf die Personalkosten für bereits 20 Mitarbeiter + 1 Reinigungshelfer in der Kita im Jahr 2024, wovon für etwa 40.000 € die Personalkosten vom Jobcenter gefördert werden und ab dem Jahr 2025 dann auch wegfallen werden. Die veranschlagte GRUNDREINIGUNG wird voraussichtlich weitere 25.000 € kosten, während die kalkulierte GLASREINIGUNG ebenfalls ca. 23.000 € kosten wird.
Aufgrund der verfügbaren Mittel an Ausrüstung und Geräten sowie der Fertigkeiten der Reinigungskräfte der Stadt Crivitz ist eine kommunale Eigenleistung als Glasreinigung und GRUNDREINIGUNG nicht realisierbar! Das ist schon sehr bemerkenswert!
Um herauszufinden, wie viel die Eigenreinigung der Stadt Crivitz mehr kostet (je Quadratmeter Reinigungsfläche) als die Fremdreinigung, ist natürlich die Anfertigung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse über die Reinigung notwendig. Eine Forderung, die seit Jahren von der Opposition (CDU Crivitz und Umland) erhoben wurde.
Wenn sich die Reinigungskosten innerhalb von drei Jahren um 100 Prozent erhöhen, sollte man wirklich eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen, damit diese kostenrechnende Position (Gebäudereinigung) den Haushalt der Stadt Crivitz in den kommenden Jahren nicht überdurchschnittlich belastet.
Kommentar/Resümee
„Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“(Georges Orwell)

Im Vergleich zur Fremdreinigung ist bei der Eigenreinigung zu beobachten, dass neue Reinigungsgeräte und -techniken bei den meisten Kommunen erst in Reaktion auf Entwicklungen im privaten Reinigungshandwerk eingeführt werden. Ein professionelles Reinigungsmanagement stellt eine unabdingbare Voraussetzung für eine hohe Rentabilität der Gebäudereinigung dar, sowohl für das private Gebäudereinigungsunternehmen als auch für die kommunale Eigenreinigung.
Das betrifft zum einen die Steuerung der Reinigung. Zum anderen die Steuerung der Mitarbeiter und das Überprüfen der Qualität (Qualitätskontrolle). Bei der Fremdreinigung muss die Kommune weder Reinigungsmaschinen und -geräte anschaffen und regelmäßig warten, noch das Know-how für Reinigungschemie und -techniken vorhalten oder das Personal zusätzlich schulen.
Die Fremdreinigung ermöglicht es der Kommune, die Herausforderungen des Qualitätsmanagements weitgehend auf die Dienstleister zu verlagern. Zusätzlich verfügen die Kommunen über Sanktionsmöglichkeiten bei Minderleistung gegenüber der Fremdreinigung, die in der Eigenreinigung (kommunale Reinigung) nicht berücksichtigt werden. Eine Eigenreinigung kann nur sehr eingeschränkt kontrolliert werden, da der organisierende Teamleiter meist auch gleichzeitig der Prüfer für alle zu betreuenden Objekte ist und bei einer Schlechtleistung der Eigenreinigung keine entgeltlichen Sanktionen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu erwarten sind.
Das vorrangige Ziel des Haushaltsrechts ist immer die Deckung des notwendigen Bedarfs der öffentlichen Hand durch eine sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung, denn es handelt sich hierbei um Steuergelder.
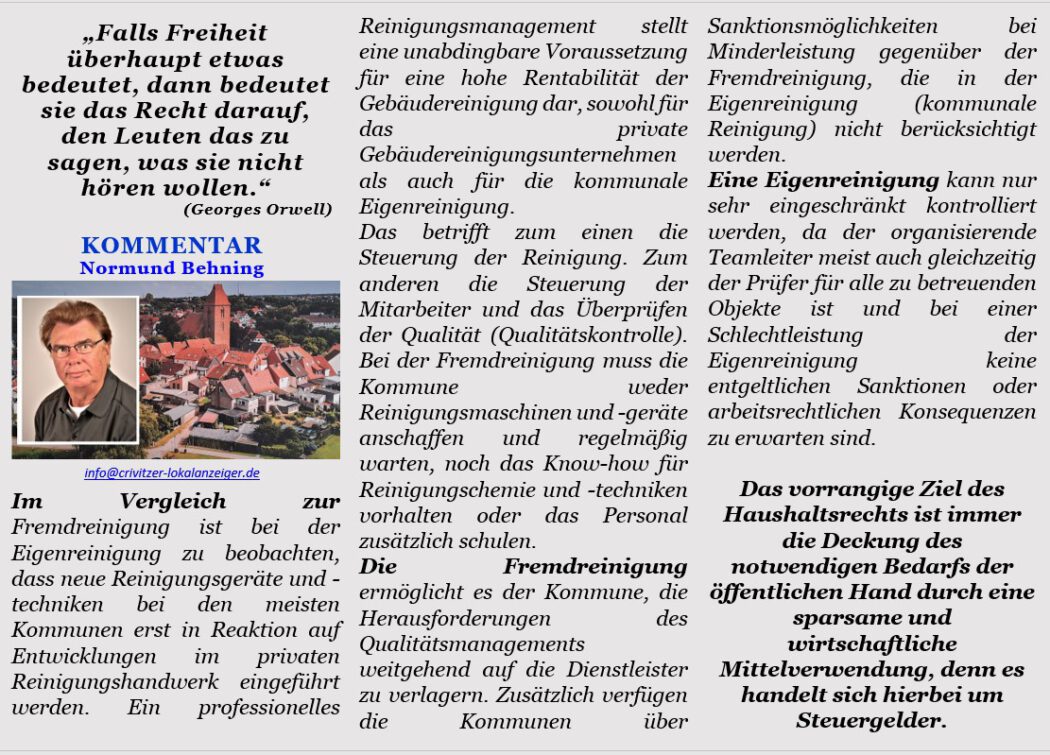
25.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./379[163(38-22)]/CLA-216/54-2024
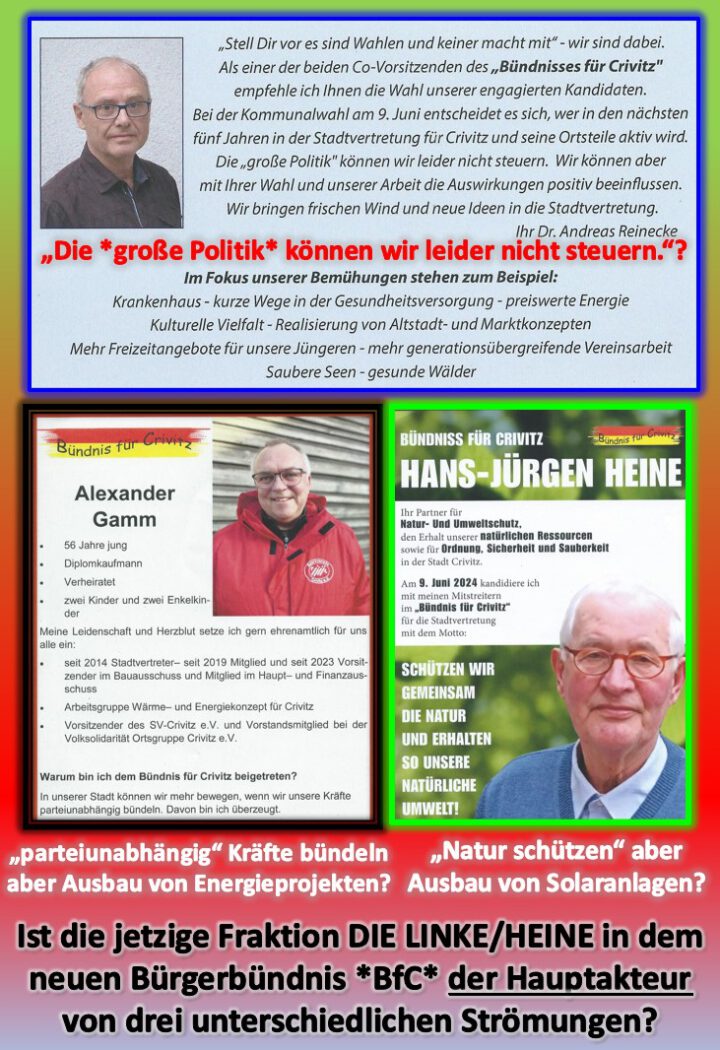
Ursprünglich hätte man annehmen können, dass sich das Bürgerbündnis -Bündnis für Crivitz *BfC* als gemeinsame Wählergruppe darstellt.
Es sieht so aus, als ob der innergemeinschaftliche Druck so groß geworden ist, dass drei SPITZENKANDIDATEN es genau wissen wollen, dank ihrer Extraauftritte!
Der große *Avantgardist* (zurzeit noch Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine) Herr Alexander Joachim Gamm ist Bauausschussvorsitzender und Ehemann von Bürgermeisterin Britta Brusch- Gamm. Er tritt nicht mehr für die Partei DIE LINKE an, dafür aber im neuen Bürgerbündnis *BfC* mit seinen Fraktionskollegen Herr Hans-Jürgen Heine. Man kennt sich halt so! Er liebäugelt schon seit Monaten ganz genau mit einer Mitgliedschaft in der Partei des BSW, wie aus gut informierten Kreisen von den Unterstützern der Partei berichtet wurde. Jedoch ist er bislang nicht Mitglied der Partei geworden. Trotz allem nahm er aktiv an den Unterstützertreffen des BSW in Parchim und Schwerin teil, an dem auch Sahra Wagenknecht anwesend war. Folglich wirbt er nun im neuen Bürgerbündnis *BfC* für eine individuelle Profilierung, da es sich um eine Machterhaltung handelt. Das Bemerkenswerte daran ist, dass er soeben sich vom einstigen Windkraftgegner zum selbsterklärten Experten für die Entwicklung eines Wärme- und Energiekonzepts der Stadt avancierte. Zudem wirbt er für ein parteiunabhängiges Kräftebündnis in der Stadt Crivitz (also Wählergruppe *CWG*und *BfC*) gegen die etablierten Parteien, die sich zur Wahl stellen.
Das ganze Bild in der Einzelprofilierung (Flyer) passt mehr oder weniger nicht zusammen, wenn man gleichzeitig mit einer Parteimitgliedschaft liebäugelt. Wie immer ist es sicherlich eine Prestigefrage neben der Ehefrau und dem Machterhalt!
Der große Mann für die *Umwelt* (derzeit noch 2. Bürgermeister in der Stadt Crivitz) Herr Hans-Jürgen Heine ist auch noch Umweltausschussleiter (Fraktion die LINKE/Heine). Seit einiger Zeit ist er nun aber auch Vorsitzender des Bürgerbündnisses *BfC* und tritt jetzt gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Fraktion DIE LINKE/ Heine (Herr Alexander Joachim Gamm) als Spitzenkandidat an. Mit dem neuen Slogan wirbt diese dafür, eine starke „ALTERNATIVE“ zu den bestehenden kommunalen Kräften aufzubauen und nicht „irgendwelchen Parteien“ das Miteinander und Vorankommen zu überlassen. Der Individualflyer von Herrn Hans-Jürgen Heine erscheint wie die Tagesordnung im Umweltausschuss im alten Format. Der Schwerpunkt liegt auf dem ARBORETUM, dem STADTPARK und -WALD sowie dem Crivitzer See, um die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Gleichzeitig strebt man an, die erneuerbaren Energien, insbesondere die Solaranlagen, auszubauen. Er hat sich bereits mit dem Energiepark in Wessin (20 Windräder) abgefunden, obwohl er vor drei Jahren dagegen war und selbst Gutachten eingefordert hatte. Alles ist Vergangenheit, inzwischen geht es zu neuen Ufern.
Das Gesamtbild in der Einzelprofilierung (Flyer) passt nicht zusammen, wenn man genau die Natur und die Umwelt schützen möchte, jedoch wird genau das Gegenteil durch den Einsatz zum Ausbau der alternativen Energiegewinnung erreicht.
Der *Archäologe* Herr Dr. Andreas Reinecke. Ein Neuling in der großen Kommunalpolitik in Crivitz und wird sicherlich als Zugpferd im Bürgerbündnis BfC im Wahlkampf für alle anderen Mitglieder aus ehemaligen Parteien mit ihrer eigenen Geschichte dienen. Ein ehrliches und engagiertes Interesse, nicht für die Politik, sondern für die Geschichte der Stadt. Denn er wirbt in seinem Flyer damit, dass man ohnehin die große Politik nicht steuern kann. Ist das wirklich so, oder herrscht hier schon ein Hauch von Resignation für politische Angelegenheiten? Sicherlich ist es wichtig, sich mit der Zukunft von Museen, Archiven, Kirchen und Denkmälern der Stadt Crivitz und den Ortsteilen auseinanderzusetzen.
Aber sind dies wirklich die Themen, die die Menschen in Crivitz in der aktuellen Zeit bewegen? Ist es wirklich an der Zeit, als Bürgerbündnis *BfC* heute als erstes Projekt ein „Kriegerdenkmal vom 03.12.1921“ zu restaurieren?
Einige Protagonisten sind einfach nicht in der Lage, loszulassen. Sie investieren ihr ganzes Engagement, um die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu erlangen, als eigentlich notwendig.
Kommentar/ Resümee
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“ Albert Einstein.
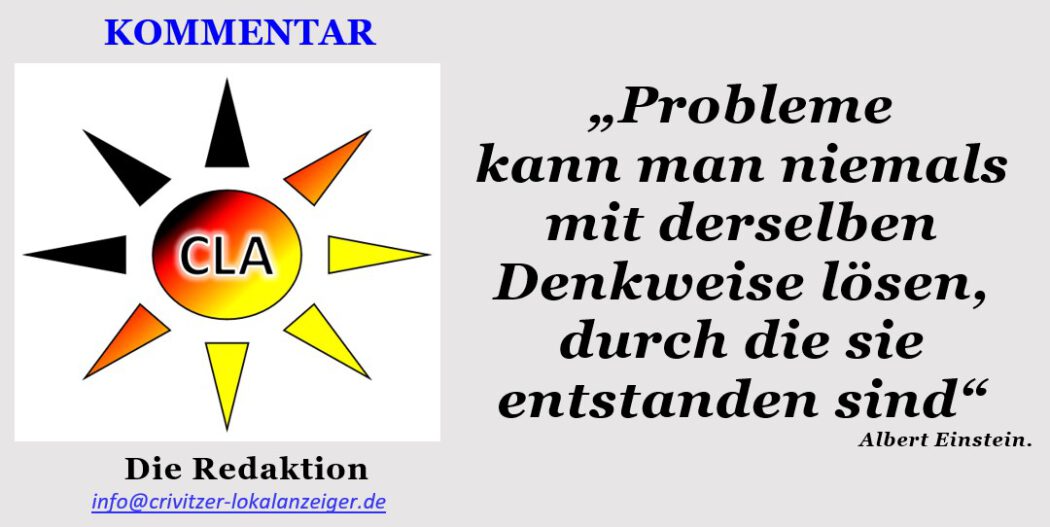
Für einige Akteure stellt es eine besondere Herausforderung dar, die Aufmerksamkeit der Wähler nach fünf Jahren für eine Kommunalwahl zu erlangen.
Wer sich von allen anderen Parteien abgrenzen will und nur zu einem parteiunabhängigen Bürgerbündnis mit der CWG in Crivitz aufruft, gegen die anderen Parteien, um seine eigene Mehrheit zu sichern, kann nicht gleichzeitig ein *Füreinander und Miteinander* propagieren. Die fast gleichen Leute wollen nun alles ändern, was sie in den vergangenen 10 Jahren als vernünftig bezahlte Funktionsträger in der Stadtvertretung vernachlässigt und blockiert haben. Man will sich zwar in neuem Gewand präsentieren, jedoch mit den alten unkorrekten Floskeln und Aussagen in Stichpunkten und von zahlreichen Visionen begleitet!
Der Leidensdruck beim Bündnis für Crivitz *BfC* muss schon immens groß sein, wenn einige Akteure ihre eigene Selbstdarstellung (Flyer) pflegen, wobei eigentlich das gesamte Bürgerbündnis im Vordergrund stehen sollte.
Diese eigenen Selbstdarstellungen sind nicht dafür geeignet, die Restaurierung eines „Kriegerdenkmals“ darzustellen, da es sich lediglich dann nur um ein Schaufenster handeln dürfte. Es wäre sicherlich hilfreich und nützlich, in der heutigen internationalen und europäischen Situation zunächst die Erhaltung und Modernisierung der Gedenkstätte „Todesmarsch nach Schwerin“ und seiner 26 Stelen zu fördern.
Ob die Wähler dies tatsächlich alles auch so interpretieren werden, hängt von den Handlungen der Protagonisten in den vergangenen fünf Jahren ihrer Tätigkeit im Stadtparlament ab!
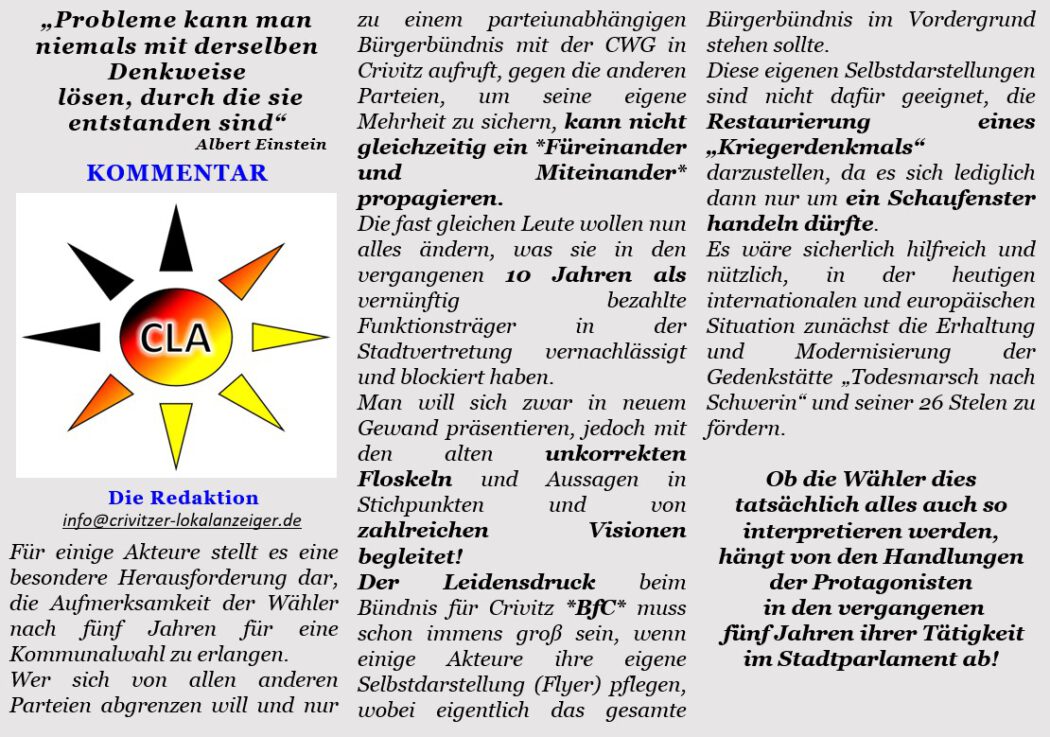
24.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./378[163(38-22)]/CLA-215/53-2024

Die AfD ist die einzige Partei (Ortsgruppe Crivitz und Umland), die Bürgerdialoge direkt vor dem Kommunalwahlkampf den Bürgern in der Stadt Crivitz anbietet und dazu auch jedermann einlädt. Wir haben den Veranstalter gefragt. Warum und was soll das Ziel dieser Einladungen sein?
In einem persönlichen Gespräch wurde uns mitgeteilt, dass die Ortsgruppe der AfD Crivitz in einer Zeit, in der politische Entscheidungen und soziale Veränderungen die Lebensrealität aller Bürger beeinflussen, ihr Engagement verstärkt. Damit die Stimmen der Bürger nicht nur gehört werden, sondern auch in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungsfindung gestellt werden sollen. Sie hatten im Rahmen Ihres jüngsten Bürgerdialogs im „Kulturhaus“ in Wessin die Gelegenheit dazu.
So hat der Veranstalter gesagt:
Das Ziel vom Bürgerdialog ist es, transparent und nah bei den Menschen zu sein. Man wolle eine offene und ehrliche Debatte führen, in der die Bürger direkt mit den Kandidaten kommunizieren können. Es ist ihnen damit möglich, ihre Bedenken, Ideen und Vorschläge den Leuten zu präsentieren, die sie vertreten möchten. Die Kandidaten stammen aus der Mitte der Gesellschaft und verfügen über vielfältige Kenntnisse in Wirtschaft, Bildung, Verwaltung und sozialen Bereichen. Es sei für jeden Kandidaten von Bedeutung, die Interessen der Bürger in den Vordergrund zu stellen.
Zu der Veranstaltung kamen auch der Spitzenkandidat des Bürgerbündnisses für Crivitz *BfC* und jetziger Fraktion Vorsitz die LINKE/Heine, Herr Alexander Gamm, sowie seine Ehefrau Frau Brusch-Gamm, die Spitzenkandidatin der Crivitzer Wählergruppe*CWG* und jetzige Bürgermeisterin ist. Es war erstaunlich, dass Frau Brusch-Gamm dieses Mal Interesse an dieser Veranstaltung zeigte. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann, der sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigte. Dennoch blieb sie bis zum Schluss der Veranstaltung. Allerdings blieben Fragen dieses Mal aus, doch dafür wurden Notizen gemacht.
Das sollte man auch, denn die Kandidaten der AfD-Ortsgruppe präsentierten ihre Ziele nach einer kurzen Einführung und Präsentation. Sie möchten die Chance nutzen, um bei der Kommunalwahl für die Crivitzer Stadtvertretung zu kandidieren und eine Veränderung herbeizuführen.
Ihre Ziele umfassen:
– mehr Transparenz in der Stadtvertretung und in den Ausschusssitzungen zu schaffen und die Mitgestaltung in unserem Grundzentrum Crivitz zu fördern.
– durch eine solide Finanzpolitik die städtische Kasse wieder in Schwung zu bringen.
– die Rechte der verschiedenen Ortsteile zu stärken und ein eigenes Budget für diese bereitzustellen im Haushalt der Stadt Crivitz.
– gemeinsam frischen Wind in den Kommunen und im Kreis zu erzeugen und dies mit Tatkraft und Entschlossenheit.
– eine aktive Unterstützung des Behinderten- und Seniorenbeirats sowie die Schaffung eines Kinder- und Jugendbeirats.
Das Thema der Diskussion war die wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung, Bildung und Kinderbetreuung, politische Kultur und Prioritätensetzung.
Der Landtagsabgeordnete Jahn-Phillip Tadsen befasste sich mit dem Thema Migration und berichtete über seinen Besuch auf Lampedusa. Er hob besonders die Probleme der Sekundärmigration hervor und betonte, dass die Regierung hier bei diesem Thema kapituliert hat und man sich an das Thema einfach nicht herantraut.
Der Landesvorsitzende der AfD, Herr Leif-Erik Holm, freute sich besonders, in Crivitz im Ortsteil Wessin zu sein, da er Crivitz bereits aus seiner Jugend ausgezeichnet kenne. Er ist regional verwurzelt und kennt die Probleme und Bedürfnisse der Menschen. Das spürte man auch bei seiner Ansprache über die Windräder Problematik, wo er sagte: „Die Dinger müssen einfach hier weg.“ Er berichtete über die Finanzpolitik der Regierung und über die aktuelle Haushaltsdebatte. Er sagte, dass man in der Kommunalpolitik keine Brandmauern benötige. Man kennt sich hier im Ortsteil und in der Stadt Crivitz seit Jahren hervorragend. Auf kommunaler Ebene geht es immer um die Sache und die einzelnen Projekte, die gemeinsam zu bewältigen sind. Dazu eignen sich keine Brandmauern-Diskussionen.
Die Redaktion-Fazit:
Der Abend war für alle Beteiligten eine Bereicherung, da sie Gehör fanden und es herrschte eine sehr sachliche und angenehme Stimmung.
Es gab durchaus viel Zustimmung und Applaus, was schon einmal ein gutes Zeichen darstellte. Oder?
22.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./377[163(38-22)]/CLA-214/52-2024
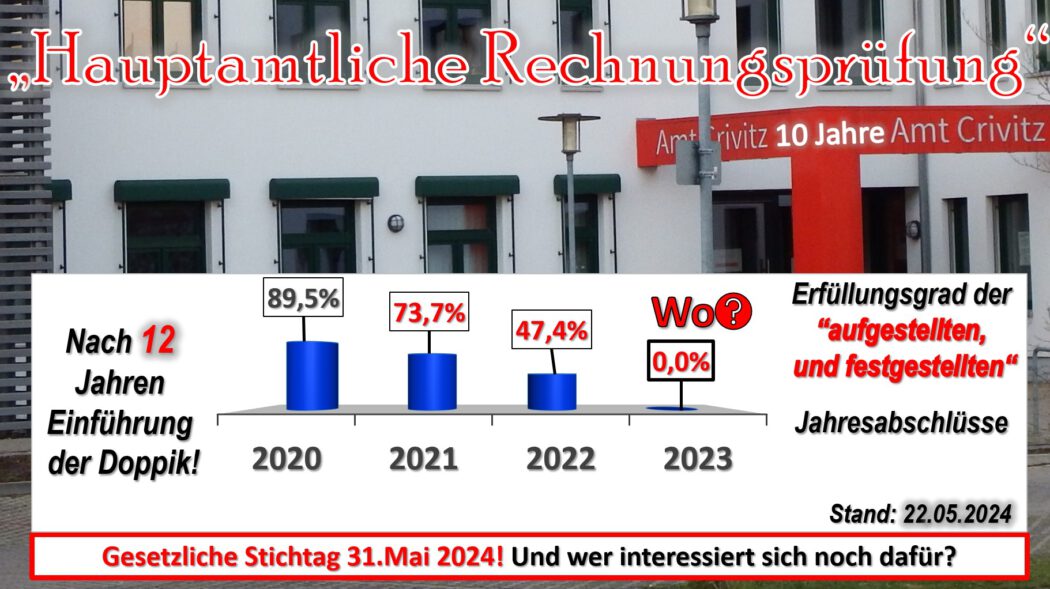
Nach fünf Jahren Arbeit der hauptamtlichen Rechnungsprüfung mit ca. 40 Jahresabschlüssen im Amt Crivitz + Hagenow – Land sollen jetzt noch acht Jahresabschlüsse vom Amt Zarrentin hinzukommen.
Zu diesem Zeitpunkt stehen lediglich zwei Mitarbeiter in Crivitz und einer in Hagenow-Land zur Verfügung. Kurioserweise ist das Amt Crivitz seit drei Jahren nicht in der Lage, seine eigenen Jahresabschlüsse zu erfüllen. Was für ein Wagnis und eine Überschätzung der eigenen Kapazität, nur um die Anforderungen für ein Rechnungsprüfungsamt zu erfüllen? Damit ein Beamter weiterhin als Fachbereichsleiter tätig sein kann und später Amtsleiter werden kann.
Es fehlen seit dem 01.01.2023 noch ca. 17 *aufgestellte*, *geprüfte* und *festgestellte* Jahresabschlüsse seit 2020 für die Kommunen. Seit dem 31.05.2024 müssten weitere 19 Jahresabschlüsse des Jahres 2023 aufgestellt vorliegen, wie es die Kommunalverfassung M-V vorsieht. Es gibt insgesamt 36 fehlende Beschlussvorlagen für Jahresabschlüsse der Gemeinden im Amt Crivitz für eine genaue Haushaltsplanung der Folgejahre Jahre 2025 bis heute. Dabei handelt es sich hierbei um einen klaren Verstoß gegen das Gesetz, doch niemand reagiert darauf. Es ist wahrscheinlich, dass die Behörden in MV bei vorliegenden Beschwerden im Amt Crivitz in absehbarer Zeit genauer hinschauen müssen!
Der Jahresabschluss der Kommunen in MV ist ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts, das seit dem 1. Januar 2012 nach den Regeln der kommunalen Doppik geführt wurde. Gemäß Kommunalverfassung MV § 60 (4) ist der Jahresabschluss innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Dies bedeutet, dass dieser bis spätestens 31.05. des Folgejahres aufzustellen ist und bis zum 31.12. durch die Gemeinde- bzw. Stadtvertretung festzustellen ist. Eine Verlängerung des Termins ist seit dem 31.12.2022 nicht mehr möglich! Seit der Einführung der Doppik 2012, die eine nachhaltige Steuerung der Haushaltswirtschaft anstrebt, ist es dem Amt Crivitz nicht gelungen, dieses Element bei den 17 Gemeinden +Amt +Schulverband umfassend zur Geltung kommen zu lassen.
Warum wird in *aufgestellt*, *geprüft* und *festgestellt*, unterschieden? Nun, die Jahresabschlüsse gelten als aufgestellt, wenn sie durch das Rechnungsprüfungsamt erarbeitet wurden. Danach wird in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Crivitz der Entwurf des Rechnungsprüfungsamtes geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk verabschiedet. Erst dann können die Gemeinden diesen Entwurf durch einen Beschluss endgültig feststellen. Deshalb sind diese wichtigen Unterschiede von großer Bedeutung – aber egal, in Amt Crivitz fehlen seit 2020 viele Vorlagen in allen drei Kategorien. Genau an dieser Stelle liegt das Dilemma.
Nur ein aktueller Jahresabschluss nach dem Gesetz ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit und den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune für die Haushaltsplanungen der Folgejahre zu erkennen und dient als wesentliche Grundlage für Dritte zur Vergabe von FÖRDERMITTELN und Zuschüssen. Ein möglicher Grund für den Verlust von Fördermitteln und Zuschüssen bei fehlenden Jahresabschlüssen der Kommunen in MV ist, dass einige Zuwendungen an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, die durch den Jahresabschluss nachgewiesen werden müssen. Wenn die Kommunen den Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorlegen, können sie die Erfüllung der Bedingungen nicht belegen und riskieren, dass die Zuwendungen zurückgefordert oder verrechnet werden.
Das Amt Crivitz schloss 2021 mit dem Amt Hagenow-Land einen Kooperationsvertrag zur Rechnungsprüfung ab, um die Jahresabschlüsse im Amtsbereich Crivitz endlich voranzubringen. Benötigt werden im Amt Crivitz pro Jahr 19 Jahresabschlüsse und im Bereich Hagenow-Land weitere 20, insgesamt also 37. Zu diesem Zweck wurde zusätzlich ein Rechnungsprüfungsamt gegründet, Mitarbeiter eingestellt und ein Beamter ernannt, der nicht an das Weisungsrecht gebunden ist, um so 20 bis 30 Prüfungen im Jahr zu schaffen.
Nun also werden es 47 Prüfungen pro Jahr sein, durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 167 KV M-V zur Inanspruchnahme eines Rechnungsprüfungsamtes für die örtliche Prüfung. Die Ämter Hagenow-Land und Zarrentin vereinbaren, dass sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Rechnungsprüfungsamt Crivitz beauftragen werden. Das Amt Zarrentin besteht aus vier Gemeinden: Gallin, Kogel, Lüttow-Valluhn, Vellahn sowie der Stadt Zarrentin am Schaalsee. Für die Rechnungsprüfung werden noch ein Amt, ein Schulverband und ein Planungsverband herangezogen. Insgesamt sind also acht Jahresabschlüsse ab 2020 hinzugekommen.
Kommentar/Resümee
„Politik ist der Versuch, die Zeit zwischen zwei Steuererhöhungen zu überbrücken.“ Wolfram Weidner
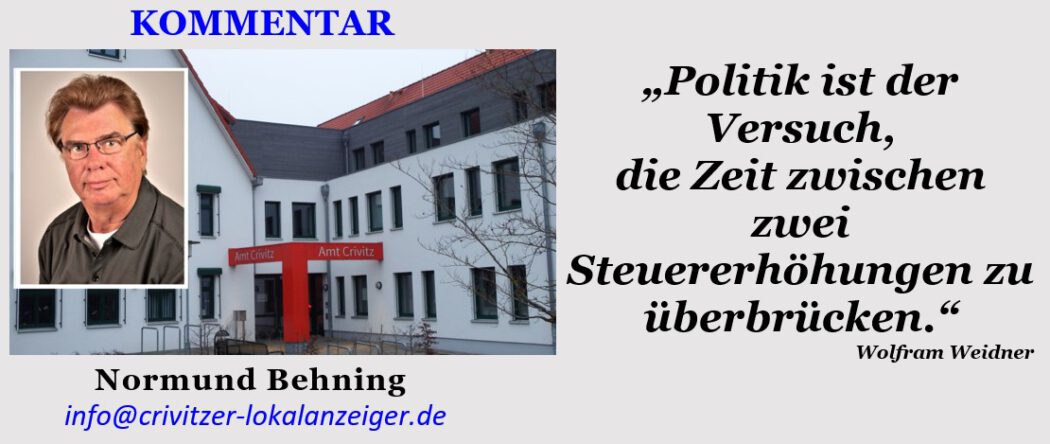
Worin liegt das Problem? Ist es eine Gesetzesignoranz, eine Vorgehensweise oder sogar eine Überforderung der Verwaltung? Wie lange wird dieser Zustand voraussichtlich anhalten?
Der Jahresabschluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft nachweisen. Über Jahre fehlende Jahresabschlüsse sind keine FORMALIE, sondern ein Verstoß gegen gesetzlich normierte Haushaltsgrundsätze und lassen Zweifel an der geordneten Haushaltswirtschaft der betreffenden Kommunen aufkommen. Die Verwendung eingesetzter Steuermittel wird ohne aktuelle Jahresabschlüsse nicht transparent nachgewiesen. Die Doppik soll eigentlich einen erhöhten Transparenzgrad über das Vermögen, deren Bewertung und die Abschreibungen ermöglichen, um eine höhere Informationsdichte für die finanzpolitischen Entscheidungen in der Zukunft zu gewährleisten. Diese wichtigen Elemente der kommunalen Doppik können bei jahrelangen fehlenden Jahresabschlüssen nicht so zur Wirkung kommen.
Das kann zu verschiedenen Nachteilen führen, wie:
–Mangelnde Transparenz über die aktuelle genaue Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune
–Verzögerung bei der Entlastung des jeweiligen Bürgermeisters
–Erschwerte Haushaltsplanung für die Folgejahre 2025/26
–Verlust von Fördermitteln oder Zuschüssen für notwendige Investitionsvorhaben
–Rechtliche Konsequenzen oder Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden.
Auch der Landesrechnungshof des Landes MV hat diese Handhabung mehrfach angemahnt. Die gesetzlichen Bestimmungen und Fristen zum Einreichen der Jahresabschlüsse sind vom Gesetzgeber eindeutig formuliert, mit Stichtagen vorgeschrieben und werden seit Jahren nicht im Amt Crivitz eingehalten. Wann werden endlich alle Aufsichtsbehörden die notwendigen Maßnahmen ergreifen?
Eine Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft für die Rechnungsprüfung kann mit dem derzeitigen Personalbestand nicht die Aufgaben erfüllen. Ab Juni 2024 werden zusätzliche Personal- und Verwaltungsausgaben anfallen, die die Kommunen durch ihre Amtsumlage finanzieren müssen, was letztlich auch die Steuerzahler tragen werden.
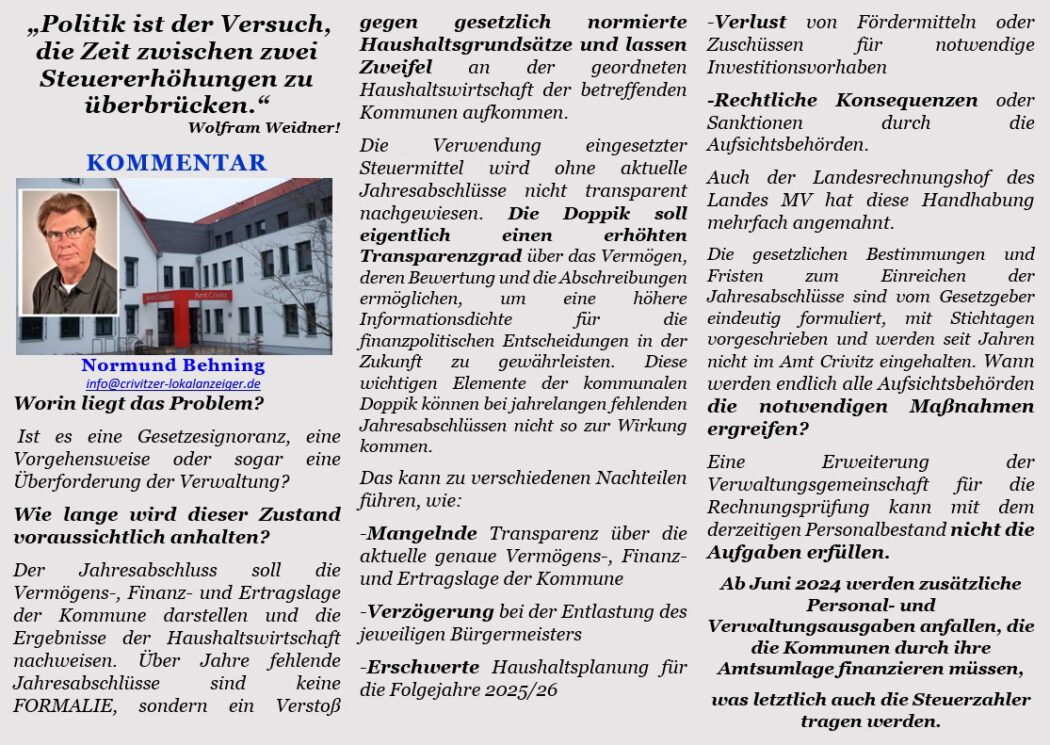
18.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./376[163(38-22)]/CLA-213/51-2024
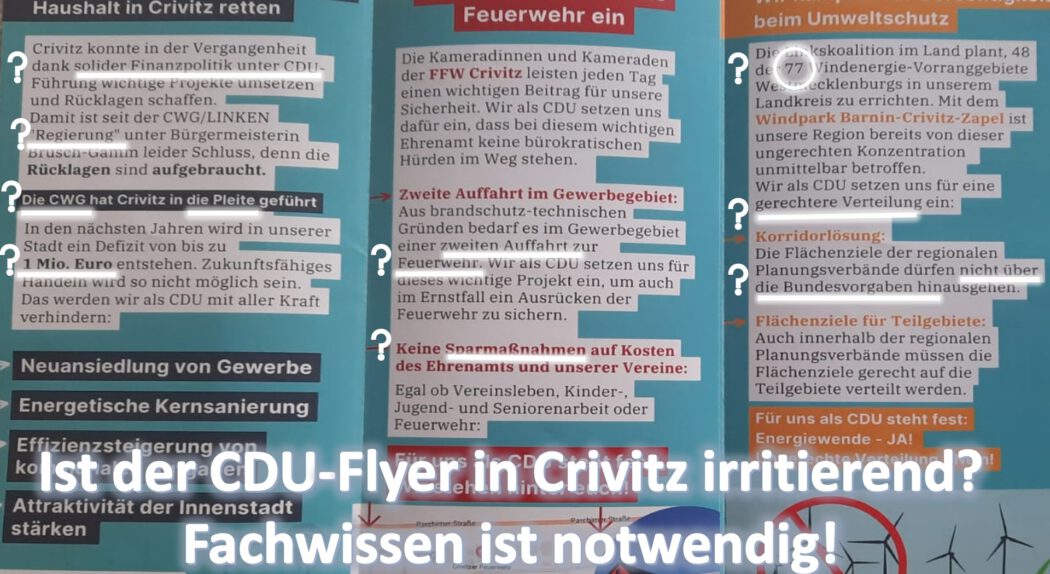
Die CDU-Crivitz scheint schon im ideologischen Überbau zu stecken.
Einerseits beschwören sie in ihrem neusten Flyer eine Pleite für die Stadt Crivitz herauf und haben dafür auch schon einen Schuldigen und andererseits fordern sie eine neue hohe Bauinvestition für eine zweite Zufahrt für die Feuerwehr!
Ein uraltes Thema aus dem Jahre 2022, welchem die CDU-Fraktion selbst durch ihre eigenen Vertreter im Bau- und Hauptausschuss stillschweigend zugestimmt hat (2022 und 2023), es aufgrund der damaligen Haushaltslage zurückzustellen, weil kein Geld mehr da war! Damals wurde die zweite Ausfahrt Gewerbegebiet mit Geh-Wegrückbau und einer Neuanlage für Lkw-Parkflächen in Haushaltsberatungen thematisiert.Die anfängliche Planungsleistung sollte etwa 35.000 € betragen; selbst für die Bauplanungsunterlagen reichte das Geld nicht mehr, weil erst ein Feuerwehranbau und ein Sportplatz für die Grundschule errichtet werden sollten.
Die aktuelle Haushaltslage der Stadt Crivitz wird sich auch nicht bessern, wie die CDU – Crivitz es selbst beschreiben. Weshalb also diese permanente Schaufensterforderung nach dieser Investition, wenn sie vor 2027 gar nicht umgesetzt werden kann?
Hier noch einmal zur Erinnerung:
Folgende Investitionen sind für 2025 noch in der Planung: -Bauhof Crivitz-Anschaffung Baufahrzeug = ca. 145.000€;-Bauhof Crivitz- Anschaffung Transportfahrzeug =ca.60.000€;- FFW Crivitz – Anschaffung -Einsatzleitwagen ca.= 155.000€;-Bauhof Crivitz- Erneuerung Heizung = ca. 55.000€;-Löschteich Wessin ca. 30.000€; -Kreativhaus (Sanierung) ca.200.000€;
Folgende Investitionen sind bereits beschlossen für 2025: – FFW Crivitz – Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses mit Schlauchturm=917.000€; – Straßensanierung Gewerbeallee= ca. 240.000€;3.BA Ortsdurchfahrt ca.= 360.000€; Regionale Schule-Brandschutz 1.Bauabschnitt=235.000,00 €.
Folgende Investitionen sind bereits beschlossen ab 2026: barrierefreien Erschließung und Umgestaltung des Eingangsbereiches für die Regionale Schule =464.200,00 €; Fassadensanierung inkl. Windfänge und Einbau außen liegender Sonnenschutz für die Regionale Schule = 366.700,00 €
Offen sind dagegen die Planungen der Investitionen ab 2027: -Regenentwässerung Parchimer Straße =ca. 130.000€; -Umbau und Neubaugestaltung Marktplatz = ca. ???Mio.€;-Erschließung des Gebiets B-Plan Trammer Straße (Vogelviertel) für neue Wohnhäuser ca.=500.000€;.€;-Erschließung – B-Plan „Auf dem Mühlenberg“ + neue Wohnbauflächen = ca. 360.000€,- 2. Ausfahrt Gewerbeallee ca. 150.000€;
Offen sind dagegen die Planungen der Investitionen ab 2028:-Neue 2. Zufahrt als „Bahn-“ Überführung oder Übergang für das Vogelviertel = ca. 1,3 Mio.€.
Die CDU – Crivitz und Umland hat das Thema Windkraft nun auch im Wahlkampf neu entdeckt, obwohl sie bereits den Energiepark am Umspannwerk in Wessin mit 20 Windrädern völlig akzeptieren. Sie lehnt die Flächenzielplanung (Windparkplanung) des Planungsverbandes WM über die Bundesvorgaben von 2,1 % ab, während im Planungsverband lediglich eine Flächenzielplanung von 1,4 % beschlossen wurde. Was ist das für eine Schaufensterforderung nach Ablehnung, weiß die eine Hand nicht, was die andere tut?
Der Landrat LUP bestätigte erneut auf der jüngsten Sitzung am 14.05.2024, bei der auch Crivitzer CDU-Mitglieder anwesend waren, dass nur eine Planung von 1,4 % der Fläche vorliegt und der Rest wird für die kommenden Jahre geprüft. Übrigens: Auf Antrag des Landkreise LUP in dem auch die CDU- Fraktion vertreten ist!
Liebe CDU-Oppositionskraft „Crivitz und Umland“ der vergangenen fünf Jahre, hier sind eure Irrtümer im Einzelnen:
Zuerst – es handelt sich nicht um 77 Windgebiete, sondern lediglich um 73, wobei die Nr. 70 die Stadt Crivitz, Barnin, Zapel in Wessin darstellt.
Zweitens-, die sogenannte „solide Finanzpolitik unter CDU-Führung“ bis 2013, führte von 2014 bis 2015 dazu, dass die Stadt Crivitz sich in ein Haushaltssicherungskonzept (starke Sparmaßnahmen mit Personalabbau) begeben musste, um eine sogenannte Pleite zu verhindern.
Drittens-, nicht „die CWG hat Crivitz in die Pleite geführt“, sondern der am 24.05.2017 gleichzeitige parallele Baubeginn der Millionen Großprojekte von der Kita + Grundschule sowie regionaler Schule bis 2020 unter Zustimmung der „CDU“-Fraktion Crivitz und Umland. Nacheinander Bauen hätte effektiver funktionieren können. Es war ebenso falsch, die anderen Ausgaben jedes Jahr zu erhöhen und ständig neue Investitionen (ca. 17 pro Jahr) zu tätigen. Es wäre besser gewesen, eine Sparpause einzulegen.
Viertens-, die Stadt Crivitz ist nach dem Haushaltsrecht in MV nicht pleite, sonst wäre schon ein Beauftragter des Landkreises zur Führung der Geschäfte der Stadt zuständig. Die Stadt muss nur ihre Ausgaben in der Zukunft kontrollieren, sonst drohen harte Sparmaßnahmen.
Fünftens-, unsere Stadt Crivitz hat bereits ein Defizit über 1 Mio. EUR. Die noch bestehenden Schulden von 2.003.121,52 € (513.000 € für den Umbau der Grundschule 2019 und 1.787.000 € für den Umbau der Kindertagesstätte „Uns Lütten“2020) werden bis zum Jahr 2040 vollständig beglichen sein. Übrigens: Die Liquidität der Stadt Crivitz im Jahr 2024 beträgt lediglich +125.000 €, was kein Defizit darstellt.
Sechstens, gab es bisher keine Sparmaßnahmen beim Ehrenamt und Vereinsleben oder bei der Kinder- und Seniorenarbeit oder Feuerwehr; im Gegenteil, diese haben sich seit Jahren nahezu verdoppelt. Allein die Abgeordneten erhielten 2022= 46.680,00 € für Sitzungsgelder+ Sockelbetrag und die Feuerwehr erhielt für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Entschädigung von 87.040,00 €. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Kinder + Seniorenarbeit wurde ständig mit 5.000,00 € gefördert, und auch der Seniorenbeirat erhält Sitzungsgeld für seine zwölf internen Sitzungen pro Jahr. Auch das ARBORETUM erhält seine ca. 10.000 € pro Jahr und die Zuschüsse an die Vereine haben sich seit drei Jahren wesentlich erhöht.
Kommentar/Resümee
„Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“Johann Wolfgang von Goethe
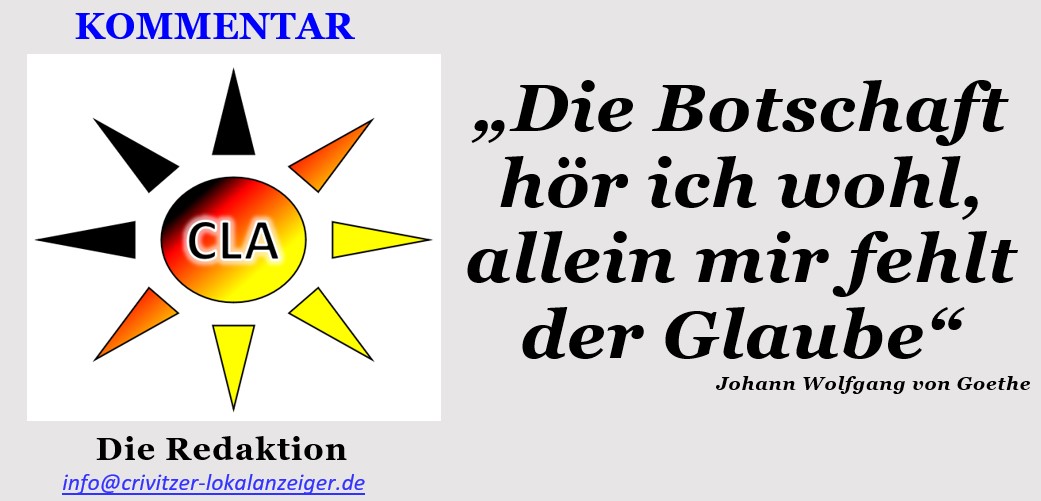
Bereits früher wurde die Glaubwürdigkeit von Flyer-Nachrichten hinterfragt. In der Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung gilt das oberste Gebot: Du solltest nicht die Unwahrheit sagen! Glaubwürdigkeit und Vertrauen müssen über Jahre hinweg erarbeitet werden und können mit einer einzigen Unwahrheit in Sekunden zerstört werden. Der erste Schritt zu einem demokratischen Engagement besteht darin, zu verstehen, wie unser politisches System funktioniert und welche Regeln es folgt.
Zu diesem Wissen gehört nicht nur das Wissen über die Wirkung der eigenen Stimme bei Wahlen, sondern auch das Verständnis, wie und warum Entscheidungen von Politik und Verwaltung getroffen werden (z. B. auf Basis welcher gesetzlichen Grundlagen, Haushaltsrecht und Kommunalverfassungsrecht). Wissen zu erwerben macht glaubwürdig, liebe CDU „Crivitz und Umland“, wenn man sich für Kommunalpolitik interessiert.
Demnach bildet Wissen die Grundlage für die Erlangung von Mandaten im Kommunalwahlkampf.
Übrigens: Auch der Städte- und Gemeindebund e.V. MV bietet Kurse zur politischen Bildung an!

16.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./375[163(38-22)]/CLA-212/50-2024
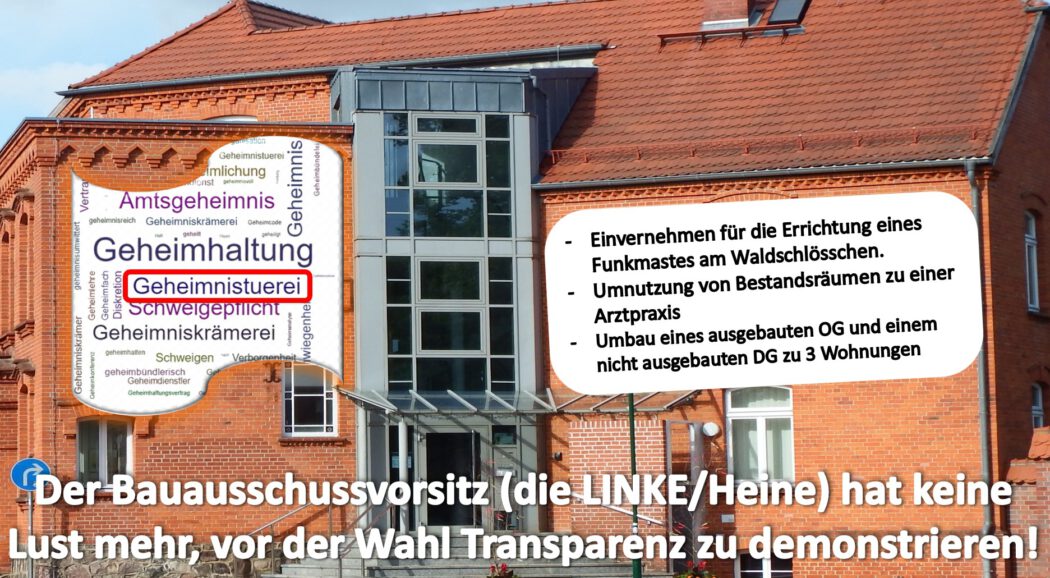
Geheimniskrämerei über Themen, die von öffentlichem Interesse sind, wird einfach in die nicht öffentliche Sitzung verschoben, ohne jemanden zu fragen.
Die Wählergemeinschaft der CWG – Crivitz wirbt seit 10 Jahren immer wieder mit Transparenz und Glaubwürdigkeit. Die Realität sieht jedoch anders aus. Geheimniskrämerei über Themen, die von öffentlichem Interesse sind, wird von vornherein in die nicht öffentliche Sitzung verschoben, ohne überhaupt nur jemanden zu fragen. Eine lieb gewordene Praxis vom Vorsitzenden des Bau-Ausschusses, Herrn Alexander Gamm (Fraktion die LINKE/HEINE) mit Duldung der Wählergemeinschaft der CWG – Crivitz. Aktuell tritt die Fraktion DIE LINKE /Heine geschlossen im Kommunalwahlkampf 2024 für das BFC – Wählergruppe Bündnis für Crivitz an, wie schnell man doch seine Ansichten ändern kann, nur um die eigene Macht zu sichern.
Das Öffentlichkeitsprinzip unterwirft die kommunalen Vertretungen der allgemeinen Kontrolle von außen und soll einer unzulässigen, demokratisch nicht legitimierten Einwirkung persönlicher Beziehungen, Einflüsse und Interessen auf die Vertretung vorbeugen. Es soll der Öffentlichkeit sicherstellen, dass die Bevölkerung sich über die Tätigkeit ihrer kommunalen Vertretungsorgane unmittelbar informieren kann. Dabei sollen die EinwohnerInnen und BürgerInnen auch zur Mitwirkung an der kommunalen Selbstverwaltung angeregt werden. Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Vertretung soll von außen durchsichtig und nachvollziehbar sein. Auf diese Weise soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die kommunalen Vertretungen gefördert werden. Die BürgerInnen sollen aus eigener Kenntnis und Beurteilung eine sachgerechte Kritik an Entscheidungen sowie an einzelnen Mandatsträgern anbringen können und eine Grundlage für ihre Entscheidung bei den nächsten Kommunalwahlen erhalten (vgl. Urteil OVG NRW v. 19.12.1978).
Seit etwa 15 Monaten praktiziert Herr Alexander Gamm, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE/HEINE und Ehemann der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm, als Bauausschussvorsitzender seine ganz spezielle eigene Art des Öffentlichkeitsprinzips nach der Kommunalverfassung MV. Er hat bereits in früheren Zeiten große politische Reden gehalten, doch aufgrund seiner Kenntnisse im Kommunalverfassungsrecht MV und im Baugesetzbuch ist er ständig auf andere Unterstützung und Zuarbeiten angewiesen.
Wenn man das als Bürger in den Sitzungen kritisiert, stellt man ein gelegentliches Überkochen des Vorsitzenden fest. Dies mündet dann wie bereits erwähnt in dem üblichen Zitat: „HIER LEITE ICH DIE SITZUNG UND HIER BESTIMME ICH“. Diese Reaktionen werden seit ca. 2019 von der Versammlungsleitung nicht nur innerhalb der Sitzungen der Stadtvertretung stets toleriert. Außer Herr Gamm leitet die Sitzung selbst im Bauausschuss, dann gilt das sog. selbsterklärende Bestimmerrecht von Herrn Alexander Gamm. Trotz allem genießt er es, am Hebel der Macht zu stehen, auf den er bereits seit Jahren gewartet hat, neben seiner Gattin, nachdem er im Jahr 2017 aus sämtlichen Funktionen der Stadt Crivitz abgewählt wurde.
Der Chef des Bau-Ausschusses, der für die Tagesordnung verantwortlich ist, legte für die kommende Sitzung lediglich die Einwohnerfragestunde öffentlich vor. Doch alle weiteren Aspekte zur baulichen Infrastruktur wie auch zum gemeindlichen Einvernehmen zu den anstehenden Bauvorhaben wurden von alle im vorab als nicht öffentlich eingestuft. Obwohl die Hauptsatzung der Stadt Crivitz sowie die Kommunalverfassung MV eine grundsätzliche öffentliche Behandlung vorsehen, wurde die Beratung über das gemeindliche Einvernehmen für fünf Bauanträge geheim behandelt.
Zu folgenden Bauanträgen:
Neubau eines Carports (Rönkendorfer Mühle), Umbau eines ausgebauten Obergeschosses und eines nicht ausgebauten Dachgeschosses zu drei Wohnungen (Am Markt Crivitz), Neubau einer Funkfeststation (Funkmast) am Waldschlösschen, Umnutzung von Bestandsräumen zu einer Arztpraxis (Amtsstraße 1) und eine Dachanhebung EFH zu Wohnzwecken (Badegow, Unter den Eichen 5A).
Es bestand die Gefahr, dass unangebrachte Fragen von Bürgern gestellt werden!
Ist es tatsächlich sinnvoll, die Entwicklung der Art und Weise der Führung, wie der Bauausschuss der Stadt Crivitz agiert, noch weiter fünf Jahre zu dulden und fortzuführen?
Kommentar/Resümee
Wir benötigen mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit im kommunalen Bauausschuss in Crivitz!
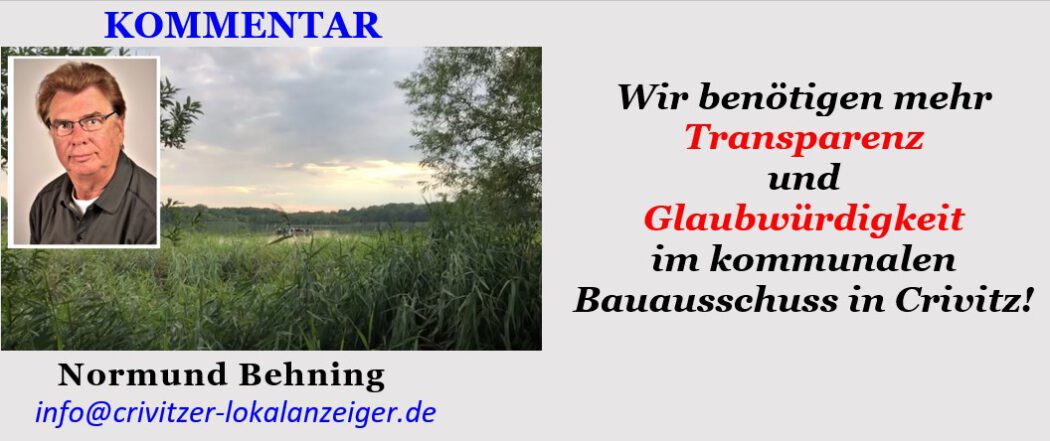
Es kann nicht nur nichtöffentlich verhandelt werden, weil aufgrund ihres Auftretens oder Stimmverhaltens einzelne Abgeordnete Angst vor ihrem Ruf oder sonstigen Nachteilen im Privat- oder Berufsleben haben. Eine solche Denk- und Herangehensweise würde gänzlich dem Sinn des Öffentlichkeitsprinzips widersprechen. Auch Vergaben sind in öffentlicher Sitzung zu behandeln. Der Grundsatz der Öffentlichkeit steht höher als die Geheimhaltungsvorschriften der VOB. Nicht öffentlich darf nur soweit behandelt werden, als Interessen der einzelnen Bieter dies verlangen, wenn z. B. Betriebsinternes, Kalkulationsdaten oder auch Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Bietern dargestellt werden.
Auch die Kommunalaufsicht des Landkreises LUP kritisierte die Vorgehensweise des beratenden Bau-Ausschusses in Crivitz bezüglich der Darstellung der Tagesordnungspunkte bei Bauvorhaben zum gemeindlichen Einvernehmen, die eigentlich öffentlich diskutiert werden sollten. Es ist natürlich erstaunlich, dass die Mehrheitsfraktionen (Fraktion DIE LINKE/Heine + CWG – Crivitz) und auch die CDU-Fraktion Crivitz und Umland der Bürgermeisterin bereits 2019 eine Blankovollmacht erteilt haben. Man könnte auch sagen, dass eine umfassende Ermächtigung in der Satzung festgeschrieben wurde.
Bereits am 01.07.2019 kurz nach der Kommunalwahl ließ sich die neu gewählte Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm durch ihr neu gewonnenes Mehrheitsverhältnis eine Entscheidungsbefugnis übertragen. Nach Beratung im Bauausschuss wird die Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB vollständig auf die Bürgermeisterin übertragen.Eine Macht, die über alle hinausgeht.
Folglich sollten die neuen Abgeordneten ab Juni 2024 einmal überlegen, ob sie nicht auch einmal mitreden möchten, da die Bürgermeisterin häufig sich gegen die Abstimmung im Bauausschuss entschieden hat.
Die Vertrauenswürdigkeit der Wählerinnen und Wähler in die gewählten Kandidaten, ihr Wissen und ihre guten Absichten sind die Grundlagen in der Demokratie. Beide, die Gewählten und die Wähler, müssen mit diesem hohen Gut sorgsam umgehen. Die „Gewählten“ dürfen das nicht durch ihr Verhalten gefährden.
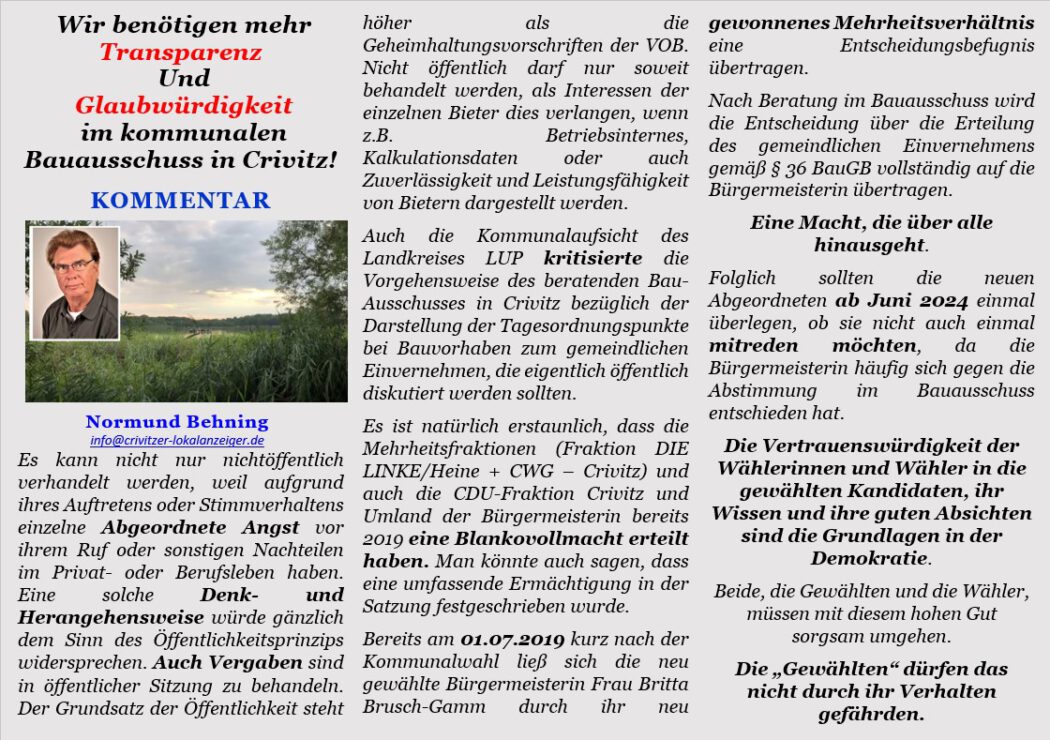
14.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./374[163(38-22)]/CLA-211/49-2024
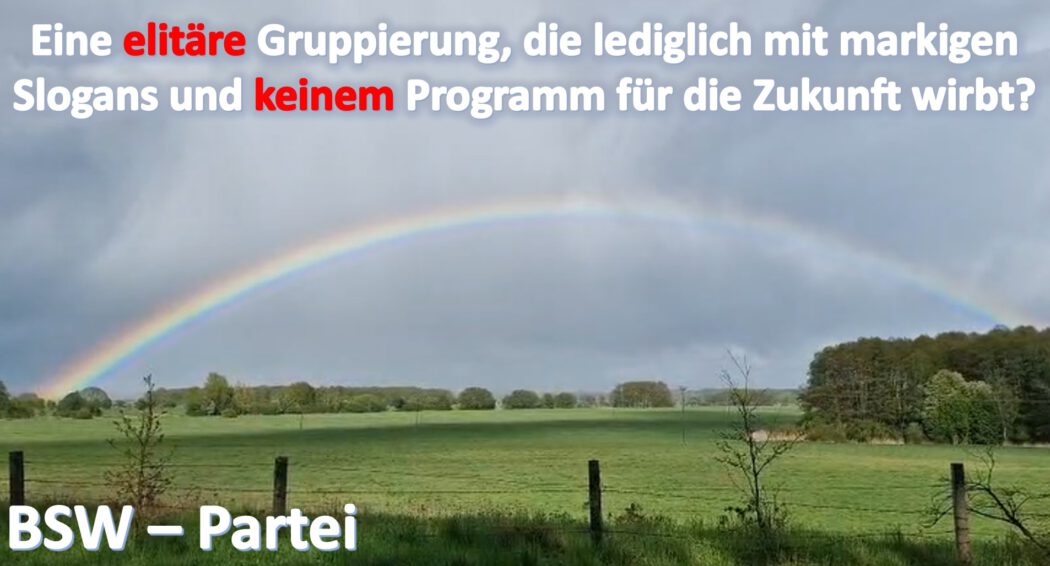
Der ideologische Überbau lässt grüßen!
Am 27. Januar hat sich die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin mit ca. 450 Mitgliedern gegründet. Laut eigenen Angaben strebt die Partei an, bis 2025 nur 2000 Mitglieder zu haben. Dies impliziert, dass nicht jedermann Mitglied werden kann, genauer gesagt, die Mitglieder werden ausgewählt oder der Aufnahmeantrag wird nicht bearbeitet.
Das BSW argumentiert mit der Angst vor Unterwanderung durch Spinner, Extremisten und Glücksritter, ohne zu benennen, wer als Spinner, Glücksritter oder Extremist angesehen wird. Dies führt dazu, dass die Aufnahme von politisch interessierten Bürgern nach eigenem Gutdünken erfolgt. Jede Person kann gemäß Satzung § 4 (6) ohne Begründung abgelehnt werden, ein Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Obwohl das BSW an der Europawahl und den Landtagswahlen in diesem Jahr teilnehmen wird, möchte man bei den Kommunalwahlen in verschiedenen Bundesländern nur „punktuelle“ Listen aufstellen, so Christian Leye. Punktuell‘ genügt dem BSW, um dem Parteiengesetz zu entsprechen, das Wahlantritte auch auf kommunaler Ebene als Aufgabe für Parteien vorsieht. Um flächendeckende Listen für alle Kommunen zu erstellen, sind viele Mitglieder erforderlich, an denen das BSW offensichtlich nicht interessiert ist. Die Absicht, langsam zu wachsen, kann dazu genutzt werden, die Mandate auf Europa-, Bundes- und Landesebene den wenigen Vollmitgliedern nur zur Verfügung zu stellen.
Die BSW-Partei im aktuellen Format erinnert an ein Feudalsystem, in dem die Vollmitglieder die Fürsten sind und die Möchtegernmitglieder das gemeine Volk, das sich zu fügen hat. Kritik ist unerwünscht und kann zu einer Exkommunikation führen. Für das gemeine Volk sollen Fördermitgliedschaften ohne politische Beteiligung, jedoch mit dem Recht, Beiträge zu leisten und ehrenamtliche Wahlkämpfe durchzuführen, von Nutzen sein. Um vielleicht irgendwann später die Vollmitgliedschaft erwerben zu können und in den erlesenen Kreis der „Berufenen“ aufgenommen zu werden. Wenn das Projekt in dieser Form erfolgreich sein sollte, könnte es als Orientierungshilfe für zukünftige elitäre Parteien dienen.
Überspitzt formuliert bedeutet das alles: Dann wäre es auch denkbar, dass in Zukunft sogenannte Promi oder Influencer Parteien das traditionelle Parteienmodell ablösen könnten. Mithilfe von Politagenturen können dann öffentlich bekannte Personen zu Europa- oder Bundestagswahlen antreten. Für 450 ehrenamtliche und unkritische Mitglieder stellen die Firmen maßgeschneiderte Programme und Satzungen zur Verfügung, übernehmen die Kassenführung, das Marketing und die Auslese für alle neuen Mitglieder. Es ist für die Europawahl ausreichend. Gegen einen sogenannten Aufpreis können dann 16 Landesverbände für die Bundestagswahl gegründet werden. Zur Wahrung des Parteiengesetzes werden dann nur punktuelle Gemeindelisten aufgestellt. Es ist nicht vorgesehen, neue Mitglieder zu integrieren, stattdessen werden sie nach Gesinnungsprüfung und der Höhe ihres Mitgliedsbeitrages auf Probe aufgenommen. Sie können jederzeit ausgeschlossen werden.
Solche Parteienkonstellationen könnten sich zu einem lukrativen Geschäftsmodell entwickeln. Dadurch, dass Mitgliedschaften, politischer Einfluss oder sichere Listenplätze mit hohen Spenden erkauft werden können.
Eine Reform des Parteiengesetzes ist dringend notwendig, sonst wird der demokratische Grundgedanke des Gesetzes ausgehebelt.
Kommentar/ Resümee
„Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion um den richtigen Weg. Deshalb gehört zu ihr der Respekt vor der Meinung des anderen.“ Richard von Weizsäcker

Das, was mit Wagenknecht und Maaßen begonnen hat, wird sich fortsetzen. Diese prominenten Ein-Personenparteien sind womöglich medial abhängig, käuflich und beeinflussbar und können austauschbar sein. Sie sind genau genommen im Kern antidemokratisch strukturiert. Sie ermöglichen es den Bürgern nicht, am politischen Leben teilzunehmen, wie es im Parteiengesetz vorgesehen ist. Stattdessen fördern sie ihre Untergebenheit.
Gemäß dem Parteiengesetz (§ 1 Absatz 2) haben Parteien unterschiedliche verfassungsrechtliche Aufgaben. Dazu zählen u. a. die Förderung der Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern am politischen Leben. Die Bürger dazu zu bringen, politische Verantwortung zu übernehmen oder eine dauerhafte lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen aufzubauen. Sie nehmen an den Wahlen im Bund, Ländern und Gemeinden teil.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Ist uns eigentlich bewusst, dass wir neuerdings eine nationale, sozialistische, mit einem Personenkult verbundene Partei im Rennen haben?“. Es ist offensichtlich, dass er mit dieser Aussage den wesentlichen Kern getroffen hat.
Auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow wirft dem BSW vor, mit demokratischen Grundprinzipien zu brechen. „Mit der auf eine Person zugespitzten Organisation wird die Parteiendemokratie ad absurdum geführt“, sagte Ramelow dem Magazin Stern. Der BSW-Landesverband in Thüringen etwa dürfe keine Mitglieder aufnehmen, aber eine Liste einreichen. „40 Mitglieder entscheiden, bestimmen und wählen“, sagte Ramelow. „Und alle anderen aus dem Wartestand können später dann mal ihre Mitgliedsrechte ausüben, wenn es nichts mehr zu verteilen gibt.“ Ramelow hat auch gewarnt: „Hier öffnet sich eine Organisation, die das Parteien-Privileg in Anspruch nimmt, gezielt nicht für ihre Anhänger.„ Entschieden werde „wie früher“ zentral in Berlin.
Daher stellt sich die Frage, ob die BSW-Partei derzeit ihre verfassungsrechtlichen Aufgaben erfüllt und ob sie in der Lage ist, diese in absehbarer Zeit zu erfüllen?
Insofern stellt sich unweigerlich auch die sich anschließende juristische Frage, ob das BSW dem Parteiengesetz entspricht?
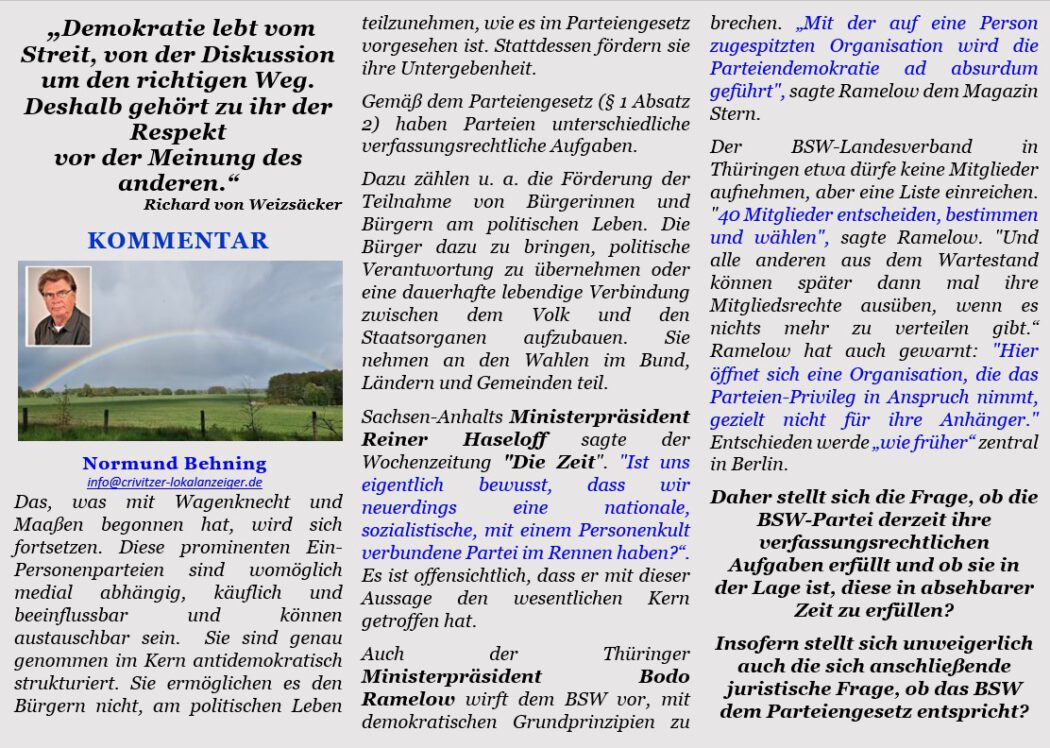
10.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./373[163(38-22)]/CLA-210/48-2024
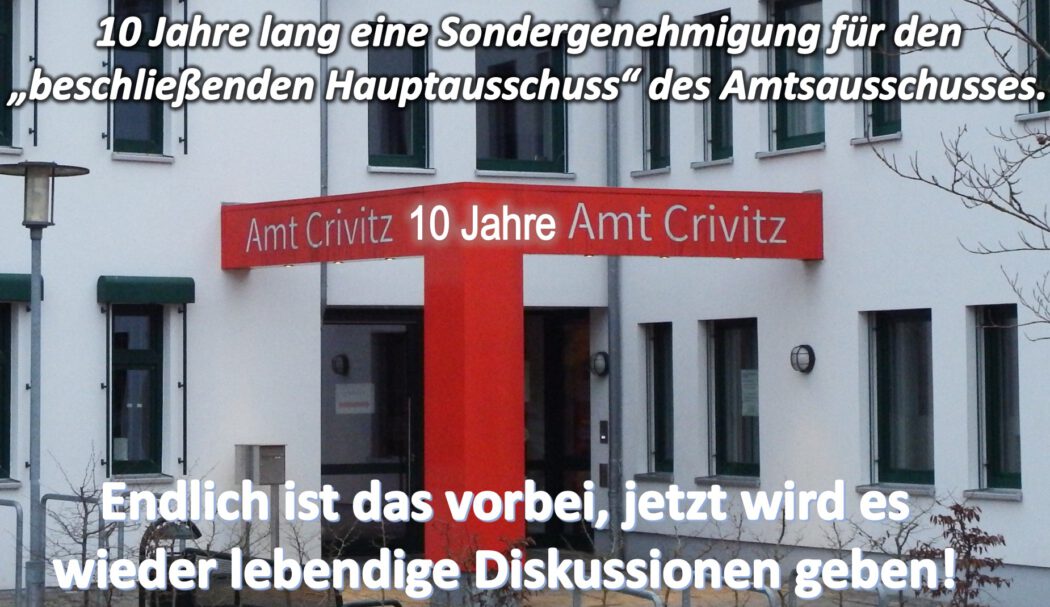
10 Jahre lang war ein Pilotprojekt oder genauer gesagt eine Ausnahmegenehmigung für die Bildung eines „beschließenden Hauptausschuss“ im Amtsausschuss des Amtes Crivitz erlaubt.
Nun aber hat der Landtag bereits am 24.04.2024 ein Gesetz zur Modernisierung des Kommunalverfassungsrechts in MV verabschiedet, welches schon am 10. Juni 2024 in Kraft tritt. In diesen wird geregelt, dass Ämter, die mehr als 19 Mitglieder haben, einen Hauptausschuss bilden können. Bis zuletzt haben das Amt Crivitz und Vertreter des Städte- und Gemeindetages (Was für ein Zufall!) dafür gekämpft, dass die Hürden für die Schaffung eines beschließenden Hauptausschusses in Ämtern schon ab 15 Mitgliedsgemeinden gelten sollten. Der Landtag MV und das Ministerium haben diesem Vorschlag nicht entsprochen. Daher muss die Hauptsatzung des Amtes Crivitz spätestens im August 2024 im Amtsausschuss mit seinen neu gewählten Mitgliedern geändert werden. Endlich können dann wieder rege Diskussionen im Amtsausschuss stattfinden.
Das Amt Crivitz besteht aus 16 Gemeinden und der Stadt Crivitz (insgesamt: 17 Kommunen). Der Amtsausschuss ist gemäß § 134 Abs. 2 KV M-V für alle wichtigen Angelegenheiten des Amtes verantwortlich. Die Kommunalverfassung sah die Bildung eines beschließenden Hauptausschusses auf Amtsebene bis zum April 2024 nicht vor. Nach der Fusion des Amtes Crivitz im Jahr 2014 bestand der Amtsausschuss aus 32 Mitgliedern. Folglich waren sämtliche wichtigen Entscheidungen in diesem relativ großen Gremium zu treffen. Zu dieser Zeit gab es noch großartige Debatten und wirklich gewinnbringende Beteiligungen, darunter viele begeisterte Gäste und Einwohner aus den Gemeinden.
Dies führte jedoch bei einigen Beteiligten zu Frustrationen und man wollte eine schnellere Umsetzung erforderlicher Entscheidungen und viel weniger Diskussionen. Daher beschloss man im Amtsausschuss am 12.03.2014, einen Antrag auf eine zeitlich begrenzte Ausnahme-genehmigung gemäß § 42b KV M-V zur Bildung eines beschließenden Hauptausschusses für eigene Angelegenheiten zu stellen. Das Innenministerium MV genehmigte am 22. April 2014 eine Ausnahme von den Bestimmungen des § 136 Abs. 1 Satz 1 KV MV mit folgenden Nebenbestimmungen für das Amt Crivitz:
1. Die Ausnahme wird befristet bis etwa 25.05.2019.
2. Die Regelung in § 42 b KV M-V (Einführung des beschließenden Hauptausschusses) stellt eine Experimentierklausel dar, die es zu überprüfen gilt, ob sie für andere und zukünftige Ämterfusionen geeignet ist.
Es wurde zwar der beschließende Hauptausschuss für die Bürger zugänglich gemacht, jedoch wurde streng darauf geachtet, dass die Bürger keine Äußerungen zu den anstehenden Tagesthemen tätigen durften. Viele Diskussionen im Amtsausschuss verstummten daraufhin plötzlich, da der elitäre Kreis des Hauptausschusses viele Entscheidungen bereits vorab getroffen hatte und nur noch einige marginale Restdiskussionen übrigblieben. Die Situation wurde von der Amtsausschussspitze auch als eine Form der „deutlich entspannten Debattenkultur“ bezeichnet und hochgepriesen. Im Laufe der Zeit nahmen aber die Besucher im Amtsausschuss ab und die Presseberichte wurden auch immer spärlicher.
Als nun im Jahr 2019 erneut die Kommunalwahl anstand, setzte sich Herr Klaus-Michael Glaser (1. Stellvertreter in eigenem Wirkungskreis der Amtsvorsteherin – Amt Crivitz und Referent im Städte- und Gemeindetag MV e. V.) kurz vor Auslaufen der Befristung für einen erneuten Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung bis 2024 ein. Die Erprobung eines beschließenden Hauptausschusses soll während der Wahlperiode von 2019 bis 2024 fortgesetzt werden. Aufgrund des Vertrauens in die Arbeit des Hauptausschusses und der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen des Amtsausschusses durch den beschließenden Hauptausschuss sei eine breite politische Debatte auf zwei Ebenen gewährleistet. „Insgesamt war eine deutlich entspanntere Debattenkultur zu beobachten.“ (Evaluation der Erprobung-2014) „Der Verzicht auf einen solchen beschließenden Ausschuss sei für das Amt im Grunde genommen nicht mehr vorstellbar.“ (Dr.8/3388)
Und so empfahl man der Landesregierung, den Beschluss eines beschließenden Hauptausschusses auf Amtsebene generell zu ermöglichen. Zum wiederholten Mal hat das Innenministerium die Ausnahme von den Regelungen des § 136 Abs. 1 Satz 1 KV M-V bis 2024 genehmigt. Und so wurden die Befugnisse des beschließenden Hauptausschusses bis 2024 immer mehr erweitert, sodass er letztlich über viele Dinge selbst ohne den Amtsausschuss entscheiden konnte.
Nun aber hat der Landtag MV am 24.04.2024 in seiner Drucksache 8/3388 entschieden. Die Erfahrungen von dem Amt Crivitz zeigen: Ein beschließender Hauptausschuss für Ämter mit vielen Mitgliedern kann durchaus gut sein, um Probleme zu lösen, die nicht so wichtig sind, dass sie vom Amtsausschuss alleine entschieden werden müssen.
Es wird jedoch als zu wichtig angesehen, die Angelegenheiten alleine in die Hände der Amtsvorsteherin und damit der Amtsverwaltung zu legen. „Insofern konnte die von dem Städte- und Gemeindetag MV e. V. vorgeschlagene Erweiterung des Kreises der zur Bildung eines Hauptausschusses berechtigten Ämter durch Absenkung der hierfür erforderlichen Mitgliedszahl des Amtsausschusses von 19 auf 15 nicht berücksichtigt werden.“.
…….“ In der Größenordnung von bis zu 19 Mitgliedern des Amtsausschusses ist daher nicht von einer denkbaren Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit des Kollegialorgans auszugehen, sodass bis dahin an einer Beschränkung der Organisationshoheit auf die Bildung von lediglich beratenden Ausschüssen festgehalten werden soll.“(Dr.8/3388)
Kommentar/Resümee
„Sei geduldig, wenn du im Dunkeln sitzt. Der Sonnenaufgang kommt.“ Rumi
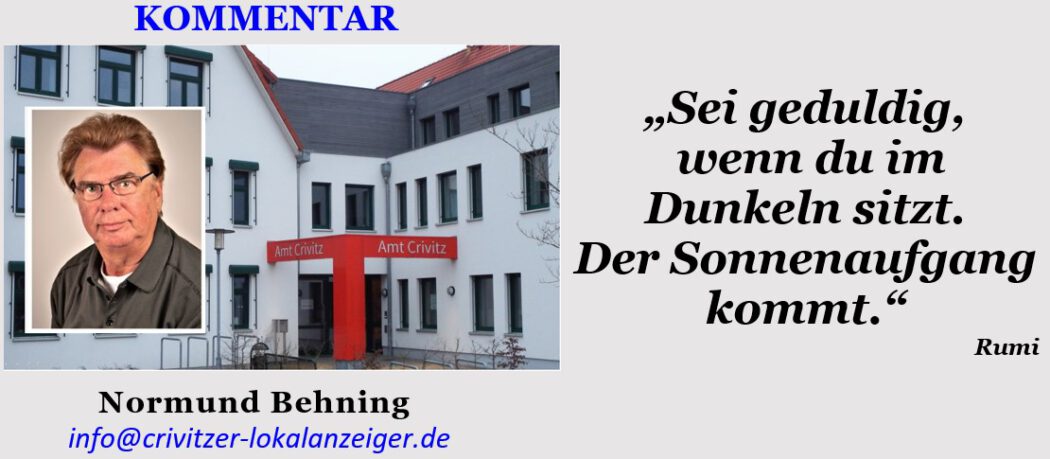
In den vergangenen zehn Jahren fand der beschließende Hauptausschuss des Amtes Crivitz immer wieder in den Räumlichkeiten des Amtes Crivitz statt, zu denen er regelmäßig etwa sechs öffentliche Sitzungen im Jahr abhielt. Die Zahl der Einwohner, die an der Sitzung teilnahmen, war in der Vergangenheit sehr gering und kann an zwei Händen abgelesen werden.
So waren beispielsweise von Januar 2022 bis Mai 2023 keine Einwohner anwesend. Wie gewohnt waren die Sitzungsteilnehmer unter sich und das Erstaunen war groß, als plötzlich einmal Einwohner auftauchten. Die Versammlungen nahmen plötzlich einen gänzlich anderen Verlauf und es war eine Zurückhaltung mit persönlichen Meinungen zu erkennen. Das Reisefieber ist auch seit Juli 2022 bei der neuen Amtsvorsteherin Frau Iris Brincker als Ausschussvorsitzenden angekommen. Man wechselt plötzlich häufiger die Tagungsorte, die neue Reisekostenverordnung macht es eben möglich. Wie bereits erwähnt, war man nahezu immer unter sich.
So konnte der beschließende Hauptausschuss eigenständig über Personalentscheidungen (Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Kündigungen) entscheiden; Vergabe von Aufträgen innerhalb der Wertgrenzen von 10.000 € bis 30.000 € erteilen und die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushaltssatzung innerhalb der Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 € aufnehmen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Es ist erfreulich, dass nun das oberste Willensbildungsorgan, also der Amtsausschuss, über alle diese Entscheidungen wieder selbst bestimmen kann. Dann werden bestimmt auch mehr Bürger den Amtsausschuss besuchen und die Presse auch über endlich wieder lebendige Diskussionen berichten können. „Die Demokratie lebt auf Dauer nur, wenn wir alle miteinander im Gespräch bleiben. Niemand komme ohne Kompromisse aus.“ Stephan Harbarth- Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
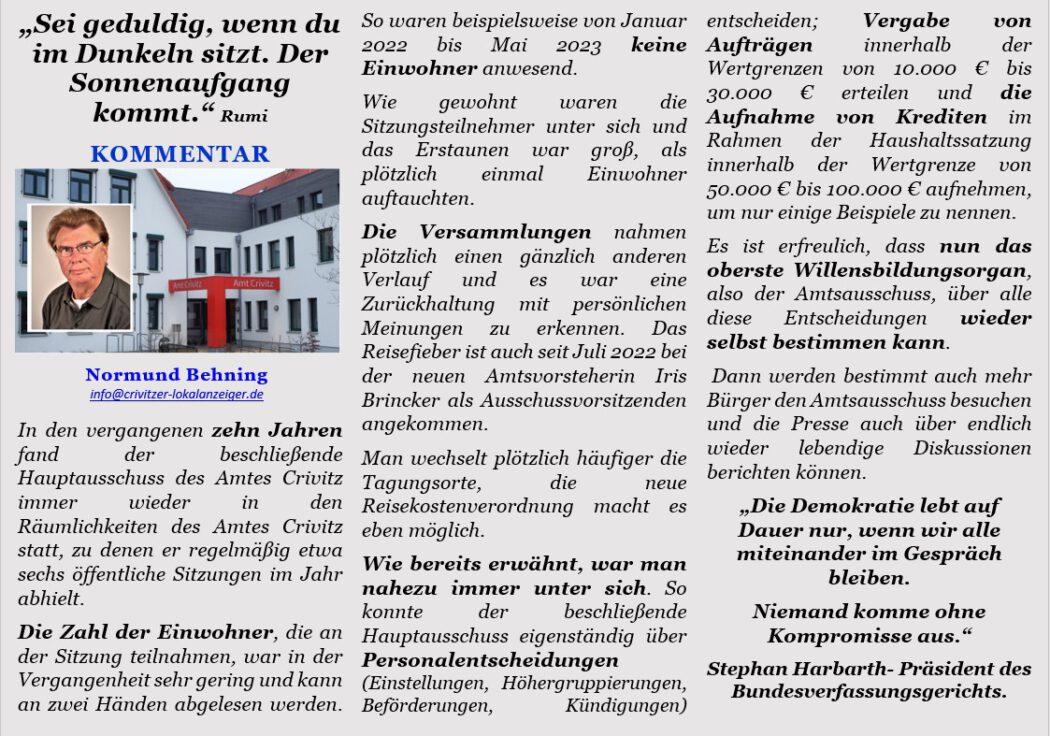
07.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./372[163(38-22)]/CLA-209/47-2024

Es ist die überwiegende Praxis der derzeitigen Bürgermeister, dass heikle und unangenehme Themen in der Kommunalpolitik, die für Diskussionen oder Fragen bei Besuchern auf Sitzungen sorgen könnten, einfach auf die aktuelle Tagesordnung gesetzt werden. Da die meisten Hauptsatzungen der Gemeinden des Amtes Crivitz vorsehen, dass Bürger und Besucher auf öffentlichen Sitzungen keine Fragen zu den aktuellen Themen stellen dürfen, sind sie gezwungen, schweigen zu müssen. Nach der Kommunalverfassung muss dann tatsächlich der Bürger schweigen. Die Situation ist für die Gewählten sehr angenehm, da der Wind nicht so stürmisch von vorn wehen kann und die Problematik mit heiklen Themen dadurch einfacher geklärt werden kann.
In Crivitz besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Einwohnerfragestunde Fragen zu stellen, Anregungen zu geben und Kritik an aktuellen Tagesordnungspunkten abzugeben. Manchmal stellt dies eine beträchtliche Herausforderung für die gewählten oder nachgerückten Mitglieder der Stadtvertretung dar.
Angesichts dessen haben die Mehrheitsfraktionen von CWG und die Fraktion DIE LINKE/HEINE seit etwa 4,5 Jahren eine andere Vorgehensweise entwickelt, um solche Debatten zu vermeiden. Zu Beginn der Wahlperiode war es üblich, den klassischen fragenden und kritischen Aktivbürger ständig zu unterbrechen, um ihn zu verwirren und unglaubwürdig zu machen. In den folgenden Jahren wiederholten sich die Unterbrechungen, jedoch stets mit dem Hinweis, dass lediglich Fragen gestellt werden sollten. Dies ist natürlich nicht korrekt.
Die Kommunalverfassung ermöglicht es dem Bürger, Fragen zu stellen, Hinweise zu geben und Kritik zu äußern, was bereits einige rote Köpfe bei Abgeordneten verursacht hat. Daher wird seit etwa 22 Monaten in Crivitz eine andere Methode angewendet. Man deklarierte ganz einfach bestimmte Tagesordnungspunkte als nicht öffentlich. In einigen Crivitzer Sitzungen ist es mittlerweile so professionell, dass man in einigen Tagesordnungspunkten plötzlich und unerwartet schützenswerte Informationen (also Datenschutz) entdeckt und diese sofort in den nicht öffentlichen Teil der Sitzungen integriert.
So kam es in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung vor, dass lediglich drei öffentliche Tagesordnungspunkte in etwa 25 Minuten abgehandelt wurden. Doch im nicht öffentlichen Teil der Sitzung versammelten sich plötzlich bis zu 16 Tagesordnungspunkte. Der Bauausschuss (Vorsitzender Alexander Gamm-Fraktion die LINKE/HEINE) hat hierzu schon eine sehr perfekte Strategie entwickelt, aber auch die Stadtvertreterversammlung (Versammlungsleitung Frau Britta Brusch-Gamm, Fraktion CWG- Crivitz) ist im Deklarieren nicht nachlässig. Der Antrag der CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) auf Auskunftserteilung gemäß § 34 Absatz 2 KV M-V an die Bürgermeisterin, der Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen sowie der Beschluss zum Abschluss eines Pachtvertrages mit dem Hundesportverein Crivitz Eichholz e.V. wurden als nicht öffentlich deklariert.
Insgesamt führt das schließlich dazu, dass die Bürgermeisterin erneut eine Lektion aus der Kommunalverfassung zum Thema NICHT Öffentlichkeit verfasst, primär für das sogenannte Stadtblatt, in der sie zwar einige Aspekte öffentlich diskutiert, jedoch darüber hinaus gänzlich unausgewogen reflektiert. Dort heißt es zum Beispiel: „Es gibt für den Ausschluss der Öffentlichkeit definierte Gründe durch die Kommunalverfassung: “..… „Wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.“ Das heißt z.B. bei der Preisgestaltung oder internen Daten der Firmen bei Auftragsvergaben, ein Teil der Bauunterlagen bei einem Bauantrag/gemeindlichen Einvernehmen (konkrete Bauzeichnungen, Namen usw.), Personalangelegenheiten, Grundstücksangelegenheiten, Anträge auf Stundung und Erlass usw. (Auszug – Stadtblatt)
Bedauerlicherweise ist das alles nicht so, wie es dargestellt wurde. Die Hauptsatzung von Crivitz legt fest, dass lediglich in bei Personalangelegenheiten Einzelner, Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner, Grundstücksgeschäfte, Vergabe von Aufträgen, die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Folglich ist die öffentliche Diskussion bezüglich Bauanträgen, Bauzeichnungen, gemeindlichen Einvernehmen und Grundstücksangelegenheiten öffentlich, was auch in diversen Kommentaren und der Rechtsprechung zur Kommunalverfassung MV bestätigt wurde. Zudem waren dies auch in den letzten Jahren der Veröffentlichungen des Amtes Crivitz gleichsam gängige Praxis.
Der Bauausschussvorsitzende Herr Alexander Gamm, Fraktion die LINKE/HEINE der für die Tagesordnung zuständig ist, sieht sogar für die kommende Sitzung nur die Einwohnerfragestunde öffentlich vor und alle weiteren Themen zur baulichen Infrastruktur wie Bauanträge werden von vorneherein als nicht öffentlich erklärt. Z. B. den Funkmast am Waldschlösschen oder die Umwandlung von Bestandsräumen in eine Arztpraxis legt er lieber gleich in den nicht öffentlichen Teil! Es könnte ja zu unangebrachten Fragen von Bürgern kommen.
Ist es wirklich sinnvoll, diese Entwicklung noch fünf Jahre weiterzuführen?
Kommentar/Resümee
„Die Dinge müssen geheim und im Dunkeln getan werden“. Jean-Claude Juncker!

Ist es tatsächlich so, dass alles im Dunklen bleiben muss?
Sind einige Menschen besorgt über die Kommunikation oder das Gespräch mit den Bürgern und anderen Meinungen? Es könnte durchaus sein, dass ein kritischer Bürger mit seiner abweichenden Meinung recht hat. Und falls es so ist, was ist dann der Fall? Die Darstellung einer Nichtöffentlichkeit zu einem Thema wird oft sehr persönlich und einseitig vom Versammlungsleiter präsentiert und ausgelegt. Die CDU-Opposition Crivitz und Umland folgt in der Regel den Vorschlägen der Versammlungsleitung zur Nichtöffentlichkeit. Sie scheinen äußerst zurückhaltend zu sein, um den Burgfrieden zwischen der CWG und der LINKE/Heine nicht zu gefährden.
Es ist weiterhin möglich, sich hinter der Kommunalverfassung zu verstecken.
Es wäre erfreulich, wenn die Bürger im kommenden Kommunalwahlkampf 2024 genauer hinsehen könnten, um die politischen Strömungen in Crivitz zu analysieren und sich für eine Vielzahl von Parteien zu entscheiden, um die Demokratie neu zu gestalten!
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, sagte in seiner Festrede in der Elbphilharmonie am 3.10.2023:
„Die Demokratie lebt auf Dauer nur, wenn wir alle miteinander im Gespräch bleiben.“
Harbarth mahnte darüber hinaus, „diskursfähig und diskursbereit zu bleiben. Niemand komme ohne Kompromisse aus. In Deutschland sei vieles gut, einiges exzellent, aber manches kann und muss verbessert werden, um auch in Zukunft zu bestehen“.
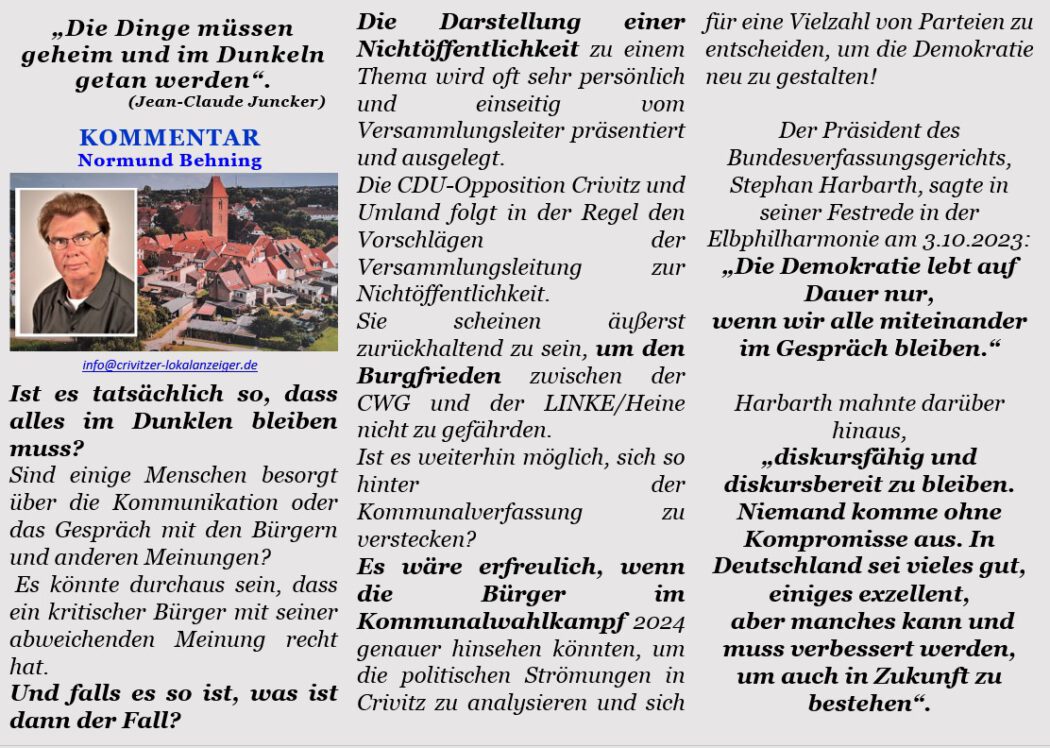
05.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./371[163(38-22)]/CLA-208/46-2024

Es könnte alles so einfach sein! Wieder einmal geht es um personenbezogene Befindlichkeiten und um direkte Kontakte zur Führungsebene der Stadtspitze sowie um eine Machtdemonstration einer Wählergruppierung.
Zwei Hundesportvereine haben lediglich einen Trainingsplatz, jedoch besitzt nur einer einen Vertrag. Die Mehrheit der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine lehnen öffentliche Debatten ab und beabsichtigen, den Vertrag geheim zu vergeben. Seit einigen Monaten wird über einen eigenmächtig unterzeichneten Vertrag von der Stadtspitze ohne die Zustimmung der Stadtvertretung diskutiert. Immer mehr Details über den Inhalt gelangten in die Öffentlichkeit. Seit sechs Monaten bemühen sich die Mehrheit der CWG-Crivitz und die Linke/Heine, öffentliche Diskussionen zu unterbinden, taktieren und spielen auf Zeit bis zur Wahl, um den Hundesportverein Lewitzrand e. V. zu verhindern.
So auch bei der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter in dieser Woche.
Es ist ungewöhnlich, dass die CDU-Fraktion Crivitz und Umland einen Antrag gestellt hat, einen Beschluss öffentlich zu diskutieren. Dies ist auf den Wahlkampf zurückzuführen. Es ging darum, den Pachtvertrag mit dem Hundesportverein Crivitz Eichholz e. V. öffentlich zu besprechen. Ihr Antrag scheiterte wie immer an den fehlenden Argumenten und Kenntnissen in den kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie an der fehlenden Führung in der Fraktion, die nicht einmal mit dem notwendigen Durchhaltevermögen ausgestattet war.
Allein die Behauptung des Fraktionsvorsitzenden der Linken/Heine, Herrn Alexander Gamm, der wiederholte, dass eine öffentliche Diskussion die Kommunalverfassung nicht zulässt und deshalb man dieses Thema im nicht öffentlichen Teil behandeln muss. Die CDU-Fraktion Crivitz und Umland konnte keine Gegenargumente und fundierten Wissensgrundlagen entgegensetzen. Sie konnte nicht einmal aus der Kommunalverfassung selbst zitieren oder dies von der Stadtspitze einfordern. Wie immer war sie ein zahnloser Tiger in der Argumentation. Die Darstellung der Stadtspitze, dass man sich in einem vorgerichtlichen Verfahren befinde und daher keine öffentliche Diskussion führen wolle, war wie üblich an den Haaren herbeigezogen und diente lediglich als Metapher für einen dunklen Schleier. Die CDU-Opposition vermochte diesen Argumenten nicht entgegenzutreten, da man sich wie üblich unzureichend auf seinen eigenen Auftritt vorbereitet hatte.
Diese Behauptung von dem Fraktionsvorsitzenden die LINKE/Heine Herrn Alexander Gamm war natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Man hat plötzlich in der Vorbereitung der Sitzung diesen Tagesordnungspunkt anders bezeichnet, um eine öffentliche Diskussion zu verhindern. Es besteht jedoch weiterhin ein beträchtliches öffentliches Interesse, das man einfach ignorieren möchte.
Fakt ist jedoch, dass bereits ein Vertrag existiert und dieser eigenmächtig ohne Legitimation der Stadtvertretung von der Stadtspitze vergeben wurde.
Auch die Mitglieder des Crivitzer Hundesportvereins Lewitzrand e. V. waren zahlreich zur Sitzung der Stadtvertretung erschienen und wollten ihrem Ärger über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wurde, Luft machen. Allerdings wurden ihre Argumente nicht gehört und schließlich verworfen.
Es wurde bereits im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine der Stadt Crivitz am 11. Juli 2023 über das Thema Pachtvertrag für die Hundesportvereine diskutiert. Dabei wurde von Frau Diana Rommel, Vorsitzende des Hundesportvereins „Crivitz – Eichholz“ e. V., darauf hingewiesen, dass für den Verein wichtig ist, „dass der Pachtvertrag weiterhin so Bestand haben sollte“. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar erkennbar, dass hier seit Längerem ein Pflock in den Boden gestemmt werden sollte und eine klare Haltung zum Hundesportverein „Crivitz – Eichholz“ e. V. herrschte. Das Fatale an der Sache ist, dass Frau Diana Rommel als sachkundige Einwohnerin in dem gleichen Ausschuss vertreten war (CWG – Fraktion) und natürlich einen direkten Einfluss innerhalb der Stadtvertretung besaß zu dieser Entscheidung.
Trotz der dargestellten Geschehnisse und der Verweigerung von Informationen und Befangenheiten einzelner Mitglieder in den Ausschüssen entstehen Fragen. Man muss sich fragen:
Warum dürfen nicht zwei Vereine auf einem Hunde-Trainings-Platz trainieren?
Kommentar/Resümee
„Im Dunkeln ist gut munkeln. Im Hellen dafür umso besser bellen“ Willy Meurer.
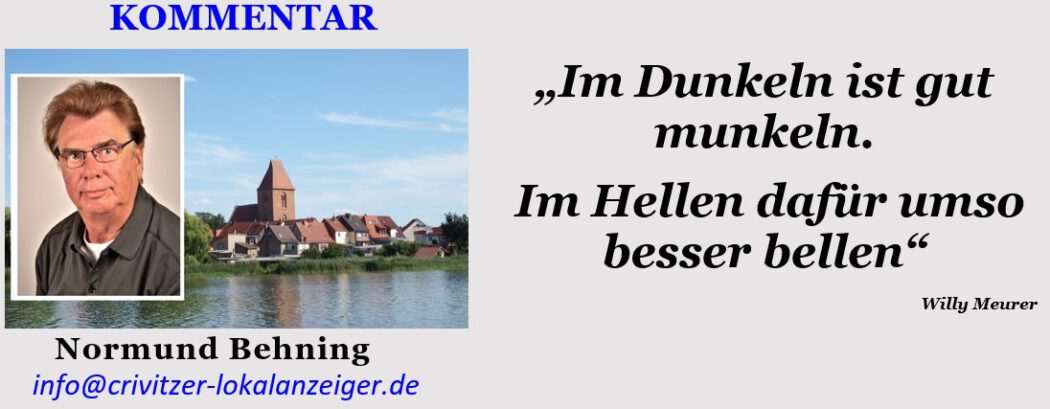
Ist es tatsächlich so, dass alles im Dunklen bleiben muss? Haben einige Wählergruppen vor der Kommunalwahl Angst vor einer Kommunikation oder einem Gespräch mit den Bürgern und anderen Meinungen? Oder wollen sie ihre noch bestehende Machtposition nutzen, um Entscheidungen unumkehrbar zu machen?
Es könnte doch auch sein, dass einmal der kritische Aktiv- bzw. Vereinsbürger mit seiner anderen Meinung recht hat. Und wenn ja, was ist denn dann? Die Darstellung einer Nichtöffentlichkeit zu den Tagesordnungspunkten wird häufig sehr persönlich und einseitig von der Versammlungsleiterin in der Stadtvertretung (Bürgermeisterin Frau Brusch-Gamm) dargestellt und ausgelegt, laut KV M-V.
Die CDU-Fraktion vom Gemeindeverband Crivitz und Umland ist bei diesen kommunalrechtlichen Angelegenheiten stets auf Hilfe von außen angewiesen, die sie anscheinend nicht mehr hat, um angemessen etwas entgegensetzen zu können.
Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, hat Frau Diana Rommel ihren Vorstandposten im Hundesportverein „Crivitz – Eichholz“ e. V. geräumt, um aus der Schusslinie zu geraten. Nun soll ihr Ehemann Ingo Brodde die Geschäfte weiterführen. Auf der öffentlichen Website des Hundesportvereins „Crivitz – Eichholz“ e. V. sind keine Statements zu diesem Thema zu finden, geschweige denn, dass ein Vorstand oder deren Mitgliedern veröffentlicht wurde. Es ist nicht möglich, einen Ansprechpartner im Falle von Kontakten zu finden. Das Impressum enthält lediglich eine Adresse in der Goldberger Straße mit einer Handynummer (0174 1785087). Hat man hier etwas verschwiegen? Alles bleibt wie immer in der Familie sowie auch ähnlich in den wahlpolitischen Wählergemeinschaften.
In einer Demokratie ist es wichtig, die vorhandenen Interessen stets zu berücksichtigen, Kompromisse zu suchen und sie auch zu finden, um möglichst vielen Beteiligten gerecht zu werden. Die Ausübung von Machtbefugnissen in Wahlämtern ist von einer bestimmten Endlichkeit gekennzeichnet, sodass die Bürger sicherlich bei den kommenden Wahlen im Juni 2024 ein frischeres Auge haben werden!
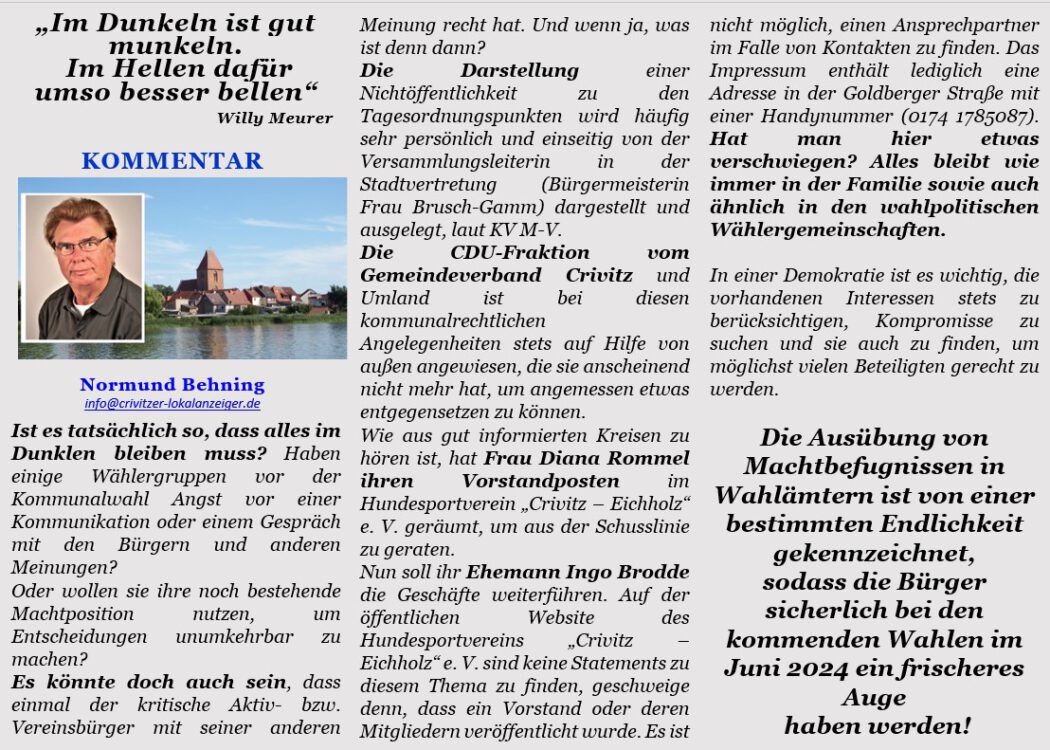
03.Mai -2024/P-headli.-cont.-red./370[163(38-22)]/CLA-207/45-2024

„Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er Distanz zum Gegenstand seiner Betrachtung hält; dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache; dass er immer dabei ist, aber nie dazugehört.“ Hanns Joachim Friedrichs.
Unabhängige und frei zugängliche Medien (Zeitung, Fernsehen, Radio und Internet) gehören dazu. Sie sollen die Öffentlichkeit umfassend und korrekt über aktuelle Geschehnisse informieren, Missstände aufzeigen und durch Kritik und vielfältige Diskussionen zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen. Um diese Aufgaben und Ziele zu bewältigen, muss die Medienlandschaft eines Landes frei, vielfältig und unabhängig von wirtschaftlicher oder politischer Einflussnahme sein. So sollte sein!
Journalist oder Journalistin darf sich in Deutschland jeder und jede nennen. Ohne bestimmte Voraussetzungen oder einen bestimmten Ausbildungsweg, da die Berufsbezeichnung vom Gesetzgeber nicht geschützt wurde. Auch Pressefotografen und Bildredakteure werden zu den Journalisten gezählt. Ein guter Journalist ist bestrebt, sich der objektiven Wahrheit zu nähern und ist sich bewusst, dass er auf dieser Basis kein abschließendes Urteil fällen kann. So sollten seine Aussagen für andere logisch nachvollziehbar und überprüfbar sein.
Die Grundlage des Journalismus ist die sorgfältige und gründliche Berichterstattung. Die Fähigkeiten zur Recherche, Genauigkeit und Faktenprüfung spielen für Journalisten eine entscheidende Rolle, insbesondere die Grundsätze der Wahrhaftigkeit, Genauigkeit und faktenbasierten Kommunikation, wie Unabhängigkeit, Objektivität, Fairness, Respekt gegenüber anderen und die öffentliche Rechenschaftspflicht.
Das ist das Einfache, was schwer zu machen ist!
Die Rangliste der Pressefreiheit ist eine Bewertung der Pressefreiheit, die jährlich von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen erstellt, um die Pressefreiheit in fast allen Staaten der Welt zu bewerten. Im Index 2022 wurde ein neues Bewertungssystem eingeführt, 100 Punkte sind nun gut und 0 Punkten schlecht.
Norwegen belegte im Jahr 2023 den Platz (1) 95,18 Punkte, gefolgt von Irland 89,91 Pkt. und Platz (3) Dänemark 89,48 Pkt. Deutschland belegte den 21. Platz mit 81,01 Punkten. Die letzten drei Plätze sind Vietnam 178, China 179 und Nordkorea auf Platz 180. Es ist schon erstaunlich, dass Schweden, Niederlande, Litauen und Estland sowie Portugal, Liechtenstein, Schweiz, Lettland, Tschechien, Slowakei, Island und Luxemburg im Ranking um die Pressefreiheit besser abschneiden als Deutschland.
Kommentar/Resümee

Die Aufklärung ist das Kerngeschäft eines verantwortungsbewussten Journalisten. Es handelt sich nicht um einen Wellness-Journalismus, der primär darauf abzielt, „schöne“ Geschichten und Wohlfühlgeschichten zu inszenieren und zu schreiben. Es sind oft die unschönen Geschichten, die uns das meiste über unsere Gesellschaft erzählen.
Wir dürfen niemals vergessen, dass der amerikanische Höchstrichter Hugo Black 1971 beim Prozess gegen die New York Times sehr treffend formuliert hat. Die Zeitung berichtet aus geheimen Pentagon-Papieren über den Vietnamkrieg und wurde von der Nixon-Regierung verklagt. Höchstrichter Black vertrat damals die Ansicht, dass die Pressefreiheit und ihre „essenzielle Rolle für die Demokratie“ ein wichtiger Faktor für die Demokratie sei.
Damals: „The press was to serve the governed, not the governors. “
Die Presse hat den Regierten und nicht den Regierenden zu dienen.
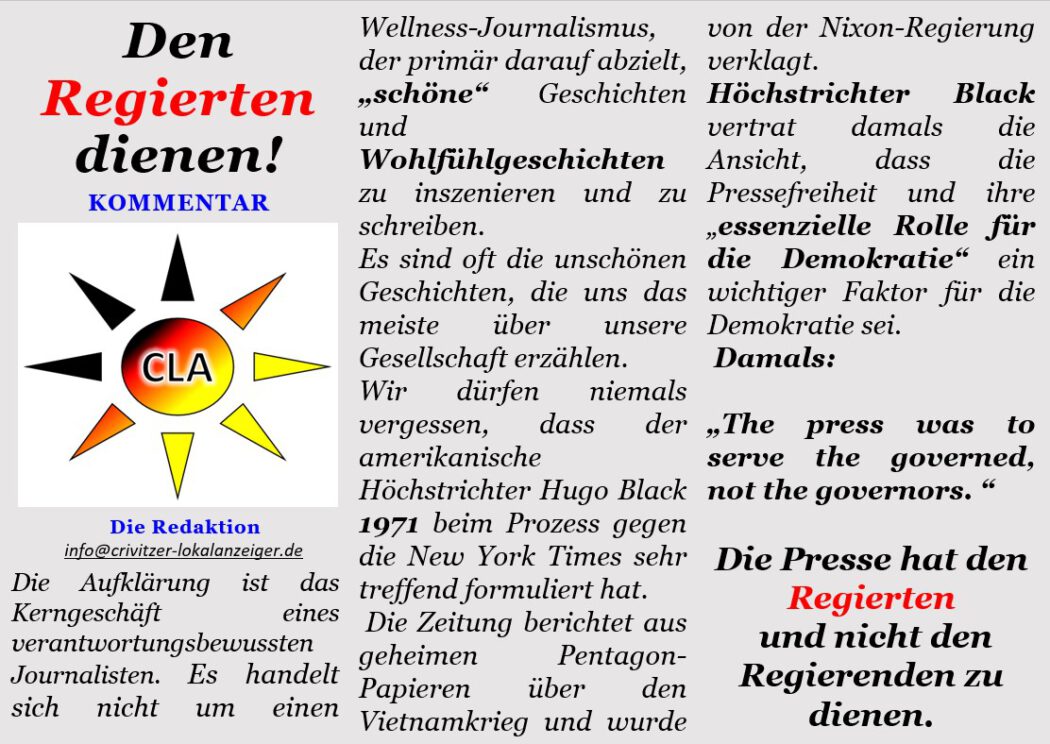
25.April -2024/P-headli.-cont.-red./369[163(38-22)]/CLA-206/44-2024
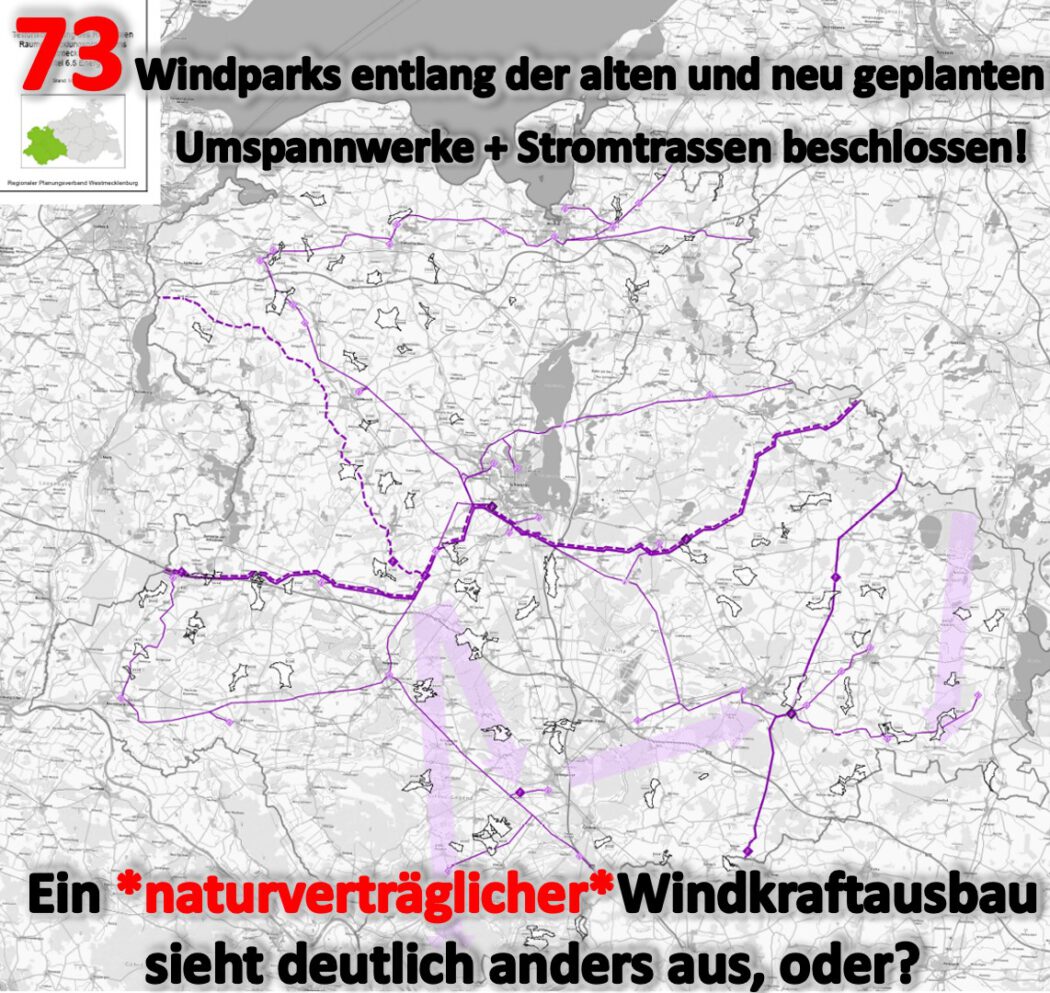
So oder so ähnlich könnte man das Verhalten der Verbandsvertreter der Parteien DIE LINKE / SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg bis zur Abstimmung über den Ausbau von Onshore-Windparks am 24.04.2024 in Ludwigslust beschreiben. Gleichzeitig wurde das öffentliche Forum genutzt von den Parteien, um sich im Kommunalwahlkampf in Szene zu setzen, um zusätzliche Änderungsanträge zu stellen. Obwohl allen Beteiligten klar war, dass vor der Wahl im Juni 2024 noch eine Mehrheit im Planungsverband von SPD+LINKE und Bündnis 90/Die Grünen besteht.
Die Probleme des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg bei der Windenergie sind hausgemacht. Das Ganze zieht sich bereits seit 2014 hin und mittlerweile befindet sich der Verband in einem Scherbenhaufen seiner eigenen Handlungen! Der ehemalige Vorsitzende des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Rolf Christiansen und sein Stellvertreter Thomas Beyer (beide SPD-Fraktion) haben vor etwa 7 Jahren einen Beschluss im Verband mit herbeigeführt, ein ganz bestimmtes Windeignungsgebiet zu streichen. Gegen diese Herangehensweise wurde erfolgreich geklagt, wegen eklatanter verwaltungsrechtlicher Fehler. Seitdem wird an diesem Plan (in bisher drei Entwürfen) herumgebastelt, mit fatalen rechtlichen Folgen. Der bisherige dritte Planentwurf hat bislang keine Rechtskraft oder eine vergleichbare Zielsetzung. Eine neue, überarbeitete Windparkplanung (aktuell 4. Planentwurf), der sowohl neue Flächen als auch stark aufgeweichte Artenschutzkriterien nach der neuesten Gesetzgebung berücksichtigt und ein neues Kriterium, die „Netzintegrationsfähigkeit“ berücksichtigt, soll nun bis 2032 die Rettung vor der Wahl im Juni 2024 sein.
Der Planentwurf wurde mit seinen 73 Windeignungsgebieten vorgestellt, wobei 53 Gebiete aus dem vorherigen Entwurf von 2021 enthalten sind und ca. 20 neue Gebiete, die auch schon einmal im ersten Entwurf 2016 enthalten waren, aber durch das neue Windflächenbedarfsgesetz 2022 eben jetzt wieder neu einzuplanen sind. Daher liegt man im Planungsverband seit 12 Monaten im Streit, da das neue Wind-an-Land-Gesetz von 2022 nur eine Flächenausweisung von 1,4 % der Planungsfläche bis 2027 vorsieht und bis 2032 eben weitere 0,7 %. Im November 2023 beschloss aber der Planungsverband, alles auf einmal und gemeinsam zu planen.
Die Mehrheit der SPD, die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben sich hier durchgesetzt, also insgesamt 2,1 % der Regionalfläche (soeben 73 Windgebiete) sofort zu planen. Das bedeutet, wo bereits Netzverknüpfungspunkte und Stromleitungen existieren (früher Umspannwerke) oder neue geplant sind, sollen verstärkt Solar- und Windeignungsgebiete ausgewiesen und geplant werden.
Herr Justus Garbe stellte in dem Umweltbericht die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen und die Prüfung der Umweltverträglichkeit der 73 neuen Windgebiete vor. Der Fokus der Untersuchung lag auf dem KLIMASCHUTZ in nationaler und internationaler Zielsetzung. In der Abwägung der auszuweisenden 73 Gebiete dominierte das überragende öffentliche Interesse. Er geriet jedoch lediglich bei der Darstellung der Datenbasis für die Umweltprüfung in Schwierigkeiten, da hier nur ein Teil der Daten erfasst wurden. Das soll bedeuten, dass für das Schutzgut Pflanzen und Tiere (Artenschutz) nur Daten über den Bestand des Seeadlers, Fischadlers, Wanderfalke und Weißstorch erfasst wurden. Teilweise wurden die Bestände von Rotmilan, Fischadler und Wiesenweihe im Januar 2024 nachgeliefert, aber über den Bestand vom Schwarzmilan, Wiesenweihe, Mäusebussard und Wespenbussard sind keine Daten im Bericht enthalten. Dies löste bei den Zuhörern ein mächtiges Raunen aus und auch die anwesenden Planungsbüros schüttelten nur mit dem Kopf.
Drei Änderungsanträge wurden insgesamt zum vorliegenden Beschlussentwurf gestellt, einmal von der SPD-Fraktion, dann vom Landkreis LUP und der CDU-Fraktion. Die SPD-Fraktion zog ihren Antrag zurück, weil er dem Landkreisantrag von LUP entsprach und nur noch der CDU-Antrag übrigblieb.
Der Landkreisantrag LUP sah vor, eine Gebietskulisse von 2,1 % der Regionalfläche für Windparks sofort auszuweisen, jedoch zunächst mit 1,4 % und weiteren 0,7 % bis zum Jahr 2032 freizugeben. Im Verfahren selbst wurde dann um eine rechtliche Würdigung der Fachaufsicht gebeten. Alles war sehr schwammig formuliert und bedeutet, dass man alles so tut, wie vorgesehen. Man überprüft lediglich, ob alles korrekt ausgeführt wird.
Der CDU-Antrag war schon deutlicher und verlangte keine sofortige öffentliche Auslegung der jetzigen Planungen, sondern einen überarbeiteten Entwurf zum Ende des Jahres fertigzustellen, wo nur 1,4 % bis 2027 der regionalen Fläche überplant werden sollen. Im Anschluss sollte dann erst einmal der Bedarf an weiteren Windparkplanungen ermittelt werden, bevor die restlichen 0,7 % der Regionalfläche überplant. Die Darstellung wurde als realistisch angesehen, da alles andere lediglich ein übereilter Gehorsam wäre, der lediglich den Investoren und Landeigentümern zugutekäme und Belastungen für Natur und Bürger bedeutet würde. Aufgrund fehlender Stromnetze ist es ohnehin unmöglich, den dann überschüssigen produzierten Strom weiterzuleiten.
Diese Herangehensweise erschien logisch, löste aber bei den Parteien der SPD, der Linken und Bündnis 90/Die Grünen einen regelrechten Angriff auf die CDU-Fraktion aus. Die SPD-Fraktion warf der CDU vor, *Populismus* zu betreiben, und der Vorstand warf der CDU vor, hier unwahre juristische Darstellungen zu präsentieren. Die Fraktion DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen haben sich noch deutlicher geäußert. Die Fraktion der Grünen kritisierte die CDU als *Realitätsverweigerer* und lobt die Bundes- und Landesregierung sowie den Vorstand des Planungsverbandes und wies auf die Auswirkungen von Hochwasser und Dürre hin.
Herr Andreas Sturm (Fraktion die Linke) erklärte, dass er die Anträge der CDU nicht mehr hören kann und man ohnehin nichts gegen Windräder unternehmen könne, da diese sowieso genehmigt werden. Überraschend war, dass auch im Vorstand des Planungsverbandes sich Iris Brincker (Fraktion DIE LINKE) lautstark durch mehrere Zwischenrufe auffiel und sich mehrfach aufplusterte gegen diesen CDU-Antrag. Sie sitzt im Planungsverband für den Landkreis Nordwestmecklenburg, ist aber auch Amtsvorsteherin im Amt Crivitz im Landkreis LUP. Das ist ungewöhnlich! Es gilt zwar die bewährte Regel, Amt und Mandat zu vermeiden, doch im Planungsverband ist das alles sehr verwirrend dargestellt. Es stellt sich jedoch die entscheidende Frage, welche Interessen sie nun konkret vertritt; sind es nun die Angelegenheiten des Landkreises LUP oder Nordwestmecklenburg?
So kam es, dass der CDU-Antrag abgelehnt wurde, sowohl von Iris Brincker (Amtsvorsteherin Amt Crivitz) als auch von der Mehrheit der SPD+ Linken+ Bündnis 90/Die Grünen mit insgesamt 25 *Nein*-Stimmen von ca. 40 Anwesenden. Die Mehrheitsfraktionen von SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen stimmten ebenfalls der öffentlichen Auslegung und sofortigen Planung der 73 Windeignungsflächen zu, mit 26 *JA*-Stimmen, darunter auch Iris Brincker.
Die öffentliche Auslegung des neuen Planes für die 73 Windparks erfolgt mitten im Hochsommer, für alle Bürger ein toller Zeitpunkt, da sowieso niemand dieses Jahr in den Urlaub fährt. Andernfalls könnten natürlich noch viel mehr Einwendungen und Beteiligungen eingereicht werden!
Kommentar/Resümee
Versuch und Irrtum Prinzip: Eine Methode zum Lernen? Bis jetzt ist es eine Blamage!
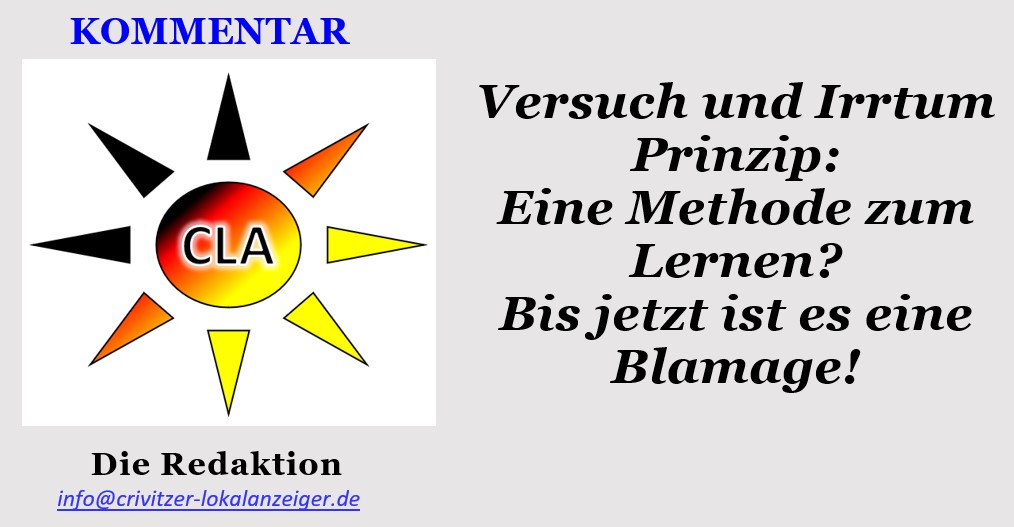
Die CDU-Fraktion entdeckte plötzlich gleich zu Beginn der Diskussion zum Planentwurf die Bürgernähe wieder und beantragte, dass auch Bürger in der Beratung sprechen sollten. Obwohl sie genau die Geschäftsordnung kennt, welche besagt, dass nach der Einwohnerfragestunde keine weiten Fragen der Bürger gemäß der Satzung zulässig sind. Auch der CDU-Chef von Ludwigslust, Herr Christian Geier, konnte wie gewohnt bei solch einem Schaufensterantrag nicht widerstehen. Schließlich wurde das Anliegen mit der Mehrheit von SPD+LINKE und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von AfD und CDU abgelehnt. So mussten die Bürger wie gewohnt zum Thema schweigen!
Der Planungsbeirat Energie, ein Gremium, das sich die Verbandsversammlung selbst geschaffen hatte, um aus ihrer Misere herauszukommen und endlich einen Entwurf vorzulegen, tagte seit September 2023 nur sechsmal zu je drei Stunden, um soeben nach sieben Monaten diesen Entwurf vorzustellen. Der Vorsitzende Herr Roland Brandt vom Oberzentrum Schwerin monierte aber gleichzeitig, dass die Teilnehmer (aus LUP, NWM, Wismar) dieser bisher nicht einmal die Reisekosten erstattet bekamen, weil sie als Ehrenamtliche nach Schwerin anreisen mussten. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit man hier erwartet, für eine gewählte ehrenamtliche Tätigkeit ausreichend Geld zu erhalten!
Selbstverständlich muss alles noch vor der Wahl am 24.04.2024 in der alten mehrheitlichen Akteursbesetzung stattfinden und gleichzeitig beschlossen werden. Damit es nach der Wahl keine weiteren Veränderungen oder Einflüsse mehr den Plan beeinflussen können. Es wurde wiederholt betont, dass es im Laufe des Verfahrens zu erheblichen Beeinträchtigungen durch den Artenschutz kommen kann und Gebiete dadurch verkleinert werden müssten oder Teile eben nicht nutzbar sind.
Der Vorstand des Verbandes hat dann natürlich sofort mehrfach darauf hingewiesen, dass man eben alles so bewertet und geplant habe, was man eben ‚üblicherweise tut‘ und was man eben „momentan an verfügbaren Daten vorliegen habe.“ Alle anderen Details sollen dann in einem anschließenden Genehmigungsverfahren beim staatlichen Amt für Umwelt und Natur geprüft werden. Dies sei dann nicht mehr Sache des Planungsverbandes. Das führte natürlich zu Unverständnis bei allen Bürgern und Gästen und deutet darauf hin, dass die heiklen Dinge einem anderen zugeordnet werden, der diese Probleme dann klären sollte.
Man könnte das auch so übersetzen, dass es im Prinzip so heißt: Wir haben keine Lust, eine genaue Untersuchung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durchzuführen sowie auch nicht die Mittel.
Daher planen wir einfach und fertig! So einfach ist es im Jahr 2024!

23.April -2024/P-headli.-cont.-red./368[163(38-22)]/CLA-205/43-2024
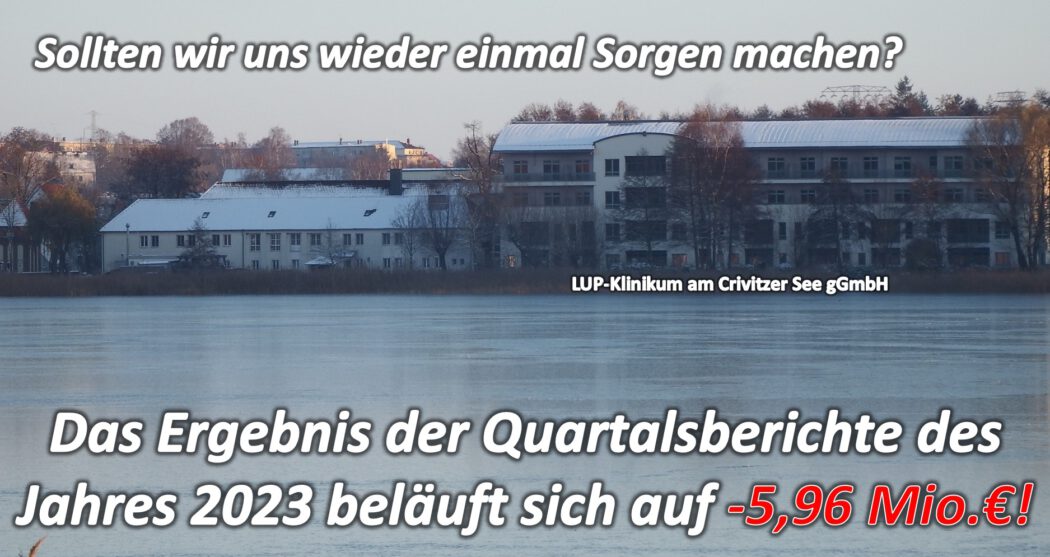
In der Gesamtbetrachtung im Bericht zur Entwicklung der Gesellschaft wurde hierzu festgestellt: „Insgesamt betrachtet ist und bleibt die finanzielle Lage und Liquidität extrem angespannt“.
In der Sitzung wurde der IV Quartalsbericht 2023 vorgestellt, der das Gesamtergebnis des Jahres 2023 darstellt. Die Gesamterträge im Erfolgsplan belaufen sich auf 14,77 Mio. € und die Ausgaben auf 20,71 Mio. €. Allein schon die Personalaufwendungen belaufen sich auf etwa 93 % (13,7 Mio. €) von den Erträgen und hinzukommen noch die Materialkosten mit 4,5 Mio. € sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 2,2 Mio. €. Natürlich wurden diese Verbindlichkeiten im Rahmen des Verbundes der LUP Kliniken durch zusätzliche Darlehen von ca. 5,2 Mio. € ausgeglichen, was die momentane Situation jedoch nicht besser macht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf etwa 540.000 €.
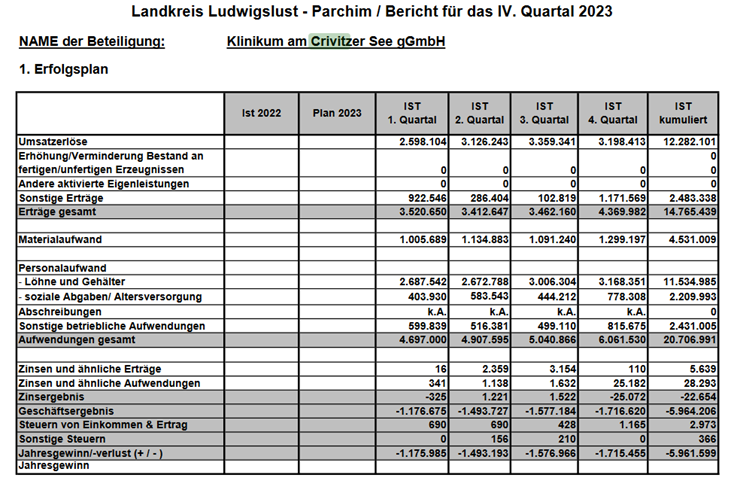
Insgesamt wurde folgende Einschätzung abgegeben: „Die Materialkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch die Auflösung des Lagers im November, durch erhöhte Energiekosten, Bereitschaftsdienste und Serviceleistungen im Vergleich zu den Vorquartalen gestiegen. Zu den Abschreibungen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Insgesamt betrachtet ist und bleibt die finanzielle Lage und Liquidität extrem angespannt. Das IV. Quartal ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.717.785 € abgeschlossen worden. Durch ein weiteres Darlehen von den LUP-Kliniken konnten die wichtigsten Verbindlichkeiten beglichen werden. Es sind aber weiterhin für das Jahr 2023 offene Rechnungen in Höhe 280 TEUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 240 TEUR (Stand 01.02.2024) zu verzeichnen.“
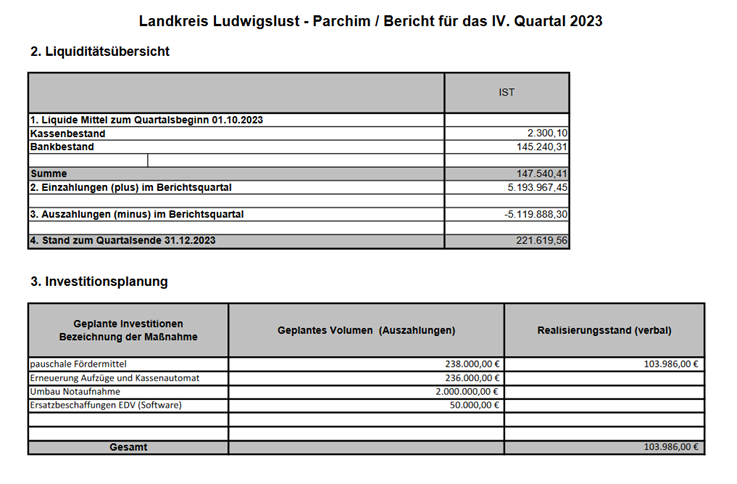
So bestehen noch Investitionspläne, die bereits in den vergangenen Jahren angekündigt wurden, zum Umbau der Notaufnahme von ca. 2,0 Mio. € sowie zur Erneuerung der Aufzüge und Kassenautomaten von etwa 236.000 € und zur Ersatzbeschaffung von Software für etwa 50.000 €. Ein Hoffnungsschimmer wurde bereits angedeutet:
„Seit dem 01.01.2024 hat die Geriatrie wieder eine neue Chefärztin, woraus sich für das Jahr 2024 wieder mehr Einnahmen generieren lassen.“
Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass gerade Gesundheit nun einmal mit Kosten verbunden ist, was sicherlich den Beteiligten bei der Rekommunalisierung des Krankenhauses in Crivitz und auch dem Landrat klar war. An dieser Stelle ist bemerkenswert, dass der Landrat Stefan Sternberg weiterhin vehement in allen seinen Sitzungen und Gesprächen sich für die Unterstützung der LUP-Kliniken eintritt und bis jetzt stets erfolgreich war. Es ist wichtig, dass man ihn in Zukunft (Mitglieder im neuen Kreistag) bei der Etablierung der Standorte im Landkreis unterstützt, damit er diese für den ländlichen Raum fest etablieren kann. Hier muss man eben einmal investieren und durch ein gemeinsames Zusammenwirken von mehreren Beteiligten innerhalb des Verbundes mit den LUP – Kliniken sogenannte Synergieeffekte schaffen, wo sich jeder in Zukunft spezialisiert und das beste Angebot darstellt.
Das Geld vom Steuerzahler, welches in unsre Kliniken fließt, um sie wettbewerbsfähig zu machen und mit Personal sowie mit Technik gut auszustatten, für die gesundheitliche Versorgung der Bürger im ländlichen Raum ist richtig ausgegeben und gut investiert in die Zukunft. Es ist jedoch ratsam, den Bogen der Forderungen nicht gleich zu Beginn zu überspannen, was insbesondere die „MAHNWACHE“ zur Gynäkologie/Geburtshilfe betrifft, wo bisher nicht einmal die Finanzierungsgrundlagen und die Kategorisierung des Krankenhauses Crivitz geschaffen wurden.
Das Ziel ist klar: Zunächst die Finanzierung neu aufstellen und die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck befreien. Zweitens soll eine Umstrukturierung die Qualität deutlich verbessern. Die Krankenhäuser sollen zukünftig nicht mehr alles können, sondern sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Das Wissen soll gebündelt werden, um eine bessere Finanzierung zu ermöglichen. Krankenhäuser sollen nicht mehr nur anhand von Fallzahlen finanziert werden. Der ökonomische Druck soll verringert werden. Die Vergütung der Krankenhäuser für die Daseinsvorsorge soll zu 60 Prozent durch Vorhaltepauschalen gewährleistet werden. Die übrigen Kosten könnten dann in Abhängigkeit von der Fallmenge finanziert werden, wie der Gesundheitsminister erläuterte.
Spezialisierung wird das Schlüsselwort der Zukunft sein!
Kommentar/Resümee

„Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich.“(Hermann Hesse)
Es ist höchste Zeit für die Umsetzung der Krankenhausreform, um die Existenz kleinerer Krankenhäuser zu sichern. Alle Beteiligten sind sich einig, dass endlich etwas getan werden muss und stimmen überein, dass es dringend einer Krankenhausreform bedarf. Was für ein seltener Glücksfall in der jetzigen Zeit für diese große REFORM! Diese Übereinstimmung sollte so auch wirklich umfassend und zeitnah genutzt werden. Die Krankenhausreform vom Gesundheitsminister hat Unterstützung verdient. Die heißen Eisen anzufassen, verlangt von Herrn Lauterbach schon eine Menge Respekt ab.
Kluge Reden und Demonstrationen zu Wünschen wie bei der „MAHNWACHE“ in Crivitz sind leicht zu halten, doch die Umsetzung der Gesetzesvorhaben in der Reform in die Realität erfordert Mehrheiten für finanzielle Unterstützung und strukturelle Veränderungen.
Am 26. April 2024 wird der Bundesrat über die Pflegepersonalbemessungsverordnung beraten, welche das Ziel hat, eine bedarfsgerechte Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte im Krankenhaus zu verbessern. Dies soll sicherstellen, dass auch in Zukunft genügend Fachkräfte im Bereich der Pflege zur Verfügung stehen. Ab dem 1. Juli 2024 sind Krankenhäuser verpflichtet, ihren Personalbedarf auf allen Normalstationen für Erwachsene und Kinder sowie auf Intensivstationen für Kinder zu ermitteln. In einem späteren Verordnungsverfahren werden Regelungen zum Personalaufbau getroffen, mit denen das Ziel der Erfüllung der Soll-Besetzung erreicht werden kann.
Am 24./25.04.2024 berät der Landtag MV über ein zukunftsweisendes Konzept zur Geburtshilfe. Das von der Gesundheitskommission MV entwickelte Zielbild für die Geburtshilfe und die Pädiatrie legt Handlungsempfehlungen für die strategische Weiterentwicklung der pädiatrischen und geburtshilflichen Versorgung bis 2030 vor.
Also, meine Damen und Herren von der „MAHNWACHE“ in Crivitz, unterstützen Sie doch bitte den Landrat und die Landesregierung!
Es geht doch tatsächlich voran!
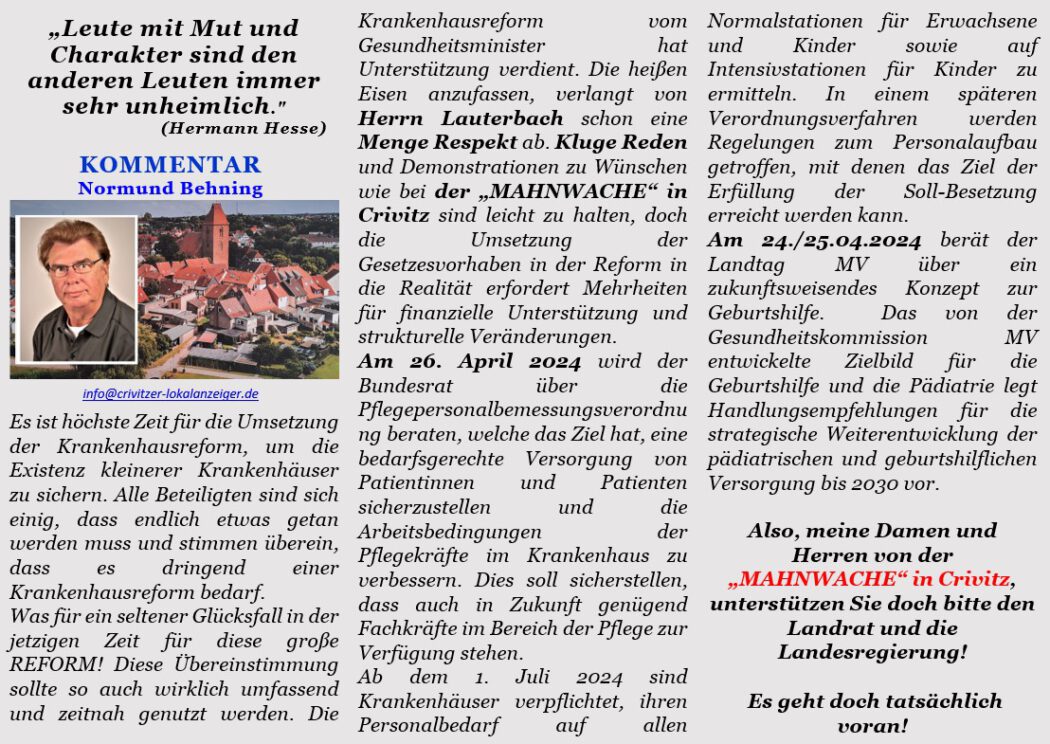
18.April -2024/P-headli.-cont.-red./367[163(38-22)]/CLA-204/42-2024

Diese Bewirtschaftung soll das Ziel verfolgen, die vielfältigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes zu bewahren. Eine nachhaltige Holzproduktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie naturnah und standortgerecht erfolgt. Es ist erforderlich, dass genügend Totholz (morsches Holz, das im Wald verbleibt) und Biotopbäume (alte und dicke Bäume mit besonderem Wert für Tiere und Pflanzen) auf der Fläche verbleiben und den Wert des Lebensraumes Wald steigern.
Jedes Jahr, wenn wir unsere ersten Schritte in den Wald machen, stellen wir erneut fest, dass gewaltige Kahlschläge stattgefunden haben. Das kann man leider nicht vermeiden. Dennoch sollten wir zwei Dinge im Auge behalten: Zunächst einmal ist es die Sorge um die bestehenden Greifvogelhorst-Bäume.


Besonders häufig stehen diese dann plötzlich teilweise oder ganz frei und es sind völlig veränderte Brutverhältnisse für die Großvögel, oder sie sind überhaupt nicht mehr da.
Zweitens, ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass länger als bis zum ersten März aktiv Holz geschlagen oder es zwar keine Fällungen mehr gab, aber zuvor liegendes Holz zersägt wurde und der Abtransport weit in den Monat März und April stattfand.
So auch im Eichholz. Es gab bereits 2016 einen großen Kahlhieb im LSG-Eichholz von einer Fläche von viel größer als 2 ha (gem. der Genehmigung § 13/3 Landeswaldgesetz).

Im Jahr 2019 erfolgte die nächste starke Einzelbaumentnahme im LSG-Eichholz.

Wieder wurde ein großer Horst zwar berücksichtigt, aber komplett freigestellt. Die Fällungen wurden bis zum 14.3.19 fortgeführt.

Der Holzabtransport fand bis spät im Frühling statt. Bei Holzarbeiten oder Abtransporten innerhalb der Brutzeit von Großvögeln ist das Verständnis bei den privaten und kommunalen Bewirtschaftern nicht immer gewährleistet. Anstatt Holzplantagen, naturnahe Wälder zu fördern, wäre ein konsequenter Umstieg weg von Nadelholz-Monokulturen und hin zu Mischwälder-Kulturen besser, nur so können wir die Klimafunktion unserer Wälder bewahren.


Für die 613 ha Stadtwald der Stadt Crivitz wurde am 21.03.2018 ein Bewirtschaftungsvertrag und eine Verlängerung ca. 2022 mit den Forstämtern für 10 Jahre neu vereinbart. Der Festmeter Holz kostet jetzt wieder 60,00 €.
In den vergangenen 10 Jahren erzielte die Waldbewirtschaftung des Stadtwaldes ein zusammengefasstes Ergebnis von ca. 572.000 € für den Haushalt der Stadt Crivitz. Das Ergebnis setzt sich zusammen (2014–2024) aus einem Ertrag von ca. 1.417.000 € mit einem dazugehörigen Aufwand von 845.000 €. Dies entspricht einem Gesamtaufwand von ca. 60 % für die Rohholzerzeugung, Wegebau und Beförsterungskosten. Dies ist schon ein sehr erheblicher Aufwand.
Die Wahl zwischen staatlicher und kommunaler Beförsterung ist überall möglich, wobei die staatliche Beförsterung immer gegen Entgelt, genauer gesagt entsprechenden Kostenbeitrag erfolgt. Die Beförsterung wird in der Regel den Forstämtern zugeordnet. Für die Stadt Crivitz ist es das Forstamt Gädebehn, wo sich einige Höhepunkte wie das ARBORETUM am FORSTHOF und der archäologische Lehrpfad Kritzkow befinden und vieles mehr.
Die entscheidende Frage ist also, wenn eine halbe Million Gewinn gemacht wird, wofür wurde denn das Geld verwendet?
Kommentar/Resümee

„Jeder EURO, der verdient wird, fließt wieder in den Wald“ Manfred Baum Chef Landesforstamt
Die Ruhephasen im Wald sind unbedingt strikt einzuhalten. Eine vernünftige Waldwirtschaft könnte durchaus mit Fachwissen und Freude am Wald vereinbar sein. Oft sind forstliche Maßnahmen sowie im Eichholz viel zu großflächig, sodass sich auch das Waldklima ändert. Als „stabil“ zeigen sich Wälder, in denen mehrere Baumarten gemischt nebeneinander vorkommen (Mischwald). Reinbestände, also Wälder, die lediglich aus einer Baumart bestehen, sind anfällig für Parasiten und Schädlinge.
In Mischbeständen wird das Risiko eines Parasitenbefalls oder des Ausfalls durch sich ändernde klimatische Bedingungen auf unterschiedliche Baumarten verteilt und ist dadurch geringer. Der Aufbau von Laubmischwäldern bei Nach- und Neupflanzungen ist unbedingt notwendig. Oft genug wird immer noch auch in Landschaftsschutzgebieten wiederholt konventionell gewirtschaftet, auch weil die Forstämter unter einem gewissen wirtschaftlichen Druck stehen. Es soll eigentlich nur so viel Holz entnommen werden, dass Bäume selbst nachwachsen können und wenig künstlich gepflanzt werden muss.
Eigentlich sollte es auch so sein, dass die Einnahmen aus dem Wald auch in den Wald wieder fließen. Oder? Nachforschungen in den Haushaltsplänen und Beschlüssen zeigen, dass es für das Arboretum der Stadt Crivitz, den Stadtpark, öffentliches Stadtgrün oder andere Umschichtungen verwendet wurde. Das aktuelle Waldkonto sollte somit einen Überschuss aufweisen. Der aktuelle Kontostand in der Summe bis 2024 sowie die restlichen Verwendungen sind nicht vollständig veröffentlicht worden.
Was sind die Gründe dafür?
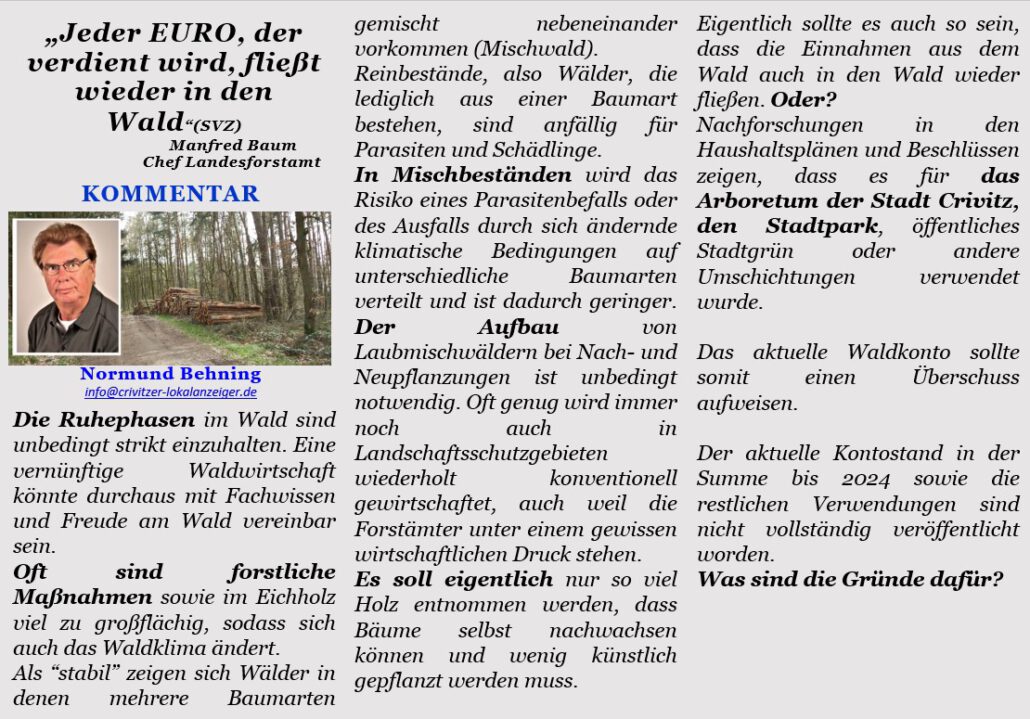
14.April -2024/P-headli.-cont.-red./366[163(38-22)]/CLA-203/41-2024
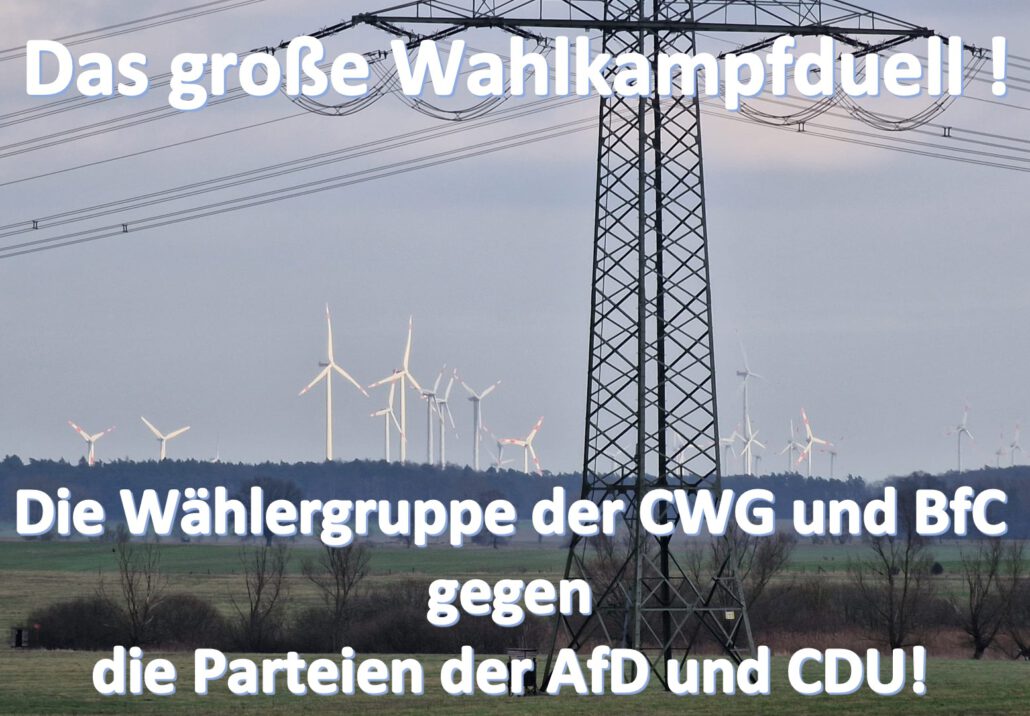
Es ist zutiefst bedauerlich, dass die Ortsverbände der SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und die LINKE der Stadt Crivitz seit 20 Jahren erstmals nicht in der Lage sind, ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 zu mobilisieren und aufzustellen.
An dieser Stelle ist es erforderlich, sich die Frage zu stellen, ob sie nicht bereit sind oder in der Lage sind, im Interesse ihrer Parteien eine Verantwortung in Crivitz zu übernehmen? In den letzten beiden Jahrzehnten gab es in Crivitz keine solchen Situationen vor der Kommunalwahl. An Kandidaten an sich mangelt es nicht, diese sind aber eher in den Wählergruppen und in anderen Parteien zu finden.
Das Bündnis für Crivitz [BfC] und die Crivitzer Wählergruppe [CWG] stellen sich nun gemeinsam gegen die Kandidaten der Parteien der AFD und CDU. Insgesamt nehmen an der Kommunalwahl in Crivitz 49 Kandidaten teil, wobei das Durchschnittsalter 57 Jahre beträgt.
Die größte Gruppe [Wählergruppe der CWG] tritt mit 19 Kandidaten an; das Durchschnittsalter beträgt 51 Jahre. Die zweitgrößte Gruppe [Wählergruppe des BfC] tritt mit 14 Kandidaten an; das Durchschnittsalter beträgt hier sogar 61 Jahre. In der drittgrößten Gruppe [Partei-CDU] treten 11 Kandidaten an, die ein Durchschnittsalter von 59 Jahren aufweisen, ebenso wie die viertgrößte Gruppe [Partei der AfD] mit fünf Kandidaten. Die jüngste Gruppe, die sich erst kürzlich vor drei Monaten gegründet hat [Wählergruppe des BfC], bildet zugleich die älteste Gruppe im Durchschnittsalter [61] ihrer Kandidaten.
Mit einem Durchschnittsalter von 49,9 Jahren bei Ihren Einwohnern liegt die Stadt Crivitz aktuell hinter Parchim und Ludwigslust [47,7]; Grabow (49,3); Brühl (48,9); Schwerin (46,2) oder Hagenow (44,7) zurück.
Es wird in Crivitz sicherlich keinen aufregenden Wahlkampfkrimi geben.
Vielmehr wird es ein wohl Triumphgesang der etablierten Wählergruppen für steuerfinanzierte Projekte in der Vergangenheit gegenüber den damaligen Parteien vor fünf, genauer gesagt 10 Jahren. Abgesehen davon, Bauprojekte zu planen und mit Vergabeverfahren die determinierte einheimische Unternehmerschaft wohlwollend zu fördern und gleichzeitig die Steuern zu erhöhen, um diese dann mit vollem Einsatz auszugeben, wurden wenig erfolgreiche Initiativen gestartet. Es gab auch keine ergebnisreichen Aktionen in der Vergangenheit der Mehrheitsfraktionen der CWG -Crivitz und der LINKEN / Heine, außer sich in den neuen Baueinweihungen sichtbar in den Medien plakativ widerzuspiegeln.
Steuergelder vollmundig ausgeben, um damit zu glänzen, ist nicht jedermanns Sache. Allerdings bleibt die Frage, was davon übrigbleibt. In unserem Fall sind es hohe Schulden und Ausgaben, jedoch keine Liquidität und Rücklagen mehr. Dennoch treibt der Wunsch die CWG+ die LINKE/Heine, in noch größeren Dimensionen zu planen und viel mehr auszugeben, den Wandel vom einstigen Windkraftgegner zum Windkraftunternehmer (Energiepark-Wessin mit 20 Anlagen) voran. Und so führte diese Herangehensweise ebenfalls im Jahr 2024 zu sofortigen Steuererhöhungen in den Grund- und Gewerbesteuern.
Es handelt sich um die vierte Steuererhöhung (2015,2018,2020,2024) seit neun Jahren und es werden weitere zügige Steuererhöhungen für alle Bürger in den kommenden Jahren geben, um die neuen großen Zukunftsvisionen aller Wahlkampfbeteiligten zu finanzieren!
Einzigartig ist besser als perfekt!
Obwohl die Gemeinsamkeiten der antretenden Wählergruppen (BfC + CWG) nicht so offensichtlich plakatiert werden, sind sie doch in den Aussagen der Wahlprogramme und in den Kandidatenbesetzungen innerhalb der Wählergruppen deutlich zu erkennen. Das Gemeinsame sieht man klar und sehr deutlich!
Die Wählergruppe des BfC setzt auf „Das Miteinander und Vorwärtskommen in unserer Stadt hängt nicht von irgendwelchen Parteien ab, sondern von tatkräftigen Personen, denen man vertrauen kann.“ in ihrem Wahlprogramm. Jedoch liest es sich wie eine Tagesordnung für den Umwelt- und Bauausschuss im alten Format. Man beabsichtigt im Wahlprogramm, sich zu bemühen, einzusetzen, auszuloten, fördern, werben, inspirieren und fünfmal zu unterstützen. Der Fokus liegt auf dem ARBORETUM, dem STADTPARK und Wald sowie auf dem Crivitzer See. Im Wahlprogramm fehlt es an Substanz und eindeutigen Versprechen, die man nicht geben möchte!
Auch bei der Wählergruppe der CWG zeigt ein deutliches „Miteinander und Füreinander“, obwohl ihr Medienauftritt seit 2021 nicht mehr aktualisiert wurde und ihre Internetpräsenz seit etwa 9 Monaten sich in einem Umbau befindet. In der Regel nutzt sie die Gunst der Stunde zu ihrem ersten Auftritt, wie bei den letzten zwei Wahlen, beim Tanz in den Mai (Markt in Flammen), um sich wohlwollend darzustellen, bevor sie sich mit Ihren Vorstellungen überhaupt ins Bild setzt.
Selbst die Kandidaten der CDU wollen das „Miteinander“ in ihrem Programm vorwegnehmen, aber hauptsächlich regulierend einwirken, um von vorneherein keine Veränderungsabsichten zu äußern, wie aus internen Kreisen zu hören ist.
Nur der Neuling die AfD, hat bereits Bürgerdialoge wie in Wessin durchgeführt und sich dort klar für mehr Transparenz bei Entscheidungen und weniger Erteilung von Ermächtigungen auf kommunaler Ebene ausgesprochen. Aus internen Kreisen wurde mitgeteilt, dass ein Programm bereits fertiggestellt ist und es wird in Kürze in die Briefkästen verteilt werden und es sollen weitere direkte Bürgerdialoge in Crivitz stattfinden.
Wir werden uns ansehen, welche Zukunftsvisionen realisierbar sind, um zu sehen, ob es überhaupt noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Um es mit den ständig wiederholten Worten der jetzigen Stadtspitze auf dem Neujahrsempfang 2024 zu sagen: „Wenn denn noch Geld vorhanden ist!“
Kommentar/Resümee
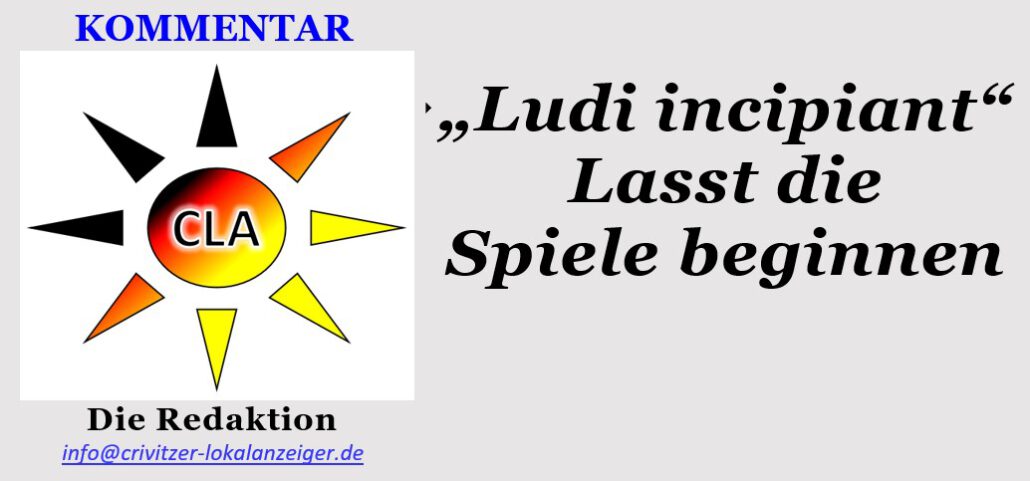
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist und bleibt wirklich bedauerlich, dass diese Parteien [SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und die LINKE] zum ersten Mal in Crivitz nicht kommunalpolitisch aktiv werden wollen. Denn Demokratie basiert auf ihrer Vielfalt von verschiedenen Ansichten und ihrer Auseinandersetzung miteinander.
Nach der Schließung des Wahlkreisbüros der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten in der Stadt Crivitz im Jahr 2022 wurde es in Brüel in die Nähe des Ortsteils „Golchen“ verlegt und man konnte bereits erahnen, was folgen wird. Offenbar gab es auch eine junge Bürgermeisterkandidatin aus den Reihen der SPD, wie aus internen Kreisen zu hören war. Natürlich brauchte sie auch die Unterstützung aus den eigenen Reihen, was vermutlich der Grund für den Rückzug der Kandidatur war. Sehr schade, liebe SPD!
Das Desaster bei der Partei Die Linke mit ihrer Spaltung zum Bündnis Sahra Wagenknecht [BSW] hat dazu beigetragen, dass sie selbst bei den Kandidaten für die Kreistagswahlen in LUP auf Regierungs- und Landtagsmitglieder nicht verzichten kann. Die Bereitschaft ist so gering, dass es bei der Auswahl schwierig ist.
Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat erst vor etwa acht Monaten einen neuen Ortsverband gegründet. Dieser sieht jedoch eher seine Schwerpunkte im Kreistag von LUP. Wahrscheinlich ist man dort in einer höheren Ebene mit angenehmeren Themen beschäftigt und möchte sich nicht in Crivitz vor Ort den Problemen stellen. Außerdem ist man im Flüchtlingsrat sehr verankert.
So treten eben im Kommunalwahlkampf in der Stadt Crivitz zwei große Wählergruppen, BfC + CWG, gegen nur zwei Parteien AfD und CDU an.
In Crivitz wird es kommunalpolitisch in den nächsten fünf Jahren sehr eintönig und frei von unterschiedlichen Programmen und Unterstützungen sein, da es nun einmal die Notwendigkeit einer vernetzten Parteienunterstützung bei kommunalen Problemen in Landtags- und Regierungskreisen stets erfordert. Die Wähler- bzw. Bündnisgemeinschaften, die keinen Parteienstatus haben, haben normalerweise keine Lobby. Sie sind auf die Unterstützung bei bestimmten eigenen Problemen auf die jeweiligen gewählten Parteien in Kreis-, Landtag oder Regierungskreisen angewiesen.
Es ist bedauerlich, dass dem Wähler in Crivitz nur eine geringe Auswahl an Akteuren aus den Parteien zur Verfügung steht!
Bleiben Sie trotzdem zuversichtlich!
Ihre Redaktion.

12.April -2024/P-headli.-cont.-red./365[163(38-22)]/CLA-202/40-2024

Nun ist es so weit! Die einen werden sagen: Na endlich, und die anderen: Oh, wie konnte das passieren?
Die Gerüchteküche hat sich in den vergangenen Monaten auf eine Anmietung in Crivitz und einen anschließenden Erwerb eines ganzen Hauses ausgedehnt. Nach dem Rückzug der Sozialdemokraten aus der Stadt Crivitz zum Ende des Jahres 2022 wurde das Wahlkreisbüro der SPD nach Brüel in die Nähe des Ortsteils „Golchen“ verlegt. Indessen eröffnete soeben die AfD ihr zweites Büro in Crivitz neben Sternberg!
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen mitgeteilt wurde existiert die Ortsgruppe der AfD Crivitz und Umland schon seit ca. 10 Monaten. Sie war bisher damit beschäftigt mit sich bei verschiedenen Themen im Amtsbereich Crivitz einzuarbeiten und Strukturen zu entwickeln. Dabei beschäftigte man sich mit der Nordumgehung -Schwerin- in Leezen, die 110 KV – Leitung und Photovoltaikanlagen in Zapel, die Umbeseilung der 380 KV – Leitung in Bülow, das Unterkunftsprojekt für Flüchtlinge in Demen oder die überragende Rolle der Ortsgruppe der Volkssolidarität e.V. auf die Veranstaltungen in der Stadt Crivitz.
So ist weiterhin zu hören das der Schwerpunkt der parteilichen Tätigkeit der Ortsgruppe der AfD Crivitz und Umland erst einmal auf das Grundzentrum Crivitz und deren direkten Nachbarn ausgerichtet sein soll. Hierzu sollen bereits klare Vorstellungen und Konzepte existieren die man dann auch öffentlich mit den Bürgern vor Ort besprechen und debattieren möchte. Es war zu hören, dass es weitere Bürgerdialoge in der Stadt Crivitz und Barnin neben den in Wessin geben soll. Die Tendenz, weitere Büroräume im Landkreis LUP zu eröffnen, wird zunehmen.
Weshalb ist das so in Crivitz?
Die Ursachen liegen immer bei den derzeitigen regierenden Parteien und Wählergruppe im Stadtparlament. Wenn zwei Mehrheitsfraktionen in Crivitz (CWG-Fraktion und die LINKE/Heine bis 72 %) kontinuierlich ihre Dominanz ausbauen können, ohne dass eine signifikante oder nennenswerte Oppositionsarbeit glaubhaft dargestellt wird (CDU-Fraktion – 28 %). Dann erhöht das natürlich die Attraktivität und Anziehungskraft anderer politischer Parteien, sich in Crivitz und Umland zu engagieren und sich für Veränderungen einzusetzen.
Auch das Handeln der bisherigen regierenden Mehrheitsfraktionen (CWG-Fraktion und die LINKE/Heine) war gekennzeichnet durch: Intransparenz von Beschlüssen bzw. Absprachen, Abschottung und Zensur von anderen Meinungen sowie deren Verunglimpfungen auf öffentlichen Sitzungen, verbunden mit der eigenen Scheu eines öffentlichen Diskurses (der auch mal kritisch und kontrovers sein kann) sind nur einige Anhaltspunkte, die diesen Prozess beschleunigt haben. Egal, ob es sich um die Besetzung von Stellen, die finanziellen Haushaltsgaben/Ermächtigungen, die Ausarbeitung von Protokollen oder die Tatsache handelt, dass viele Angelegenheiten bevorzugt lieber unter Verschluss gehalten werden und die Bürgernähe stets nur dann im Vordergrund steht, wenn Kommunalwahlen anstehen.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch andere Parteien ihre Präsenz vor Ort zeigen und ihre Bereitschaft erklären, sich aktiv für Veränderungen einzusetzen!
Kommentar/Resümee

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Thema „Umgang mit der AfD“ wird noch eine Weile in den Köpfen der Menschen verankert sein. Wenn zwei der drei Regierungsparteien im Bundestag zurzeit gemeinsam nicht einmal so viele Stimmen auf sich vereinigen wie die AFD, sind nicht nur die Nerven strapaziert. Dieses Beispiel verdeutlicht, was in unserem Land alles schiefläuft.
Ein bekannter Chefredakteur hat in seiner Kolumne vor wenigen Monaten die folgenden Aussagen getroffen: „Wie schrieb gestern ein Leser in der ‚Bild‘ sinngemäß? Die AfD braucht gar nichts zu sagen. Die Wahlwerbung für sie liefern die anderen Parteien frei Haus. Oder anders ausgedrückt: Es sind damit erstaunlicherweise die sogenannten Linken, die das Volk den Weg nach rechts einschlagen lassen. Man könnte es auch als panikartige Flucht bezeichnen“.Es besteht keine Notwendigkeit, dem noch etwas hinzuzufügen oder zu kommentieren.
Wie bereits in Schwerin zur Oberbürgermeisterwahl haben sich alle Parteien gegen eine gestellt. Das wird sicher auch in der Stadt Crivitz in den kommenden 7 Wochen geschehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr einfaches Wahlkampfthema, wenn man keines hat oder nicht viel erzählen kann. Aber ob die Bürger letztlich bei der Abgabe ihres Votums in ca. 7 Wochen wirklich, dass alles auch so beurteilen werden, bleibt noch ungewiss?
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihre Redaktion
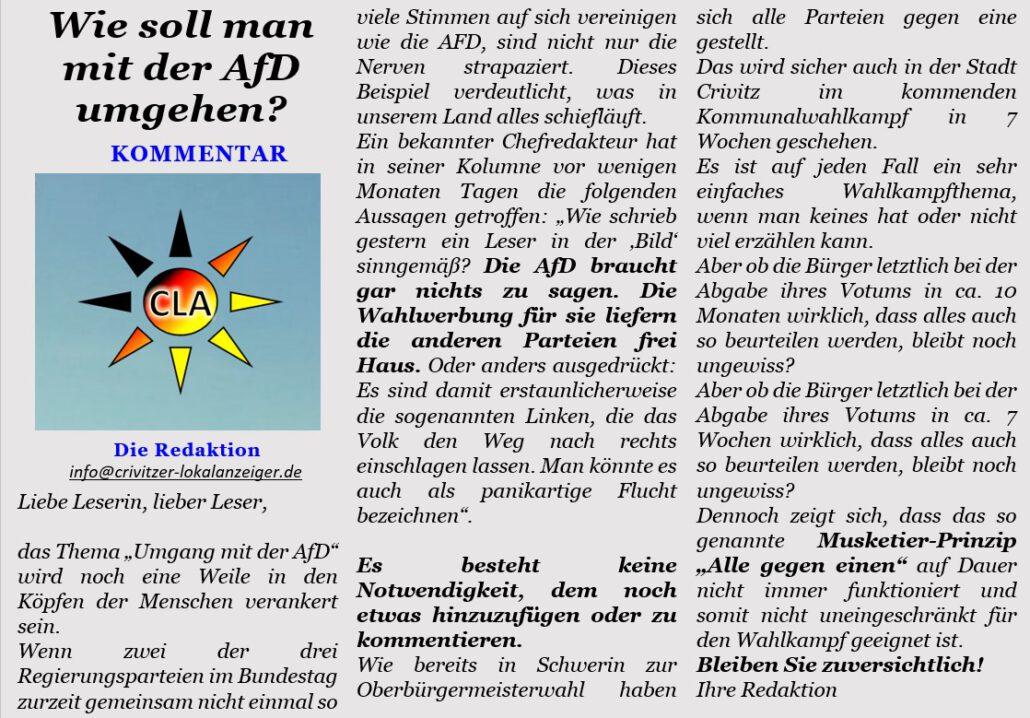
11.April -2024/P-headli.-cont.-red./364[163(38-22)]/CLA-201/39-2024
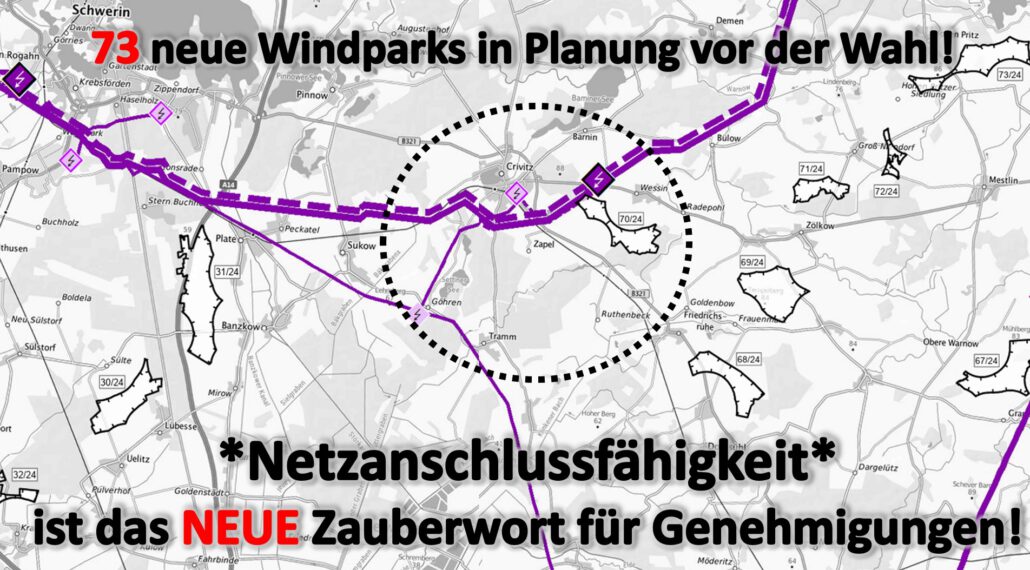
Ein naturverträglicher Ausbau von Onshore-Windparks ist nicht zu erkennen!
„Der Anschluss einer Windenergieanlage an das Stromnetz ist eine Grundvoraussetzung der Baugenehmigung“ (Protokollentwurf des Planungsverbandes Westmecklenburg vom 12.01.2024).
Das war der O-Ton auf der letzten Sitzung des Planungsverbandes, auf der Vertreter der WEMAG – AG sogar einen Vortrag über die Netzintegration hielten. Das neue Schlüsselwort für schnellere Genehmigungen lautet jetzt „Netzintegrationsfähigkeit“. Es wurde eigens ein neues Kriterium im Plan für die Abwägung geschaffen, ob bereits eine geeignete Stromnetzinfrastruktur in Windparkgebieten vorhanden ist oder nicht, um Windeignungsgebiete gesamtsystemisch effizient mit der geeigneten Stromnetzinfrastruktur erschließen zu können.
Das bedeutet, wo bereits Netzverknüpfungspunkte existieren (früher Umspannwerke) oder Leitungen vorhanden sind, sollen verstärkt Solar- und Windeignungsgebiete ausgewiesen und geplant werden. Dies betrifft insbesondere Görries (Schwerin – Süd), Parchim – Süd, den Ortsteil Wessin (Stadt Crivitz) und das Umland. Es geht primär darum, neue Kapazitäten für die Integration der neuen Windenergieanlagen in das Netz zu erschließen, wobei es nicht um die Synchronität von Erzeugung und Verbrauch geht. Folglich dürfte das Urteil für Gemeinden und Ortsteile, wie Wessin, die sich direkt an Netzverknüpfungspunkten (Umspannwerken) befinden, ergangen sein. Dies bedeutet, dass sämtliche Solar- und Windenergieanlagenplanungen [ENERGIEPARK – Wessin] an diesen Orten intensiviert und demnächst sogar schon ihre Genehmigungen erhalten werden.
So wurde bereits im Umweltbericht zum Gebiet zu Ortsteil Wessin [Nr. 70/24] keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sowie den Tourismus festgestellt. Ebenfalls wurde erläutert, dass das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt nicht beeinträchtigt wird. Was für eine absurde Einschätzung. Gleichfalls wurde auch bemerkt, dass es in diesem Gebiet keine kollisionsgefährdeten Brutvogelarten und Rastgebiete gibt und diese nicht betroffen sind. Jeder Einwohner oder Naturschützer aus Wessin kann nur den Kopf schütteln, da er sich seit einem Jahrzehnt genau mit diesem Gebiet befasst. Auch die Schlafplätze von Großvögeln existieren nicht oder sind nicht beeinträchtigt. Durch verschiedene Gesetzesänderungen, insbesondere des Naturschutzgesetzes, ist es nun möglich, anstelle der vorher 52 Windeignungsgebieten jetzt sogar 73 neue Windparks zu generieren. Die Angelegenheit soll jetzt zügig vor der Wahl in ca. 13 Tagen in Ludwigslust entschieden werden.
Die Aussage dürfte vornehmlich dem Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE/Heine im Crivitzer Stadtparlament, Alexander Gamm, Freude bereiten. Er ist seit Kurzem auch im Bündnis für Crivitz mit seinem Fraktionskollegen und Umweltausschusschef Hans – Jürgen Heine zusammen, welche sich beide besonders intensiv für das Projekt einer gemeinsamen Wärmegesellschaft mit der WEMAG – AG in Crivitz einsetzen. Die unter anderem auch vorrangig grünen Strom erzeugen soll. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2022 eine nicht öffentliche Arbeitsgemeinschaft [AG] Strom und Wärme (Vorsitz Alexander Gamm, Bauausschussleiter) in Crivitz gegründet und diese tagt weitgehend im Verborgenen. Nur einmal auf einem Unternehmerforum 2023, an dem nur wenige Teilnehmer anwesend waren und nicht die großen Schlüsselunternehmen von Crivitz, präsentierte Herr Gamm seine ganz persönlichen Vorstellungen über eine gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG – AG. Es ist offensichtlich, dass er sich für dieses Projekt absolut begeistert und einbringen würde, obwohl es hierzu in der Öffentlichkeit nur äußerst spärliche und oberflächliche Ausführungen gibt.
In den Crivitzer Ausschüssen findet keine öffentliche Diskussion über dieses Thema statt, sondern lediglich nur Ankündigungen. Herr Alexander Gamm verfügt offenbar über eine derart fulminante und uneingeschränkte Kompetenz, dass er keinen Stellvertreter benötigt und auch nicht wollte bei der Wahl zum Bevollmächtigten der Stadt Crivitz am 26. Februar 2024. Die Bevollmächtigten der Stadt Crivitz werden auch Verhandlungen mit potenziellen Investoren, Energieversorgern, benachbarten Kommunen und Spitzenkräften für erneuerbare Energieformen führen. Das geht auch über den Wahltermin im Juni hinaus und erklärt schließlich das besondere Engagement. Es handelt sich letztlich um die Bedeutung einer Schlüsselposition, um mitzureden, falls es nach der Wahl anders kommen sollte. Also, erneut geht es um die Besetzung eines Postens.
Die abgehobene Arroganz des Entwurfs des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wird im Dokument für die Zusammenfassung der wesentlichen Argumente unter dem Absatz: „Schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept, Ausschluss- und Restriktionskriterien“ zum Bereich der „Großvögel“ zum Ausdruck gebracht.
Zitat: „Eine regionsweite Durchführung von Funktionsraumanalysen überall dort, wo ein erhöhtes Kollisionsrisiko vermutet wird, ist auf Ebene der Raumordnung zudem weder leistbar noch geboten bzw. sinnvoll.“
(Seite 13). Man könnte das auch so übersetzen, dass es im Prinzip so heißt: Wir haben keine Lust, eine genaue Untersuchung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durchzuführen sowie auch nicht die Mittel. Daher planen wir einfach und fertig! So einfach ist es im Jahr 2024!
Kommentar/Resümee

„Alternative Energieerzeugung ist sinnlos, wenn sie das zerstört, was man durch sie schützen will: Die Natur.“ Reinhold Messner!
Zur Freude der WEMAG und E.DIS AG stellt die Netzanschlussfähigkeit nun ein wichtiges Kriterium für Baugenehmigungen bei Windanlagen dar!
10 Jahre lang suchte der Planungsverband Westmecklenburg nach dem Zauberwort, gegen das man sich nicht mehr wehren kann und das schnellere Genehmigungsverfahren für Windeignungsflächen ermöglicht. Die Schwierigkeiten im regionalen Planungsverband Westmecklenburg beim Thema Windenergie sind hausgemacht. Das ganze Hin und Her geht schon seit 2014 und inzwischen steht der Verband vor einem Scherbenhaufen seines eigenen Handelns!
Damals hatten der ehemalige Vorsitzende des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Herr Rolf Christiansen und sein Stellv. Thomas Beyer (beide SPD-Fraktion) einen Beschluss im Verband mit herbeigeführt, ein ganz bestimmtes Windeignungsgebiet zu streichen. Gegen diese Herangehensweise wurde erfolgreich geklagt wegen eklatanter verwaltungsrechtlicher Fehler und seitdem wird an diesem Plan herumgebastelt, mit fatalen rechtlichen Folgen. Der Plan hat bis heute keine Rechtskraft oder eine vergleichbare Zielsetzung.
Eine neue überarbeitete Planung bis 2027, die sowohl neue Flächen als auch stark aufgeweichte Artenschutzkriterien und ein neues Kriterium, die „Netzintegrationsfähigkeit“ berücksichtigt, soll soeben endlich die Rettung bringen. Selbstverständlich muss alles noch vor der Wahl am 24.04.2024 in der alten mehrheitlichen Akteursbesetzung stattfinden und gleichzeitig beschlossen werden. Damit es nach der Wahl keine weiteren Veränderungen oder Einflüsse mehr den Plan beeinflussen können.
Wenn es Probleme mit den Horsten des Rotmilans gibt, muss man das im Genehmigungsverfahren überprüfen. Für diese Aufgabe ist jedoch der Planungsverband nicht zuständig, sondern das staatliche Amt. Dadurch werden alle Probleme erneut an eine andere Behörde weggeschoben. Dies ermöglicht es, die Unannehmlichkeiten bereits vor der Wahl im Juni 2024 zu beseitigen.
So einfach ist es im Jahr 2024!
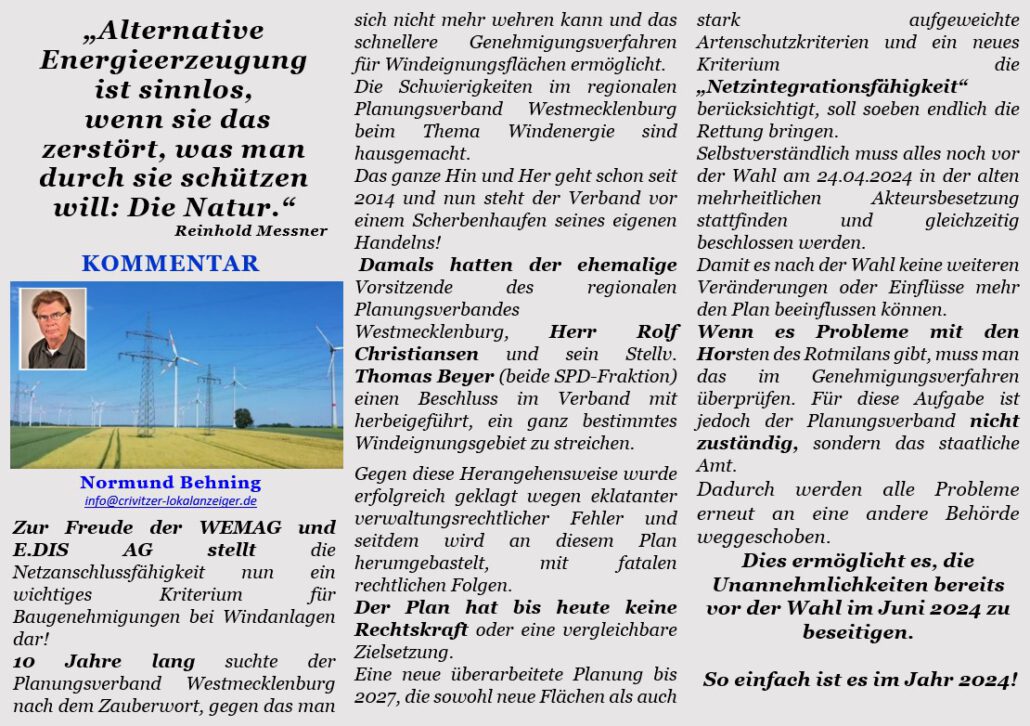
08.April -2024/P-headli.-cont.-red./363[163(38-22)]/CLA-200/38-2024

Der Frühling hat sich eingestellt. Ich hoffe, Sie haben mit Ihren Lieben frohe Ostertage verbracht und durch die klassischen Brückentage für einen Urlaub genutzt, um etwas Kraft zu tanken. Manchmal ist es notwendig, genauer hinzusehen, um die guten Dinge zu identifizieren. Das gilt nicht nur für die Ostereiersuche, sondern auch für die Erteilung von neuen Ermächtigungen für die Bürgermeisterin.
Es bereitet der Bürgermeisterin große Sorge, dass sie seit 2019 die Beschaffung von Schulbüchern und Arbeitsheften für die Schuljahre immer wieder selbst in die Hand nimmt. Wie in den vergangenen Jahren kann sie nicht einmal 14 Tage warten, bis die nächste turnusmäßige Sitzung der Stadtvertretung Crivitz stattfindet. Sie lässt sich wieder mal vorzeitig vier neue Vollmachten für ERMÄCHTIGUNGEN vom beschließenden Hauptausschuss erteilen. Selbstverständlich repräsentiert sie die Mehrheit mit den Sitzen der Fraktion von CWG-Crivitz und der LINKE/Heine im Ausschuss. Damit sie die Schulbuchvergabe und die Arbeitsheftbeschaffung unter ihrer eigenen Kontrolle hat. Seit 2019 hat die Bürgermeisterin ca. 40 Ermächtigungen für die Vergabe von Aufträgen erhalten.
Das Erstaunliche dabei ist, dass einige der Ermächtigungen, die auf der Basis von freihändigen Vergaben erteilt wurden, ohne Angabe von Gründen endeten. Etwa 30 % dieser Ermächtigungen betreffen die Schulbuchvergabe und die Beschaffung von Arbeitsheften. Die Hauptsatzung wurde durch die Mehrheitsfraktionen (CWG – Crivitz und die LINKE/Heine) bewusst angepasst, um die Befugnisse der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm massiv zu erweitern.
Besonders erfreulich ist natürlich, dass bei der Schulbuchvergabe und der Beschaffung von Arbeitsheften fast alle freihändig erfolgten und dass diese Summen einfach in mehrere kleinen Lose aufgeteilt wurden. Wie derzeit in den einzelnen Losen von 6.460 €,12.000 €,15.500 € und 13.100 €. Bei der Durchführung der freihändigen Vergabe wenden sich Auftraggeber an mehrere ausgewählten Unternehmen und fordern zu einer Angebotsabgabe auf. Mit diesen verhandelt er dann über die festgesetzten Auftragsbedingungen hinsichtlich Preises und Leistung. Im Unterschwellenbereich, was hier überwiegend die Anwendung findet, regeln Wertgrenzen, ob eine freihändige Vergabe gesetzlich erlaubt ist. Bei einem Auftragswert nur bis zu 10.000 € können ohne Angabe von Gründen und Erklärungen freihändig vergeben werden. Für Liefer- und Dienstleistungen liegt der Schwellenwert für eine freihändige Vergabe bei 20.000 €.
Eine Direktvergabe ist nach § 14 VgV möglich, wenn zwingende und dringende unvorhersehbare Gründe vorliegen, sodass die Mindestfristen nicht eingehalten werden können. Oft wurde dieser Grund dafür verwendet, um die Handhabung zu rechtfertigen, wie auch in der aktuellen Begründung, um die Vergabe zeitlich unabhängig von den Sitzungen planen zu können.
Die Aufträge wurden in der Regel von der CONCORDIS Jahn & Windisch GmbH (Gesellschafter: Sven Jahn und Uwe Windisch) in Wessin OT von Crivitz ausgeführt, auch Vorjahr, welche sich bei den Serviceleistungen durchsetzen konnte. Ortsansässige Buchhandlungen haben gegenüber nicht ortsansässigen keinen Vorteil, jedenfalls sagt das Gesetz, dass es ausdrücklich verbietet, ortsansässige Händler gegenüber Ortsfremden zu bevorzugen. Die Ortsansässigkeit eines Bieters in der Stadt oder im Landkreis ist für sich genommen kein objektives Zuschlagskriterium. Die Kommune darf keine Bieter bevorzugen, die für die Abwicklung des Schulbuchauftrages besonders geeignet erscheinen.
Bei den meisten Auftraggebern der öffentlichen Hand meinen, dass ein „Vor-Ort-Service“ oder ein Ansprechpartner vor Ort für die Beschaffung von Schulbüchern nicht erforderlich ist. Sie bewerten die Serviceleistungen nicht ortsansässiger Buchhändler höher als die von ortsansässigen. Nur durch zusätzliche Angebote für den Kundendienst und die Serviceleistungen wie die Einsortierhilfe, Etikettierung, die Folierung von Schulbüchern oder auch die Entsorgung von alten Schulbüchern kann man besonders überzeugen.
Wir dürfen gespannt sein, wie das Rennen ausgeht, das zwingend vor der Wahl im Juni 2024 stattfinden muss und mit einigen Ermächtigungen für freie Vergabe gekennzeichnet ist!
Kommentar/Resümee
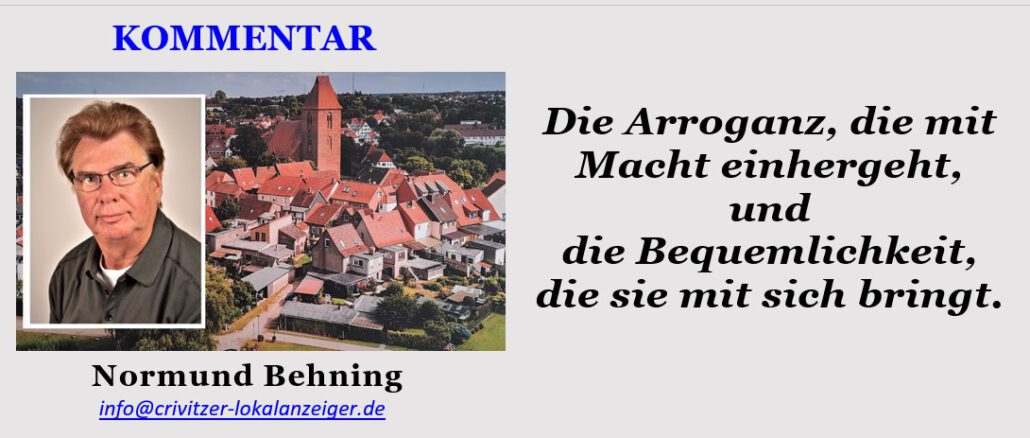
Die Arroganz, die mit Macht einhergeht, und die Bequemlichkeit, die sie mit sich bringt.
Der Grundtenor des Handelns und Wirkens der CWG und LINKE erstreckt sich seit ca. 58 Monaten auf die Erweiterung/Erteilung von „Ermächtigungen“ und „Verfügungen“, um Diskussionen sowie eventuelle Einsprüche/Vorbehalte zu Sachverhalten zu vermeiden. Die Ausdehnung der eigenen Herrschaft (72 % Mehrheit) und Einflussnahme auf Vergabeentscheidungen in finanziellen Kernbereichen ist das wesentliche Ziel.
Abgesehen davon, großflächige und teure Bauprojekte zu planen und mit Vergabeverfahren die determinierte einheimische Unternehmerschaft wohlwollend zu unterstützen, sowie zugleich die Finanzausgaben und Schulden im Haushalt exorbitant zu erhöhen, gab es kaum andere Initiativen. Die Schulden von HEUTE sind die Steuererhöhungen vom MORGEN.
Wie auch in der anstehenden Hauptausschusssitzung am 08.04.2024. Ein wichtiges Thema: Vorab erteilte Ermächtigungen für die Bürgermeisterin von Crivitz zur Beschaffung und Vergabe von Aufträgen! Die Teilnahme an Wettbewerben im Land und Kreis sowie die Einreichung von Förderanträgen und die Initiativen aus der Antragslyrik sind die eigentlichen Treiber der Ideen.
Die Möglichkeiten, die finanziellen Spielräume eines Bürgermeisters zeitlich begrenzt zu erhöhen, waren innerhalb der Coronapandemie begreiflich, aber nicht für immer gedacht. Es würde sonst eine permanente Konzentration der Macht entstehen, die schwer zu beaufsichtigen ist. Das erzeugt Ohnmacht bei allen anderen. Die Verwaltung ist erfreut, da es weniger störende Nachfragen gibt. Kommunale Selbstverwaltung und Kontrolle sieht anders aus.
Es besteht die Möglichkeit, dass der Spielraum für Ansichten, einer eventuellen unangemessenen Begünstigung von Einzelnen oder auch nur einen dahin gehenden Eindruck, zunimmt.
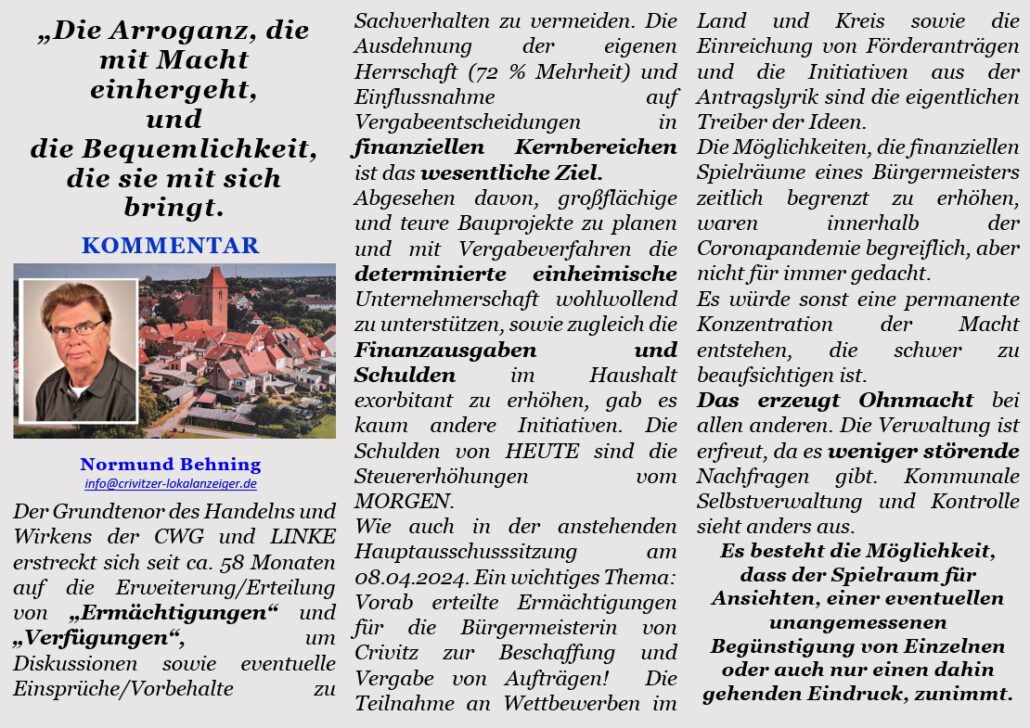
05.April -2024/P-headli.-cont.-red./362[163(38-22)]/CLA-199/37-2024
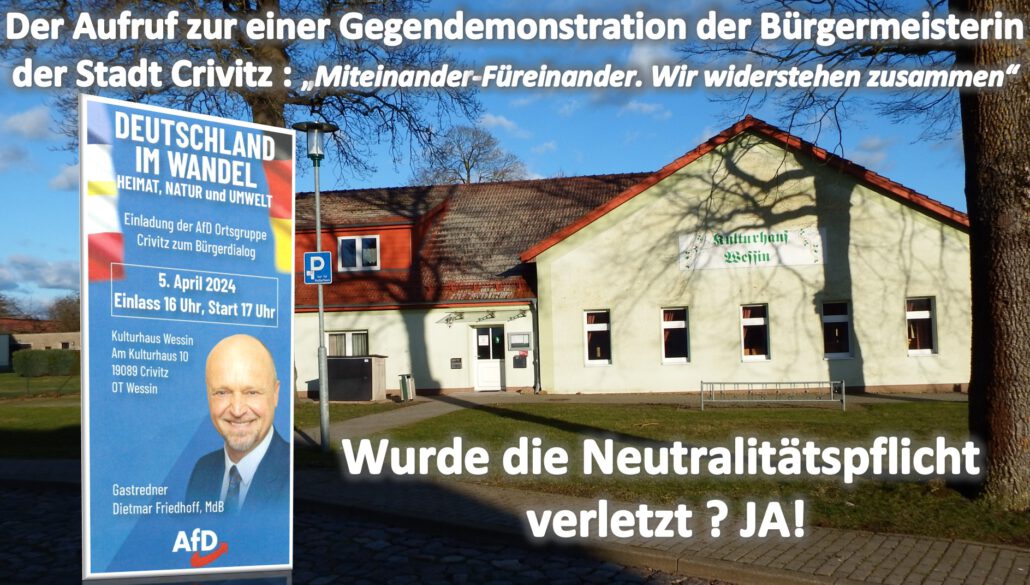
Das große Rätsel um das Wahlkampfthema der Wählergruppe der „CWG“- Crivitz dem auch die Bürgermeisterin ( Britta Brusch-Gamm) von Crivitz angehört, wurde gelöst. Es handelt sich um die AFD.
Es ist zu erwarten, dass sicherlich auch das Bündnis für Crivitz BFC dem Aufruf zur Gegendemo von der Wählergruppe der CWG – Crivitz sofort annimmt, da die Mitglieder der Partei Die Linke + SPD + Bündnis 90/ Die Grünen in Crivitz nicht kandidieren werden. So hat man dann ein gemeinsames Thema im Kommunalwahlkampf und das ist eben eine geteilte Sorge. In Crivitz scheint der politische Mainstream noch wenig entwickelt zu sein, um sich mit verschiedenen Meinungen und Themen in einen Meinungsaustausch zu begeben und Toleranz auszuüben. Es ist nicht erlaubt, eine abweichende Meinung zusätzlich zu den zuvor festgelegten Ansichten zu äußern.
Denn die Bürgermeisterin einer Stadt stellt eine Behörde dar. Sie ist somit Teil der Exekutive und hat als Organ des Staates gemäß Art. 21 Abs. I GG das Neutralitätsgebot zu beachten. Das wurde durch den Aufruf am Samstag deutlich verletzt, der in sozialen Medien veröffentlicht wurde und im Ortsteil Wessin und der Stadt im Umlauf war.
„Moin Zusammen, lieber Herr Landrat, liebe Landtagsabgeordnete, liebe Mitglieder der demokratischen Parteien, liebe Mitglieder in demokratischen Bündnissen und Vereinen, es ist gerade bekannt geworden, dass die AfD am 05.04.2024 ab 16 Uhr im Kulturhaus Wessin einen sogenannten Bürgerdialog durchführen wird, siehe Anhang. Das soll nicht ohne eine deutliche Reaktion unserer Region passieren. Miteinander-Füreinander. Wir widerstehen zusammen. Sympathisanten des Faschisten Höcke brauchen und wollen wir nicht. Ich habe dazu gerade einen Aufzug/eine Demonstration am Kulturhaus in Wessin angemeldet, Beginn ab 15.30 Uhr bis ca. 19 Uhr, mit Aufzug zum Teil über die B392 und Rückmarsch zum Kulturhaus. Beginn mit Belehrung am Kulturhaus, dann Aufzug, dann Demo vorm Kulturhaus, evtl. begleitend zum „Bürgerdialog“. Bitte versuchen sie alle daran teilzunehmen, bringen sie Jede und Jeden mit. Wer reden möchte, kann sehr gerne reden. Der Ablauf ist noch sehr flexibel. Wir würden hier vor Ort kurzfristig mehrere Plakate/Flyer anfertigen und sehr gerne die Unterstützung einzelner Personen, der Parteien, der Bündnisse und Vereine mit draufsetzen, damit die Vielfalt unserer parlamentarischen Demokratie deutlich wird. Bringen sie Plakate, Banner, Transparente mit. Es wäre sehr gut, wenn bis Sonntagabend Rückmeldungen zur Teilnahme kommen. Am Montag soll der Entwurf des Plakates und der Flyer erfolgen, die ab Dienstag veröffentlicht werden. Erste Entwürfe zu den Plakaten/Flyern kommen in einer separaten Mail, sobald sie vorliegen. Und je früher wir Rückmeldungen bekommen, desto früher können wir bereits über die Ostertage in den sozialen Medien dazu werben. Danke und allen ein frohes Osterfest.“ (Britta Brusch-Gamm, Taubenweg 20,19089 Crivitz, Tel.: 0172 950 915 6, Email: brusch-gamm@t-online.de) [soziale Medien K-Samstag, 30.03.2024 mittags].
Vor allem im Hinblick auf die Chancengleichheit der politischen Parteien spielt das Neutralitätsgebot eine Rolle. Zum Beispiel darf kein staatliches Organ einer Partei verfassungsfeindliche Tendenzen unterstellen, sofern das Bundesverfassungsgericht diese nicht festgestellt hat. Der VGH Kassel hat mit Beschluss vom 03.05.2013 (8 A 772/13) festgestellt, dass ein Bürgermeister in seiner Funktion als Versammlungsbehörde dazu verpflichtet ist, kritische Äußerungen zu unterlassen, die eine in der Stadt auftretende Partei in ihrem Recht aus Art. 21, 8 Abs. I GG verletzt. Im vorliegenden Fall rief der Bürgermeister der hessischen Stadt zu einer Gegenkundgebung auf. Der Aufruf wurde unter anderem auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht.
Nach einer kurzen Anfrage beim Ordnungsamt bei Amt Crivitz wurde mitgeteilt, dass ein Antrag zu einer Demonstration vorlag. Der Landkreis lehnte diesen Antrag jedoch auch ab, da es sich hierbei um eine Sperrung der Bundesstraße B-392 handelt und Zufahrten zu den Veranstaltungen beachtet werden müssten. Auch die Osteilvertretung von Wessin beriet öffentlich über diesen Antrag in Ihrer Sitzung am 3. April 2024 und lehnte diese Vorgehensweise der Bürgermeisterin von Crivitz ab.
Einerseits befürchtete man, dass die Gegendemonstranten möglicherweise Konflikte verursachen könnten und eventuelle Schäden am Kulturhaus entstehen würden. Jedoch der Grundgedanke der OTV in Wessin war, dass sie dem angekündigten Bürgerdialog der AFD-Ortsgruppe nicht im Wege stehen und ihn als gänzlich legitimen demokratischen Prozess im Wahlkampf zu den Kommunalwahlen betrachten. Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung, der auch in den sozialen Netzwerken aktiv war, hat bereits am Ostersonntag eine Intervention bei der Bürgermeisterin angekündigt und deutlich gemacht, dass diese Vorgehensweise so missbilligt wird.
Demokratie kann das wohl gut aushalten, oder?
Kommentar/Resümee
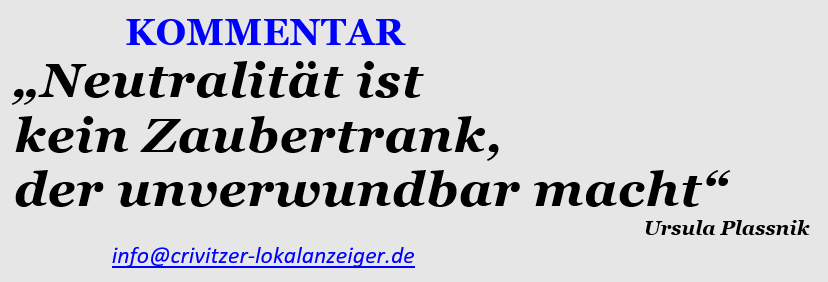
Neutralität ist kein Zaubertrank, der unverwundbar macht — Ursula Plassnik –
Demokratie kann man nur leben. Jeder sollte sich selbst hinterfragen, ob er Andersdenkende respektiert.
Die Mehrheitsfraktionen im Stadtparlament von Crivitz, die Wählergruppe „CWG“ Crivitz und die Fraktion DIE LINKE/Heine haben den Umgang mit Andersdenkenden in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich sehr erschwert. Ein Dialog mit anderen Ansichten als dem vorherrschenden Mainstream von den Mehrheitsfraktionen wurde hier schon lange nicht mehr ernsthaft geführt.
Es ist nicht zum ersten Mal, dass Bürger als „Sympathisanten des Faschisten Höcke“ beschimpft werden. Zuletzt geschah es im Bauausschuss des Jahres 2023 durch den Vorsitzenden Alexander Gamm (Fraktion DIE LINKE/Heine). Dies führt dazu, dass dieser Sprachgebrauch in den derzeitigen Mehrheitsfraktionen (CWG-Crivitz + die LINKE/Heine) fest verankert ist. Durch die Aufforderung einer Behörde zur Gegendemo (Amt der Bürgermeisterin) wird bestätigt, dass man aus bestehenden Machtpositionen den Wahlkampf beeinflussen möchte.
So wurde auch in Kassel festgestellt, „dass eine politische Partei sehr wohl mit kritischen Kommentaren und negativen Bewertungen aller Art leben muss. Gerade davon lebt schließlich eine demokratische Gesellschaft, die sich durch demokratische Willensbildung auszeichnet. Ein gewisser Diskurs muss und soll sein. Das Gericht führt hier jedoch aus, dass diese kritischen und negativen Bekundungen durch ebenfalls politische Parteien und Organisationen zu erfolgen haben muss“. (www.juraforum.de)
Eine Demokratie sollte auch einen Bürgerdialog von der AFD aushalten können, es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten, seinen Unmut auszudrücken wenn man will
Vielleicht in einem Dialog?
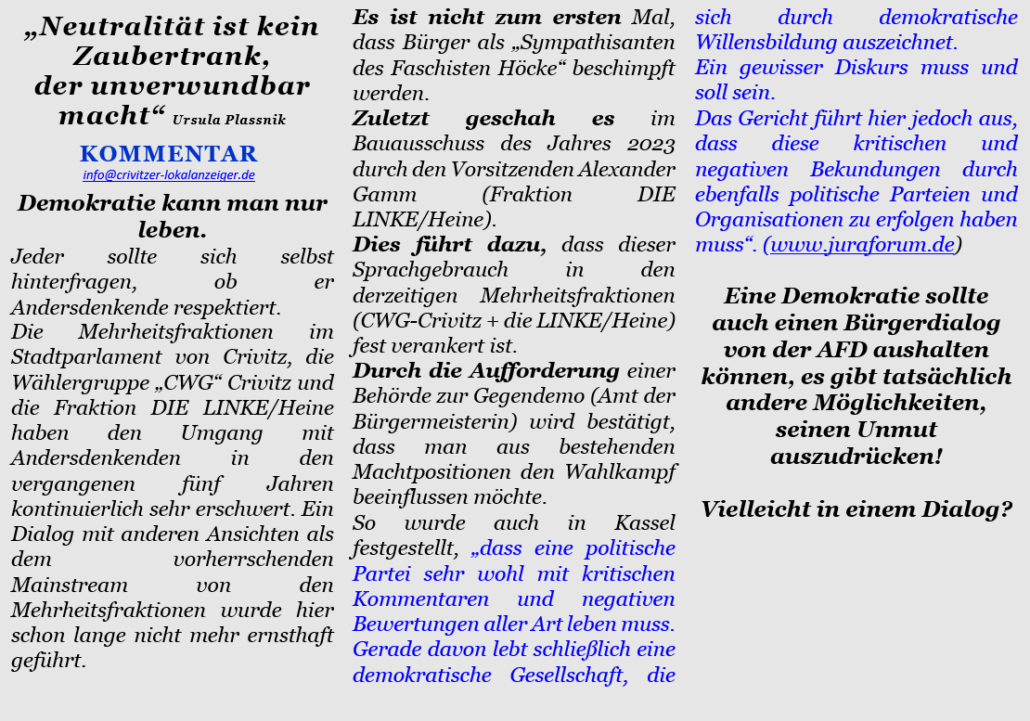
03.April -2024/P-headli.-cont.-red./361[163(38-22)]/CLA-198/36-2024

Seit 2019 gibt es viele Schaufensterbeschlüsse von der CWG-Crivitz + der Linken/Heine. Aber vor der Wahl muss alles noch schneller gehen!
Nirgendwo anders in einem Ausschuss ist das Thema der Stellenerweiterung für das Arboretum diskutiert worden und nun soll es einmalig im beschließenden Hauptausschuss sofort umgesetzt werden. Das ist möglich, weil der Haushaltsplan 2024 im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V eine allgemeine Abweichung vom Stellenplan von 5 % zulässt, wenn die im Stellenplan ausgewiesene ca. 122 Mitarbeiter nicht übersteigt.
Der Stellenplan der Stadt für das Jahr 2024 sieht einen Zuwachs gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2023 in einem Umfang von insgesamt 4 weiteren Stellen vor. Insgesamt werden 122 Stellen besetzt sein. Von 2014 bis 2024 hat sich der Personalbestand um ca. 80 % erhöht. Im Jahr 2014 waren es 68 Mitarbeiter, während es im Jahr 2024 = 122 Mitarbeiter sein werden. Seit dem Jahr 2014 sind die Personalaufwendungen um ca. 114 % gestiegen, von 2.253.100 € im Jahr 2014 auf ca. 4.812.100 € im Jahre 2024. Hinzu kommen die sonstigen Personalnebenkosten in Höhe von 34.300 € sowie die Auszahlungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 41.500 €. Daraus ergibt sich eigentlich ein Gesamtbetrag von 4.888.000 €.
Aufgrund der baldigen Tarifverhandlungen ab November 2024 und der anstehenden Leistungsverhandlungen sowie durch die Reduzierung der tariflichen Wochenarbeitszeit auf durchschnittlich 38,5 Stunden ab 01.01.2025 pro Woche wird mit einer weiteren Steigerung der Personalkosten bis auf ca. 5,11 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet. Die Diskrepanz in der Verteilung der Erträge für die Aufwendungen nimmt der Stadt Crivitz in Zukunft ab 2025 weiter deutliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Das Arboretum Crivitz ist Eigentum der Stadt Crivitz und wird durch den Förderverein „Arboretum Crivitz“ unterstützt.
Verzweifelt wurde in den vergangenen 10 Jahren versucht, kostenintensiv dort nordamerikanische Bäume z. B. Dorn-Gleditschie, Tulpenbaum, Schwarznuß, Weymouts-Kiefer, Sitka-Fichte oder asiatische Bäume z. B. Zweilappiger Ginkgo, Nikkotanne anzupflanzen jedoch, wie wir jetzt wissen, leider vergebens. Bis 2014 mobilisierte die Stadt Crivitz bis zu ca. 150.000 € für die Errichtung und Herstellung und jährliche Bewirtschaftung.
Der Förderverein des „Arboretum Crivitz e. V.“ (Vorsitzender Herr Hans-Jürgen Heine und Stellvertreter Herr Hartmut Paulsen) erhält seit 10 Jahren eine jährliche Zahlung von ca. 10.000 € von der Stadt Crivitz. So wurden auch danach ab 2014 bis 2024 allein in die fortlaufende Unterhaltung (Pflegekonzept) insgesamt ca. 90.000 € + zusätzlich Anpflanzungen ca. 10.000 € durch die Stadt Crivitz investiert. Zusätzlich wurde noch in die Ausstattung mithilfe von Fördermitteln investiert (Holzbrücke, Lehr- und Wanderpfad, Holz-Pavillon, Hinweisschilder und Sitzgarnituren) mit bis zu ca. 120.000 €. So kann man zusammenfassend feststellen, dass an Institution für Forschung, Lehre und Bildung; verschiedenartiger Gehölze in den vergangenen 14 Jahren auf passable ca. 360.000 € aufgewendet wurden!
Nun ist das Ganze nicht mehr ausreichend und es ist zwingend sofort notwendig, einen Minijobber für das ARBORETUM einzustellen. Dem folgt soeben auch noch das Bestreben einer neuen Mitgliedschaft der Stadt Crivitz in einem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, dass die Anwesenden im Umweltausschuss im Monat März überraschte, weil sie davon auch nichts wussten. Diese Mitgliedschaft kostet 185 € und sollte spätestens auch im beschließenden Hauptausschuss in 5 Tagen beschlossen werden.
Das Bündnis ermöglicht, sich als Kommune zu profilieren und positiv auf sich und Ihre Maßnahmen aufmerksam zu machen sowie darzustellen. Es stellt eine Plattform für eine interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation dar, bietet Kontakte und Ansprechpartner für den kommunalen Naturschutz. In Online-Workshops und der jährlichen Jahresversammlung werden die Mitglieder in aktuellen Fachthemen geschult. Allerdings hat der Vorsitzende Hans-Jürgen Heine bereits in der Vorlage für das Protokoll dieser Sitzung den Beschluss gefasst, dass der Ausschuss dieser Mitgliedschaft zustimmt und der Stadtvertretung dort empfiehlt, sich zu beteiligen. So einfach und so schnell geht das eben im Umweltausschuss, wenn man die Protokolle als Vorsitzender selbst schreibt.
Wieder einmal dient eine Mitgliedschaft zur Profilierung einzelner!
Kommentar/Resümee
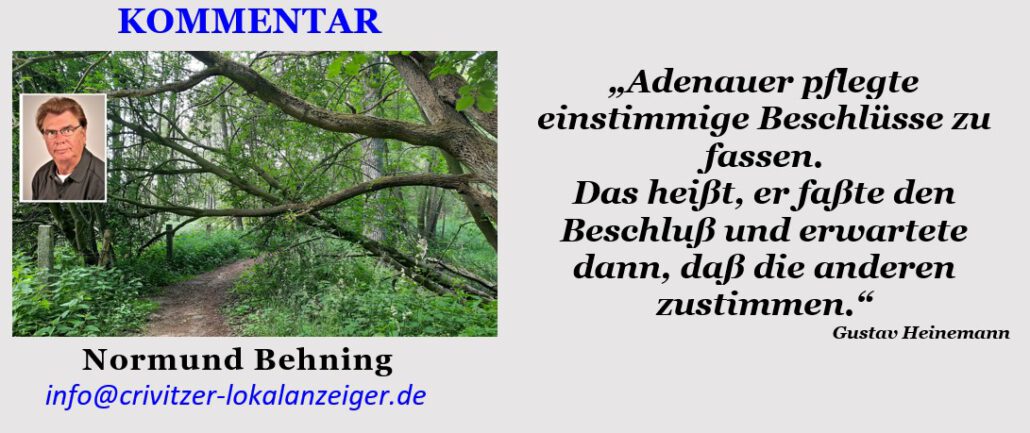
„Adenauer pflegte einstimmige Beschlüsse zu fassen. Das heißt, er faßte den Beschluß und erwartete dann, daß die anderen zustimmen.“ Gustav Heinemann
Es sollten eigentlich nur drei Hauptthemen für das Jahr 2024 gelten, wie es auf der Sitzung des Umweltausschusses im Januar 2024 bekannt wurde. Die Themen lauten: 1. Der Stadtpark, 2. Das Arboretum und 3. Die Umweltpreise und 4. Der Aufbau einer Karbonisierungsanlage im Gewerbegebiet Crivitz.
Nun kommen der Minijob und eine neue Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft hinzu. So stellt es aber eine Herausforderung dar, die Mitgliedschaft im Verein AGFK MV, das heißt „Arbeitsgemeinschaft für Fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen in MV“, zu besetzen, was der Umweltchef Herr Hans – Jürgen Heine selbstverständlich übernimmt. Soeben kommt die nächste Mitgliedschaft im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ hinzu. Öffentliche Vorberatungen scheinen nicht mehr so in Mode zu sein im Umweltausschuss, zumindest nicht ca. 8 Wochen vor der Kommunalwahl. Alles muss wieder rasant gehen. Es ist schon erstaunlich, dass der Umweltausschuss seit einiger Zeit wieder einmal eigenmächtig über dieses Thema diskutiert und die Ortsteilvertretungen sowie die anderen Ausschüsse hierzu nicht in Betracht zieht.
Wie auch beim „Grünen Band“ in Crivitz, es wurde zwar nicht gefördert, aber es wurde schließlich schnell beschlossen. Jetzt sollen die Wanderwege auf einer großen Übersichtstafel gezeigt werden. Außerdem sollen Flyer gedruckt werden. Für diesen Zweck möchte man etwa 7000 € ausgeben und eine Arbeitsgemeinschaft bilden, die die Aufgaben übernimmt.
Man kann nur hoffen, dass die Bürger spätestens im Juni 2024 in Crivitz bei der Abgabe ihrer Stimme erkennen, dass man eine Vielzahl von politischen Parteien und Initiativen auswählen sollte. Die sich mit diesem Thema umfassend und in einer größeren Anzahl als bisher auseinandersetzen sollten. Natürlich sollte das Ganze gemeinsam geschehen.
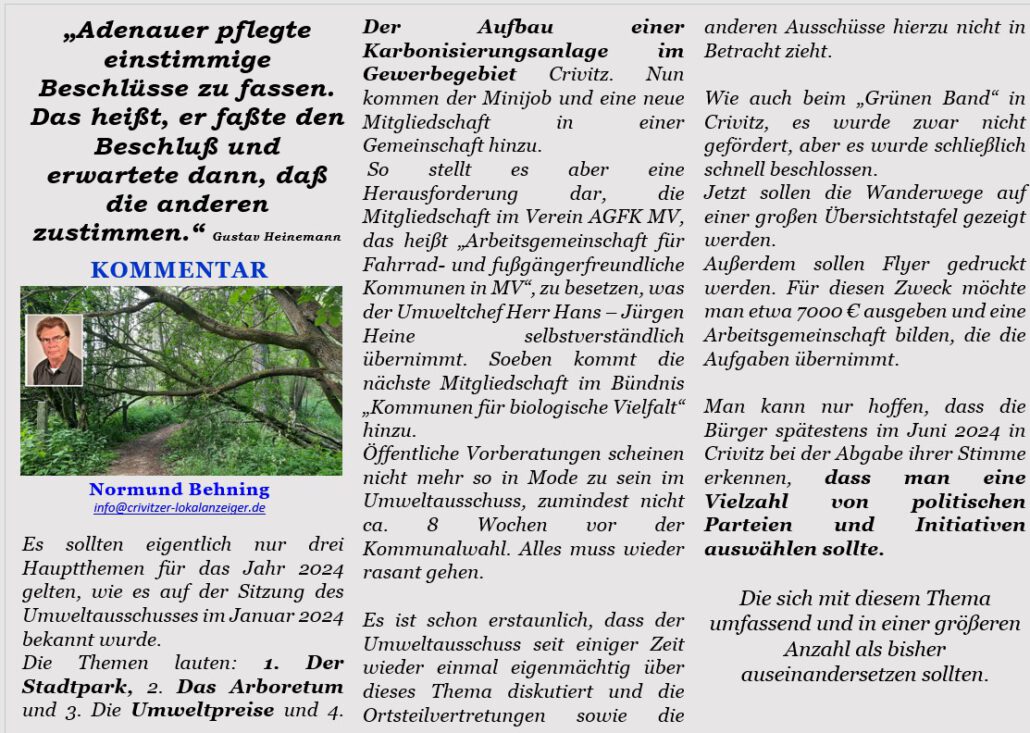
02.April -2024/P-headli.-cont.-red./360[163(38-22)]/CLA-197/35-2024
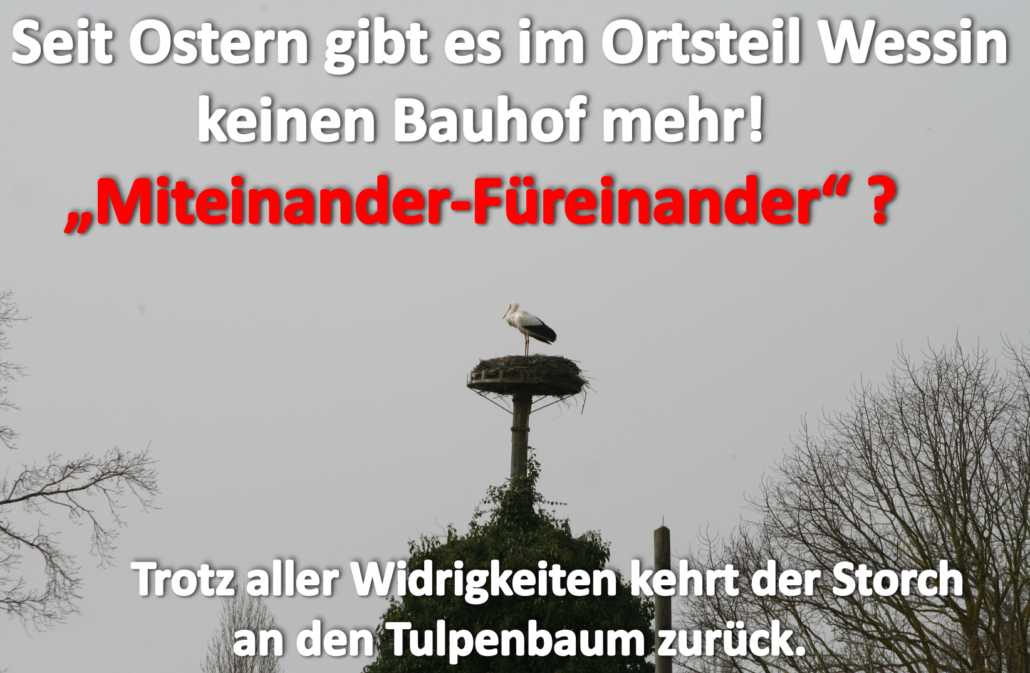
Es sind keine Neueinstellungen geplant? „Miteinander-Füreinander“? Das geht ganz sicher anders!
Nach stundenlangen Lobbekundungen der CWG-Crivitz+ Linke /Heine an sich selbst und ausgiebigen Lobpreisungen beim Neujahrsempfang im Monat März hat jedoch der Ortsteil Wessin bei dem Thema Bauhof jedenfalls verloren. Bis Ostersonntag waren zwei Mitarbeiter im Bauhof Wessin für 68 Stunden im Monat im Einsatz. Ab diesem Zeitpunkt ist der Bauhof nicht mehr besetzt.
Der Bauhof in Wessin verbrauchte im Jahr ca. bis zu 35.000 € an Aufwendungen; circa die Hälfte davon waren Personalkosten. Die anderen großen Posten waren die Aufwendungen für Strom ca. 4.000 €, Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz ca. 5.500 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 3.000 € und Betriebs- und Schmierstoffe Kfz ca. 2.000 €.
Ab dem 01.04.2024 wird der jährliche Verbrauch ohne den restlichen Anteil an Personalkosten nur noch ca. 2.200 € betragen. (Aufwendungen für Abfall ca. 100 €, Strom ca. 500 €, Unterhaltung der Grundstücke+ Außenanlagen ca. 500 €, Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz ca. 300 €, Betriebs- und Schmierstoffe Kfz ca. 200 €, Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattung ca. 100 €, Kfz-Steuer und Abschreibungen jeweils 100 € und Versicherungen ca. 300 €). Die Kosten für die Folgejahre betragen also nur noch 10 % der ursprünglichen Ausgaben.
Es fand sich auch niemand in der CWG-Fraktion und in der Fraktion die LINKE/Heine, der diesen Schritt der Kürzungen im Ortsteil Wessin bedauerte, als der Haushalt 2024 beschlossen wurde. Im Gegenteil, nun werden sicherlich die öffentlichen Leistungen ausgeschrieben, die dann eigentlich in dem Ortsteil zu machen sind, für private Leistungsträger/Anbieter und diese werden sich sicher sicherlich übermäßig freuen. Lassen wir uns überraschen, wer schon bald den Sieg oder genauer gesagt den Sieg von den zwei Firmen im Ortsteil errungen hat!
Ist das alles nur ein politisches Manöver? Oder ist das auch für den Bauhof Crivitz und Gädebehn als ein MODELL für die Zukunft geeignet? Dort spielt man seit Jahren mit anderen Zahlen. Der Crivitzer Bauhof hat insgesamt 9 Mitarbeiter in Vollzeit und einen Teilzeitbeschäftigten für den OT Kladow. Dieser ist aber dem Bauhof Crivitz zugeordnet. Die jährlichen Kosten für den Crivitzer kommunalen Bauhof belaufen sich auf etwa 630.000 €. Also, ist das 18 Mal höher als im Ortsteil Wessin? Damit sind es 130.000 € mehr Ausgaben als im Jahr 2022 und lediglich 20.000€ weniger als im Vorjahr!
Also, wenn man schon ein permanentes und unüberhörbares „Miteinander-Füreinander“ seitens der CWG-Fraktion und der LINKE/Heine propagiert. Warum werden dann in dem Ortsteil Wessin die Ausgaben 2024 für den Bauhof bis zu 90 % reduziert und die Kosten für den Bauhof in Crivitz seit 2022 sogar erhöht oder nur um ca. 3 % gegenüber dem Vorjahr verringert?
Kommentar/Resümee

Der Slogan ‚Miteinander-Füreinander‘ soll die Steuer- und Gebührenerhöhungen für 2024 in Crivitz rechtfertigen, um einen maroden Haushalt und einen angehäuften Schuldenberg bis 2039 zu rechtfertigen.
Zuerst die gute Nachricht: Der Storch ist wieder in Wessin zurück und er hat sogar schon eine Partnerin gefunden und wir alle hoffen auf einen großen Nachwuchs. Dies ist von großer Bedeutung, da er auch eine naturschutzrechtliche Schutzfunktion für den Ortsteil besitzt! Aber das hat man in der Stadt Crivitz schon seit Jahren bei der Planung zu den Windanlagen und den großflächigen Solaranlagen um Wessin herum vergessen.
Überraschend ist, dass die Freiwillige Feuerwehr Wessin 40.000 € mehr an Ausgaben erhält als im Jahr 2022. Sie hat demnach ungefähr 73.000 € für das Jahr 2024 zur Verfügung. Auch für das Kulturhaus in Wessin wurden ca. 29.000 € für 2024 zur Verfügung gestellt; das sind ca. 30 % mehr als im Vorjahr! Lediglich für den Bauhof in Wessin ist kein Geld mehr verfügbar!
Es ist schon erstaunlich, wie hartnäckig man hier mit einem finanzpolitischen Gießkannenprinzip im Wahljahr 2024 agiert, während die Bedürfnisse des größten Ortsteils der Stadt Crivitz im Bauhofbereich ignoriert werden!
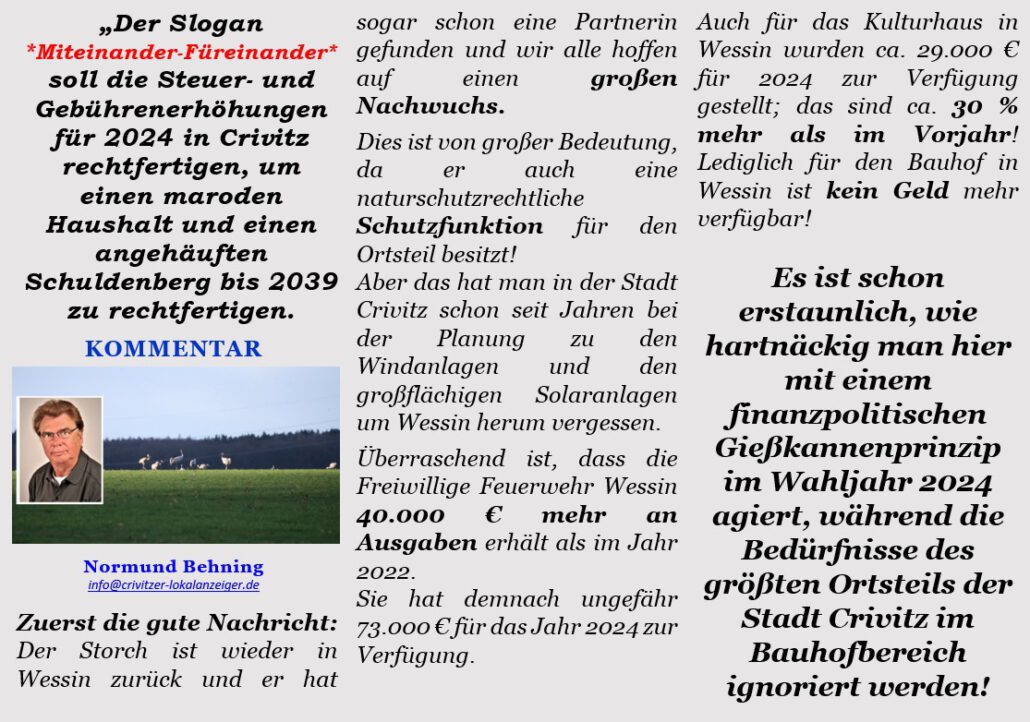
29.März -2024/P-headli.-cont.-red./359[163(38-22)]/CLA-196/34-2024
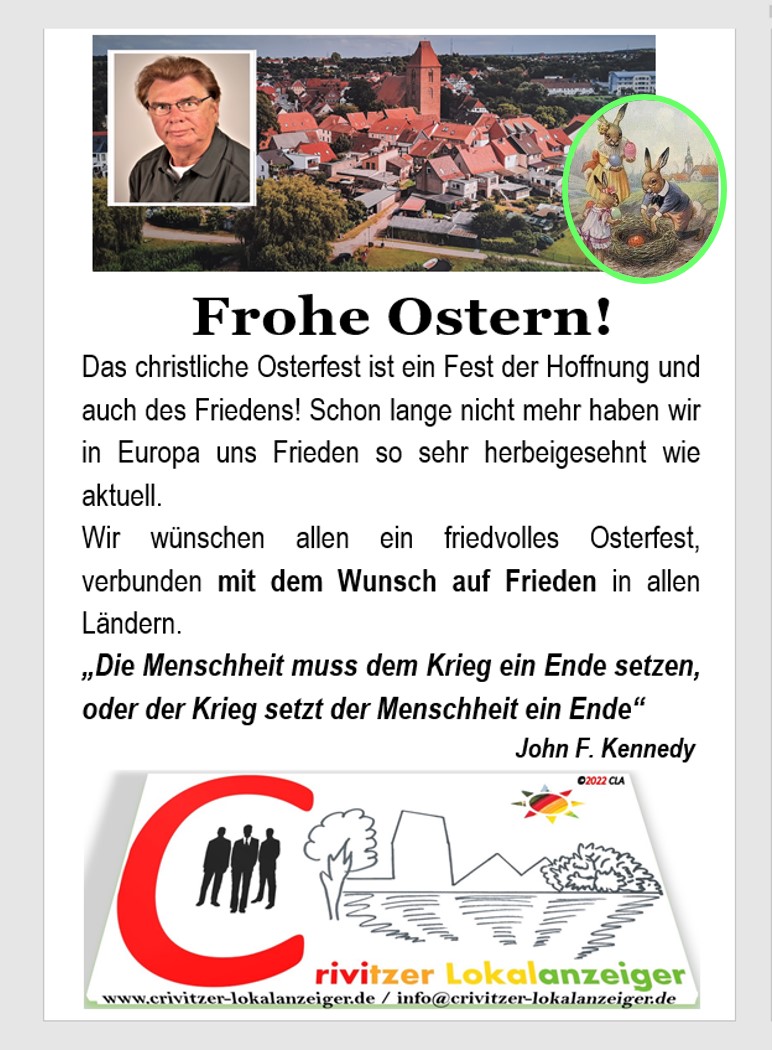
26.März -2024/P-headli.-cont.-red./358[163(38-22)]/CLA-195/33-2024
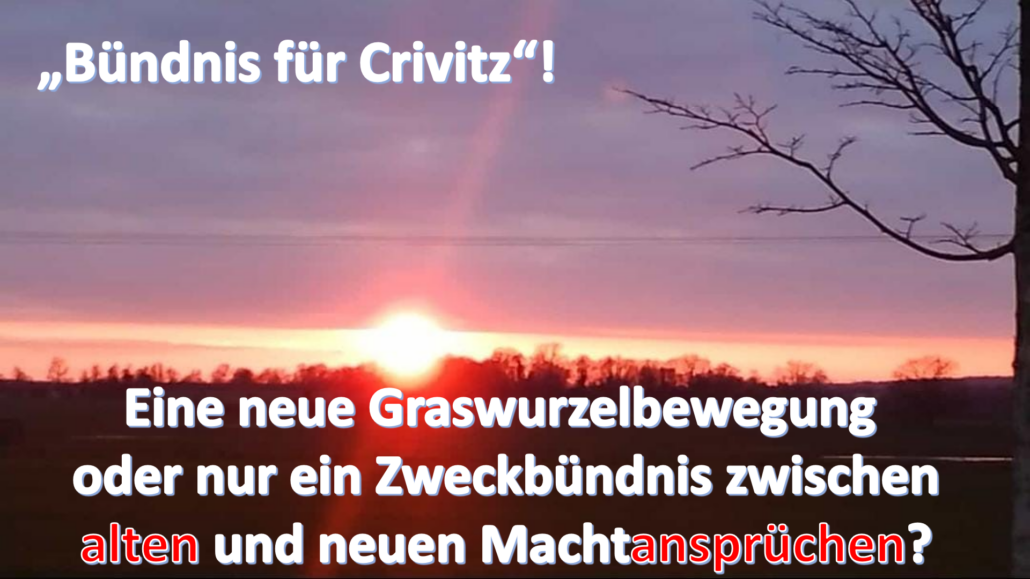
Bislang sieht es so aus, als ob die politische Zweisamkeit seit dem Jahr 2019, bestehend aus Herrn Hans-Jürgen Heine (Einzelbewerber) und Herrn Alexander Gamm (Partei DIE LINKE +Ehemann der Bürgermeisterin Britta Brusch – Gamm), erneut zu einem Jungbrunnen vor dem Wahltermin im Juni 2024 wird!
Der eine ist nun als Fraktionsvorsitzender und Bauausschussleiter für die Partei Die Linke im Stadtparlament Crivitz tätig und verherrlichte Russland, wie es die SVZ beschrieb (SVZ am: 08.04.2022). So schwärmt er aber seit einigen Monaten in Facebook (auch als Paul Hermann unterwegs) vom Bündnis für Sahra Wagenknecht und verhöhnt seinen eigenen linken Parteivorsitzenden in seinen Tweets. Im roten Gewand erscheint er inzwischen auf Fotos als „Mitglied“ des Bündnisses für Crivitz und kandidiert erneut für die Stadtvertretung.
Der andere, Hans-Jürgen Heine, ist als Umweltausschussleiter und zweiter Bürgermeister tätig und initiierte die Wählergruppe „Bündnis für Crivitz“ vor ca. 12 Wochen. So sind die beiden soeben wieder vereint in einem neuen Bündnis und bereit, gegen die etablierten Parteien zu kämpfen. Dies stellt ein erstaunliches Phänomen dar.
Es handelt sich aber hierbei lediglich um eine politische Strategie, die bis zum Juni 2024 umgesetzt werden soll, um als Mehrheitsbeschaffer in einer neuen Zählergemeinschaft mit der Wählergruppe der CWG – Crivitz in der Stadtvertretung tätig zu werden. Das gemeinsame Projekt wird vermutlich in einem fünfjährigen Zweckbündnis enden, welches neue Funktionsträgerposten mit hohen Aufwandsentschädigungen mit sich bringt. Momentan wollen die beiden Akteure jedoch nicht auf ihre bisherigen Funktionsbezüge bis Juni 2024 verzichten, auch wenn sie bereits gemeinsam in einem neuen Bündnis aktiv sind [Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine: Alexander Gamm: ca. 2.940 € (p. a.) / 2.BÜ Hans-Jürgen Heine – Fraktion die LINKE/Heine: ca. 4.220 € (p. a.)]. Dies wird dann als „EHRENAMT“ letztlich angesehen.
Das Wahlprogramm des Bündnisses für Crivitz liest sich wie eine Tagesordnung für den Umweltausschuss und Bauausschuss im alten Format. Man legt einen Schwerpunkt auf das ARBORETUM, den STADTPARK und -WALD sowie den Crivitzer See, was auf den bisherigen Umweltausschussvorsitzenden und Vorsitzenden im Bündnis Hans – Jürgen Heine zurückzuführen ist. So will man ein Gestaltungs- und Eventkonzept für den Marktplatz und eine Verkehrsberuhigung und -führung wohlgemerkt nur im Blick haben! Was soll das konkret heißen? Will man alles nur noch aus der Ferne betrachten, während andere bereit sind, alles zu erledigen? Das Mitglied im Bündnis, Alexander Gamm (bisheriger Bauausschussvorsitzender) hat zu diesen Themen jahrelang nichts unternommen und möchte sich hier neu erfinden.
Das Bündnis ist nicht mehr gegen Wind- und Solaranlagen, sondern lediglich gegen ein Kiesabbaugebiet in Gädebehn. Dies ist schon erstaunlich, obwohl seit 2021 bekannt ist, dass Genehmigungen beim Bergamt in Stralsund hierzu vorliegen, die nicht mehr verhindert werden können, sondern wo man nur noch im anschließenden Hauptbetriebsplan Einschränkungen machen kann. Die Initiativen zum Anfertigen von Naturschutzgutachten von anderen Parteien zur Untersuchung dieses Gebietes im Vorfeld eines Hauptbetriebsplanes, als noch Geld in der Stadtkasse war, wurden am 25. 10.2021 durch die Akteure Herr Alexander Gamm und Herrn Hans Jürgen Heine vehement verhindert.
Der Experte Herr Alexander Gamm wird im Bündnis eine Wärmekonzeption der Stadt Crivitz und eine gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG AG ausloten, um sich hier vermutlich selbst einzubringen. Die wesentlichen Absprachen wurden 2023 bereits getroffen, um eine Karbonisierungsanlage im Gewerbegebiet der Stadt Crivitz als Strom- und Wärmeerzeuger für die Neustadt in Crivitz zu etablieren. Es könnte sich hier lediglich um eine künftige Postensicherung und Auftragsverteilung zwischen verschiedenen Akteuren handeln.
Es ist schon erstaunlich, dass das Bündnis mehr kommunalpolitische Vielfalt und konstruktiven Dialog anstrebt. Wobei jedoch dieselben Akteure im Bündnis für Crivitz, die zurzeit jedenfalls immer noch in kommunaler Verantwortung stehen, sämtliche Protokolle der Sitzungen selbst schreiben und sich als Vorsitzende von Ausschüssen wie eine Allmacht gegenüber den Bürgern aufführen. Man muss einfach nur betrachten, wie die beiden jetzigen Umwelt- und Bauausschussvorsitzenden (Die LINKE/HEINE) in ihren Sitzungen mit den Bürgern in der Vergangenheit umgegangen sind, die eine andere Meinung zu bestimmten Themen hatten.
Bisher jedenfalls ist kein Dialog zustande gekommen, geschweige denn, dass Bürger mit anderen Ansichten sprechen durften; sie wurden allenfalls als dumme Schuljungen in Sitzungen abgestempelt. Ein Raum für den Bürger oder Dialoge wurde in der Vergangenheit nicht gelassen; man wollte eben nur den Bürger anleiten, dirigieren und maßregeln, aber sich keinesfalls in die vorher eigenen festgelegten Regeln sowie Richtlinien hineinreden lassen. Es ist fast eine Farce, was hier im Wahlprogramm zum konstruktiven Dialog vom Bündnis für Crivitz formuliert wurde und man selbst nicht umgesetzt hat.
Das Bündnis beabsichtigt im Wahlprogramm, sich zu bemühen, einzusetzen, auszuloten, fördern, werben, inspirieren und fünfmal zu unterstützen. Allerdings ist es nicht möglich, etwas Konkretes, Fassbares im Programm für eine Umsetzung in der Stadt Crivitz zu finden. Anscheinend handelt es sich hierbei lediglich um Aufzählungen, Umschreibungen und Stabszeichen, mit denen niemand etwas anfangen kann. Man will sich zwar in neuem Gewand präsentieren, jedoch mit den alten unkorrekten Floskeln und Aussagen in Stichpunkten von zahlreichen Visionen begleitet!
Es mangelt im Wahlprogramm an Substanz und klaren Versprechen, die man nicht geben will!
Kommentar/Resümee
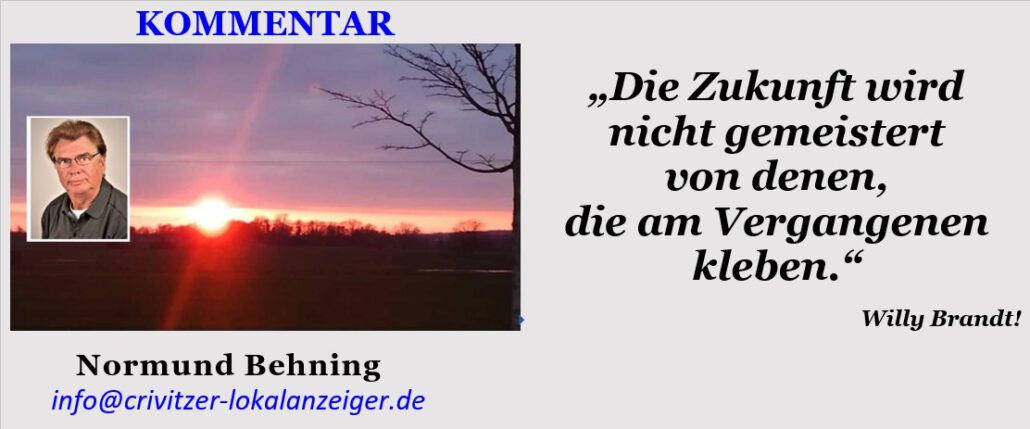
„Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben.“ Willy Brandt!
Jedes Mal, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Wähler nach fünf Jahren zu einer Kommunalwahl zu gewinnen, ist es für manche Protagonisten ein besonderes Schauspiel. Egal, ob man nun aus der Partei DIE LINKE stammte oder aus der SPD oder der FDP und sich dann in die „Schill Partei“ verirrte und dann wieder in der FDP landete. Es ist bemerkenswert, dass diejenigen, die sich im „Bündnis für Crivitz“ zusammengefunden haben, zu 45 % aus Parteien stammen sowie teilweise noch in kommunaler Verantwortung standen und stehen. Dennoch ruft das Bündnis indessen zu mehr Miteinander gegen die alten Parteien auf, obwohl „Sie“ selbst maßgeblich zum finanziellen Desaster im Stadthaushalt der vergangenen Jahre bis 2024 beigetragen haben.
Ein neues Kleid für die Kommunalwahl 2024! Sie haben vor, alles anders zu machen, jedoch ist es Ihnen wichtig, alles im Auge zu behalten. Die gleichen Leute wollen soeben alles ändern, was sie in den vergangenen 10 Jahren als anständig bezahlte Funktionsträger in der Stadtvertretung vernachlässigt und blockiert haben. Das ist eigentlich ein klares Bekenntnis für Schwäche und Unvermögen.
Plötzlich wendet man sich vom einstigen Versagen der Windkraft und Solar ab und strebt stattdessen an, gemeinsam mit einem wirtschaftlichen Partner eine Wärmeversorgung in Crivitz zu gewährleisten. Eine Lobby hat sich in Crivitz wiedergefunden, was sicherlich die WEMAG-Gruppe und den Zweckverband Schweriner Umland sowie den Ortsverbandsvorsitzenden der Grünen Herrn Andreas Katz besonders freuen wird.
Manche Protagonisten können einfach nicht loslassen. Sie setzen ihr ganzes Engagement ein, um die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu erlangen, als eigentlich notwendig. Es geht schlichtweg wieder einmal nur um Posten, Geld und Aufträge.
Ob die Wähler dies tatsächlich auch so interpretieren werden, hängt von den Handlungen der Protagonisten in den vergangenen fünf Jahren ihrer Tätigkeit im Stadtparlament ab!
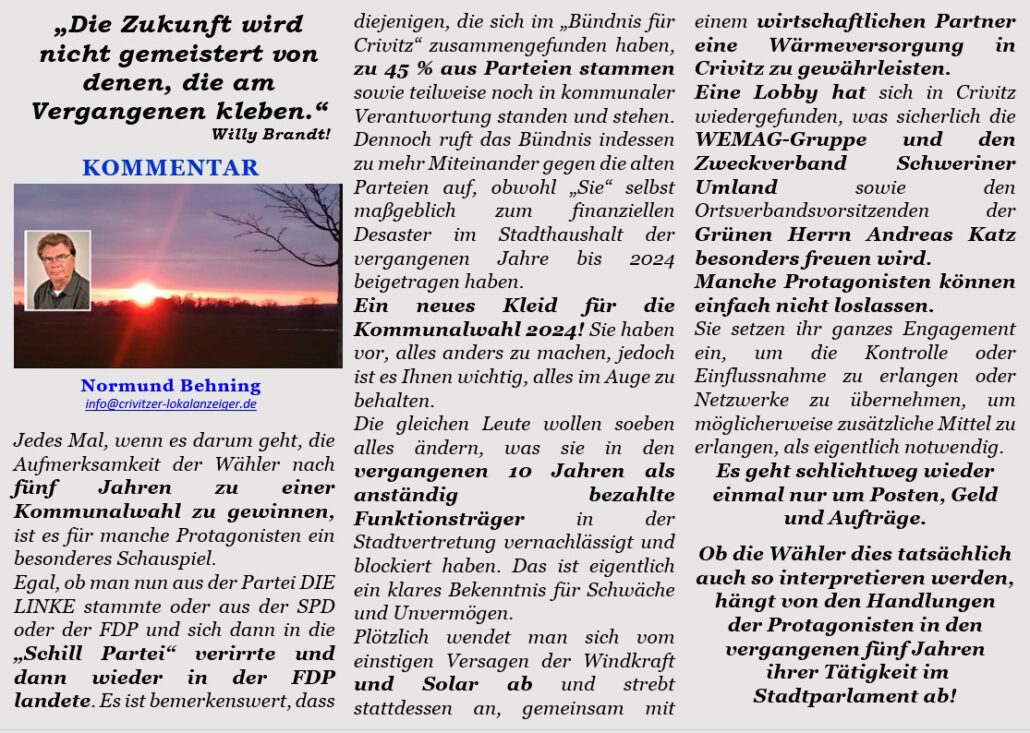
23.März -2024/P-headli.-cont.-red./357[163(38-22)]/CLA-194/32-2024
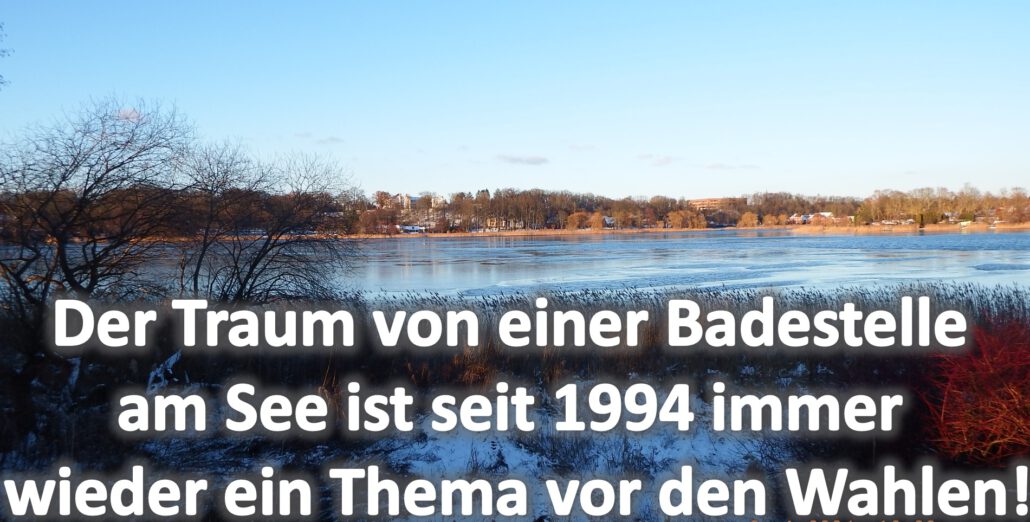
Der Crivitzer See ist ein fast rechteckiger Flachwassersee, der auf dem Gebiet der gleichnamigen Stadt Crivitz im Westen des Landkreises Ludwigslust-Parchim liegt. Eine größere Halbinsel ragt unmittelbar an der Stadt in den See. Bereits sehr früh befand sich auf dieser Halbinsel eine slawische Burg, aus der später die Stadt hervorging. Am Südufer des Sees liegt das Crivitzer Krankenhaus. Im Bereich der Einmündung des Amtsgrabens ist das Westufer bewaldet. Durch seine städtische Lage wird er als Naherholungsgebiet der Einwohner genutzt und kann auf teilweise ausgebauten Wanderwegen komplett umrundet werden.
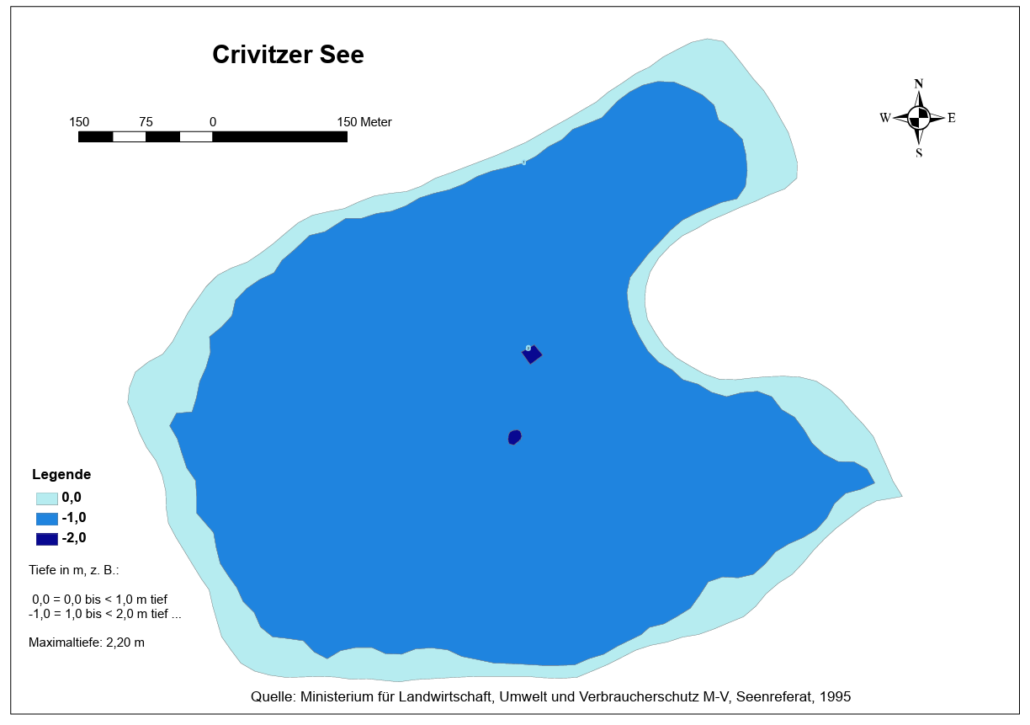
Der See hat eine Länge von 750 m und eine Breite von 500 m. Er hat eine Fläche von 37 ha. Seine maximale Tiefe in der Mitte beträgt 2,0 m und ansonsten 1,0 m. Er entwässert über den Amtsgraben in den Barniner See, weiter über die Warnow in die Ostsee. Anglern zieht es an den See. In dem sich Aal, Blei, Brassen, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Schleie und Zander befinden. Die große Verwirklichung einer Badestelle am Crivitzer See seit 1945!
Unter der Oberfläche des Crivitzer Sees verbirgt sich nicht nur eine deutsche Geschichte, sondern auch die Reste eines sorglosen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen unserer Natur. Von 1928 bis zum Kriegsende befand sich am Crivitzer See eine Badeanstalt am Rosenweg mit Sprungtürmen und Umkleidekabinen. Frau Erika Pump war wahrscheinlich die letzte bekannte Bademeisterin, die im Jahr 1939 eingestellt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Badeanstalt nicht mehr weitergeführt, jedoch wurde ein gewisser Zeitraum weiterhin „wild“ gebadet.
Zeitzeugen berichteten, dass im Crivitzer See Waffen, Sprengkörper und sogar ganze Fahrzeuge sowie kleine Panzer kurz vor dem Einmarsch der Russen durch flüchtende deutsche Stoßtrupps und Verbände versenkt wurden. Sie flüchteten von der Gruppe Wellmann nach Schwerin, um zur damaligen Demarkationslinie der Amerikaner zu gelangen. Selbst eine sehr schwere Explosion von Munitionsbeständen, die am 26.05.1945 gegenüber dem heutigen „Haus Seeblick“ stattfand, führte zu einer Beeinträchtigung im Ufernahbereich.
Die über 40 Jahre andauernden ungeklärten Abwässer aus privaten Haushalten und Betrieben in den Crivitzer See haben das Ökosystem erheblich beeinträchtigt und zahlreiche Lebensgrundlagen für Flora und Fauna zerstört. Erst nach der Wende erlangte das Thema Umwelt- und Wasserqualität einen neuen Stellenwert. Obwohl die meisten Haushalte und Betriebe heutzutage an eine zentrale Abwasseranlage angeschlossen wurden, tauchen immer noch Rohre auf, wie im letzten Monat, wo man zudem rätselte, woher diese Einleitung kam.
Seit 1994 wurde immer wieder darüber diskutiert, wie man den Crivitzer See erneut renaturieren könnte. Das führte dazu, dass im April 2008 ein Entwurf und Angebot in der Stadtvertretung diskutiert wurden, um einerseits den See mittels Einlagerungen voneinander getrennter Quarzbehälter zu behandeln für ca. 350.000 € oder andererseits die klassische Ausbaggerung, die das Doppelte kostete. Beides wurde abgelehnt und verschoben, weil die Stadt für diese Mittel keine ausreichende Liquidität hatte, um das Projekt zu finanzieren.
Nun haben der Global Nature Fund und das Netzwerk lebendige Seen Deutschland (NLSD) den Crivitzer See zum „Lebendigen See des Jahres 2024“gekürt. Der BUND, der Partner in diesem Netzwerk, ist gerade in Schwerin aus seinem langen Winterschlaf mit einer plötzlichen Begeisterung für die Crivitzer Region erwacht und möchte einen Verein gründen, gemeinsam mit dem Bündnis für Crivitz („ZU NEUEN UFERN“) und Initiativen starten. Natürlich muss zunächst Geld einsammeln durch ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt. Das letzte Crowdfunding-Projekt in Crivitz war vom November 2019 bis Anfang Februar 2020 zum sogenannten Volkshaus und hat seine eigene tragische Geschichte.
Kommentar/Resümee
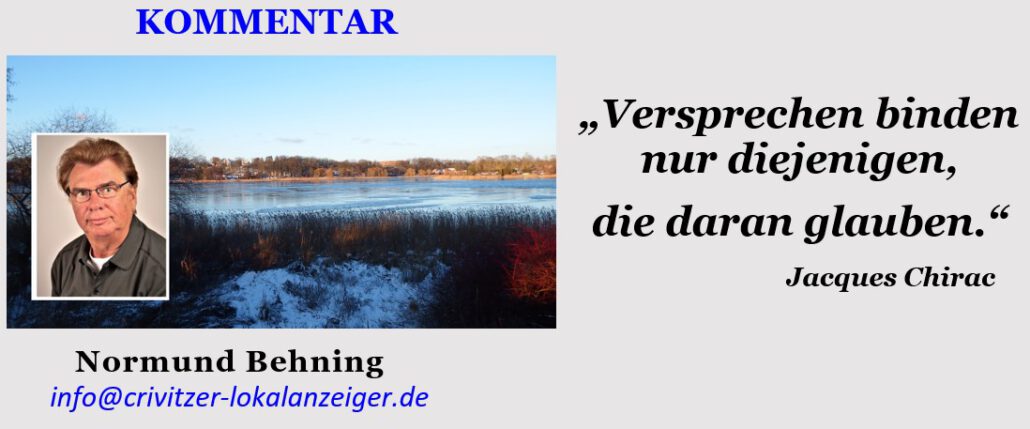
„Versprechen binden nur diejenigen, die daran glauben.“ Jacques Chirac
Seit etwa ca. 25 Jahren wird das Thema Renaturierung des Crivitzer Sees immer wieder thematisiert. Jedes fünfte Jahr taucht das Thema „Renaturierung des Crivitzer Sees“ plötzlich an der Oberfläche auf, so kurz vor den Kommunalwahlen. Zunächst in der CDU – Fraktion Crivitz und Umland, sowie in der SPD-Fraktion, dann in der Wählergruppe der CWG – Crivitz und nun im Jahr 2024 in der Wählergruppe Bündnis für Crivitz. Und auch 2029 wird es erneut ein Thema sein. Es steht Ihnen frei, diese Wette zu platzieren!
Der Zeitrhythmus vor den Wahlen ist nahezu identisch mit dem Thema Südbahn im Landkreis LUP. Es ist ebenso möglich, die Uhr danach auszurichten, wo der CDU-Vorsitzende in LUP Wolfgang Waldmüller dieses Thema plötzlich vor den Wahlen immer wieder hervorkramt.
Es klingt alles so, als ob wieder einmal große mediale Ankündigungen gemacht wurden und einzelne Personen auf großen Bühnen auftreten werden. Dabei mangelt es weiterhin an aussagefähigen Gutachten, weitreichenden Konzepten für die gesamte Region und tragfähigen Finanzierungslösungen.
Als ob sich die Geschichte wiederholen würde, hat die Stadt Crivitz durch exorbitante Ausgaben und Abbau von Rücklagen in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass ihre Liquidität in den nächsten Jahren bis 2027 noch mehr verloren geht. Sie kann für die Zukunft nur noch Hoffnungen in das Universum senden, aber keine finanziellen Beiträge leisten, um Lösungen für dieses Projekt zu finden. Sie ist vielmehr ein Beobachter auf den Rängen der Bürger. Hier wird auf den Bürger und auf finanzielle Mittel des Landes MV zurückgegriffen, um voranzukommen, was sicherlich bis zur nächsten Wahlperiode 2029 dauern wird.
Das Schicksal hat sich wiederholt!
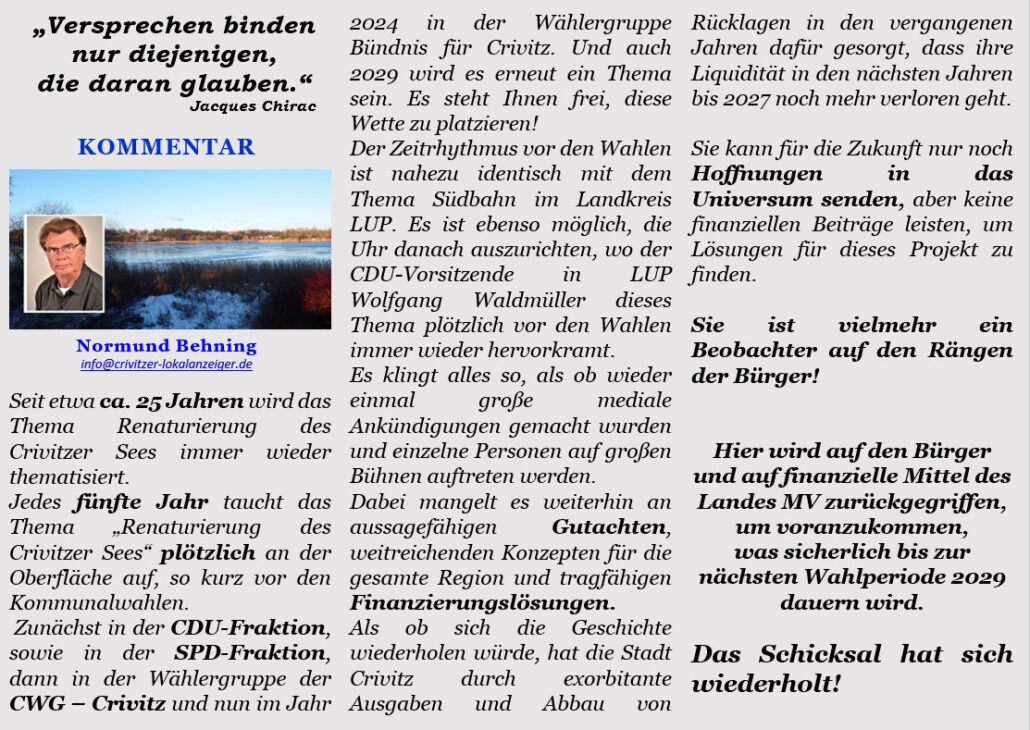
20.März -2024/P-headli.-cont.-red./356[163(38-22)]/CLA-193/31-2024

Sind Sie verschwunden oder wurden sie für den Wahlkampf 2024 vorgesehen?
LEADER ist die Abkürzung von Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale (frz. für Vernetzung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Ein Maßnahmenprogramm der EU für, mit dem die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum gefördert werden soll!
Die Leader-Projekte wurden großartig prognostiziert und in den Medien vermarktet im Sommer 2022 vom Umweltausschuss Crivitz, sind aber seitdem im Dunkeln verschwunden! Auch 2024 werden keine Projekte aus Crivitz in die Leader-Förderung aufgenommen, sondern erst für 2025, wenn sie bis zum 30.06.2024 eingereicht werden.
Welche Projekte wurden ausgewählt und eingereicht, um die Förderung durch das Leader-Programm erhalten zu können?
Die Projekte sollten einen Mehrwert für die Region oder den Standort bieten und eine Art von Modellcharakter aufweisen, gewissermaßen ein besonderes Merkmal. Für die kommende Förderperiode bis 2027 wird eine regionale Entwicklungsstrategie entwickelt, um lokale Entwicklung zu fördern.
Die Tagesordnungspunkte – Leader Projekte oder die Feststellung einer Projektauswahl im Umweltausschuss Crivitz sind bis heute nicht veröffentlicht worden. Unter dem Motto Drei Themen für Crivitz-LEADER AG („MEINE IDEE“ Schreiben vom 27.6.2022) veröffentlichte der Vorsitzende des Umweltausschusses Hans-Jürgen Heine Fraktion die LINKE/ HEINE das Papier nach der letzten Sitzung am 22. Juli 2022. Bis dato gab es keine weiteren öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Thema oder nur noch versteckte. Es wurden keine Mitteilungen veröffentlicht, weder in gedruckter Form noch im Internet. Die Transparenz in diesem Ausschuss ist bemerkenswert.
Obwohl dieses Thema eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Kulturausschusses fällt, hat sich dieser hauptsächlich mit Kinderspielplätzen beschäftigt und der Umweltausschuss hatte sein Lieblingsthema Stadtpark und Arboretum sowie die Baumschau auf der Tagesordnung gehabt. Unsere Redaktion hat sich direkt bei dem Regionalmanagement in der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH erkundigt und erhielt eine freundliche und schnelle Antwort.
Das Projekt „Grünes KLASSENZIMMER“ von Crivitz wurde für 2023 und 2024 als GAK-Kleinprojekt neben zahlreichen anderen Projekten nicht ausgewählt. Der sogenannte Favorit aus Crivitz, ein Unterrichtsraum (Pavillon) für Lehre und Bildung im grünen Klassenzimmer des Schulgartens der regionalen Schule, wurde nicht gewählt. So besteht auch noch Unklarheit darüber, was unter einem Unterrichtsraum (Größe/Bauweise/Material) im grünen Klassenzimmer zu verstehen ist. Eine genaue Beschreibung dieser Angelegenheit existiert nicht, zumindest nicht öffentlich. Ein Kostenvoranschlag hierzu fehlt auch!
Nun stellt sich lediglich die Frage, was aus den anderen Projekten geworden ist.
Der Skaterpark ist schon seit Längerem im Gespräch, unter anderem auch von der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm. Es wurde bereits eine Beratung im Kulturausschuss durchgeführt, bei der auch Jugendliche eingeladen wurden. Zu diesem Thema stellte man fest. „Es wird sich zunächst auf den Standort zwischen der alten ‚Schwesig Halle‘ und der Bahnstrecke geeinigt. Preislich liegt das Projekt bei ca. 50.000,00 €. Es werden die verschiedenen Materialien besprochen. Es entsteht ein reger Austausch.“ (Kulturausschuss, 12. April 2022, TOP 5). Jedoch, angesichts der veranschlagten Baukosten, wäre es bedauerlicherweise nicht mehr möglich, das Projekt als Kleinprojekt nach LEADER zu fördern! Man kann das nur noch als großes Projekt planen und einreichen. Im Haushalt 2024 ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen, jedoch nur für die Planung des Skaterparks. Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Crivitz ist ein Bau in Eigenregie nicht möglich. Ohne Förderung ist dies nicht möglich.
Zum Marktplatz gab es viele Ideen (vom Springbrunnen bis zum Parkplatz) und auch einen sogenannten Arbeitskreis? Den Marktplatz behindertengerecht umzugestalten, ist schon lange eine Notwendigkeit. Aufgrund der hier verwendeten Begriffe und Beschreibungen, sowie der Erweiterung der Parkplätze, dürfte auch hier die veranschlagte max. Förderung von 20.000,00 € sicherlich nicht ausreichen! Die Kosten für die behindertengerechte Umgestaltung des Marktplatzes der Stadt Crivitz waren jedoch so hoch, dass sie nicht als Kleinprojekte beim GAK eingereicht wurden. Es existieren keine Informationen, außer dass man beabsichtigte, im Jahr 2023 einen Planer zu beauftragen, was jedoch bis heute nicht gelang.
Alles liegt wie gewöhnlich auf Eis oder erwacht neu bei den Parteien oder Bündnissen zu neuen Leben im Wahlkampf!
Kommentar/ Resümee
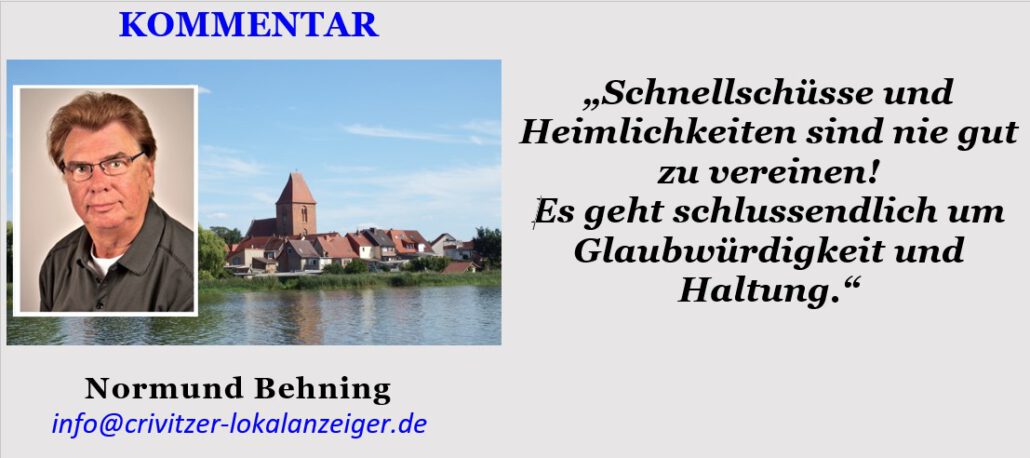
Ein Versprechen weckt Erwartungen. Und wenn ein Versprechen nicht eingehalten wird, dann macht sich große Enttäuschung breit. So ist es nicht nur in der Kommunalpolitik. Transparenz und klare Worte. Und damit Verbindlichkeit. Doch viel zu oft hält man sich nicht an Zusagen.
Es ist schon erstaunlich, dass im Jahr 2024 ein grünes Klassenzimmer der Schule Banzkow, eine Erweiterung der Kleinstbrauerei in Gädebehn der Albers Brauerei und ein Pumptrack mit Unterstand + Graffitiwand der Stadt Sternberg gefördert und errichtet werden.
Die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen erfordert eine transparente Informationspolitik für die Gesamtheit der politischen Entscheidungen auf der Ebene der kommunalen Gremien. Es handelt sich nicht um Einzelentscheidungen. Die Bürger bleiben im Unklaren, werden vertröstet, können sich auf vorab gemachte Zusagen nicht verlassen.
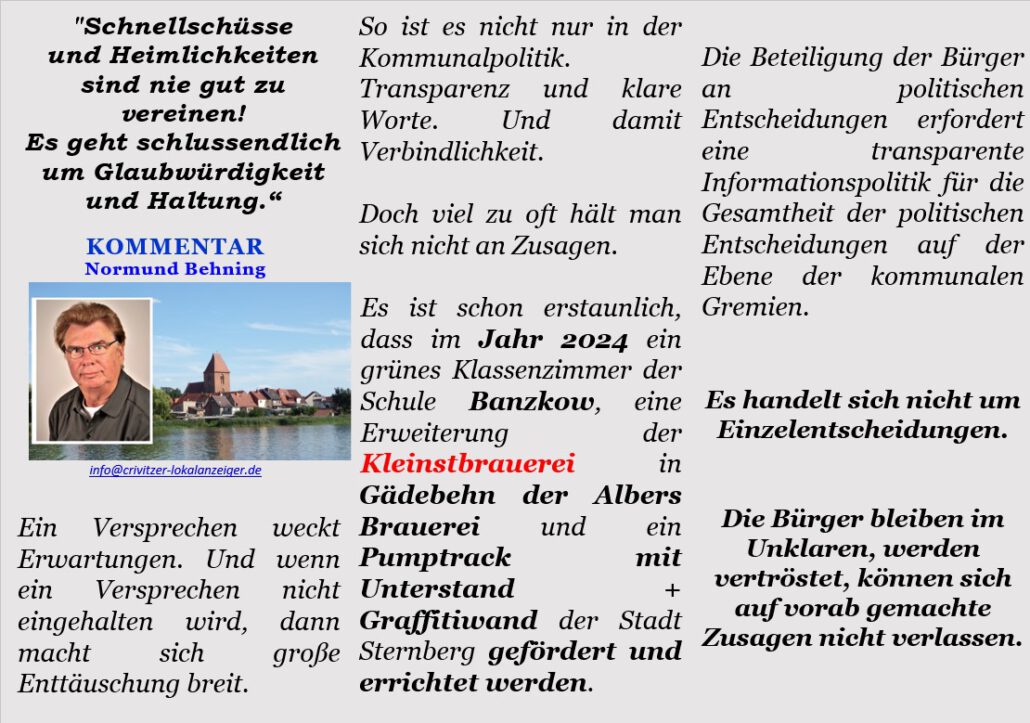
17.März -2024/P-headli.-cont.-red./355[163(38-22)]/CLA-192/30-2024
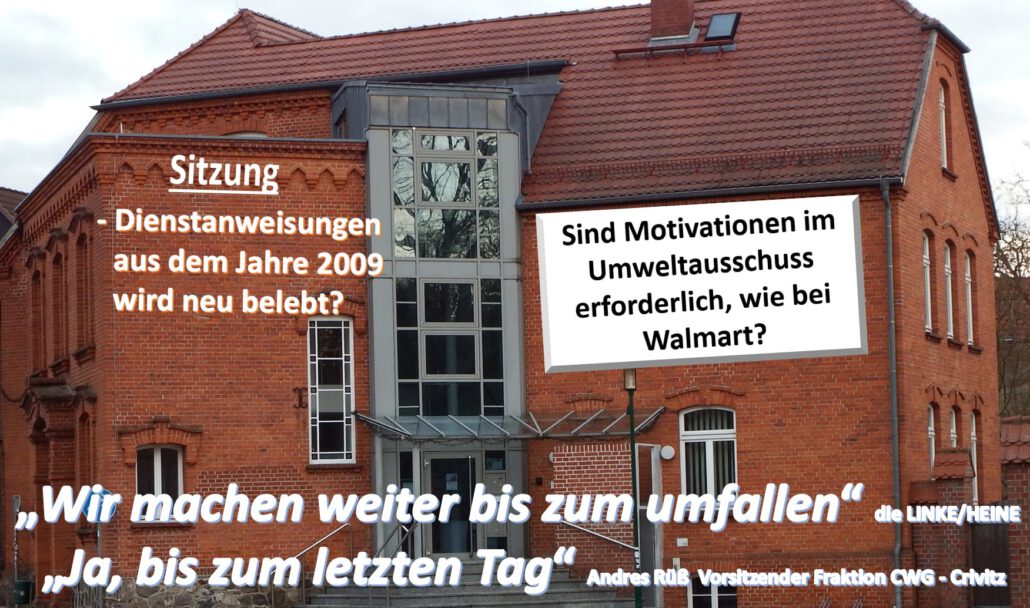
Man weiß nicht, was man zuerst tun soll, so wenig Zeit bleibt noch zur Wahl! So lautete der Grundgedanke für die letzten beiden Umweltausschusssitzungen.
Es war schon beeindruckend, welche umfangreichen Motivationsappelle in den letzten Sitzungen des Ausschusses vor der Kommunalwahl ausgesprochen wurden. So wurden vorsorglich schon einmal die Umweltausschusssitzungen bis zum 17.12.2024 bereits fest geplant, sodass man sofort 9 Tage nach der Wahl sofort wieder beginnen kann. Im Hinblick auf das Wählerverhalten der Bürger vor der Kommunalwahl in Crivitz ist der Umweltausschuss sicher und überzeugt, dass man im Juni bereits in alter Besetzung und bewährter Tradition fortfahren wird. Natürlich wird man dies in den Protokollen nicht finden, da der Ausschussvorsitzende Herr Hans-Jürgen Heine die Protokolle selbst verfasst und solche Statements in gewohnter Weise gerne etwas überspringt. Jedoch ist die Terminplanung bereits verfügbar und wurde veröffentlicht.
Mache Protagonisten können einfach nicht loslassen. Sie setzen ihr ganzes Engagement ein, um die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu erlangen als eigentlich notwendig. Es geht schlichtweg wieder einmal nur um Posten, Geld und Aufträge.
Es wurde zunächst vereinbart, dass die Baumschau für das Jahr 2024 vorbereitet wird, wobei erhebliche Kosten entstehen und weil der Vorsitzende des Umweltausschusses selbst Baumbeauftragter des Amtes Crivitz ist, war dies eigentlich nur eine Selbstmitteilung für das offizielle Protokoll.
Anschließend forderte der Vorsitzende, Herr Hans-Jürgen Heine, die Einhaltung eines Leitfadens des Umweltausschusses. Dies stellte eine kuriose Situation dar und die Gestik der Abgeordneten dazu war ebenfalls betroffen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine interne Anweisung des Umweltausschusses aus dem Jahr 2009 handelte, von der jedoch niemand der anwesenden Mitglieder des Umweltausschusses seit 5 Jahren je etwas gehört hatte. Diese angebliche interne VERORDNUNG des Umweltausschusses sieht vor, dass die Verkehrssicherheit von Bäumen und Sträuchern entlang von Straßen, Wegen und Plätzen genau überwacht werden sollte. So gab es im Rahmen des Kommunalschadenausgleichs Vorfälle in der Stadt, die Kontrollen zur Sicherung der Verkehrssicherheit in der Stadt erforderlich machten. Hinzu kommen noch die Kontrolle des Wildwuchses von Sträuchern, die Straßenreinigungssatzung, die Friedhofssatzung, die Renaturierung der Warnow und die Stadtparkordnung. Es ist schon erstaunlich, was plötzlich 10 Wochen vor der Wahl alles so an Verordnungen noch entdeckt wird. Es mag sein, dass das bereits im Bündnis für Crivitz diskutiert wurde, doch die Abgeordneten im Ausschuss wussten darüber nichts. Die Lektüre steht Ihnen nun noch vor der Wahl erstmals zur Verfügung.
Es folgte die Bekanntgabe des Bestrebens einer neuen Mitgliedschaft der Stadt Crivitz in einem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, dass die Anwesenden ebenfalls überraschte, weil sie davon auch nichts wussten. Diese Mitgliedschaft kostet 185 € und sollte spätestens auf der kommenden Stadtvertretersitzung vor der Wahl beschlossen werden. Das Bündnis ermöglicht, sich als Kommune zu profilieren und positiv auf sich und Ihre Maßnahmen aufmerksam zu machen sowie darzustellen. Es stellt eine Plattform für eine interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation dar, bietet Kontakte und Ansprechpartner für den kommunalen Naturschutz. In Online-Workshops und der jährlichen Jahresversammlung werden die Mitglieder in aktuellen Fachthemen geschult. Allerdings hat der Vorsitzende Hans-Jürgen Heine bereits in der Vorlage für das Protokoll dieser Sitzung den Beschluss gefasst, dass der Ausschuss dieser Mitgliedschaft zustimmt und der Stadtvertretung dort empfiehlt, sich zu beteiligen. So einfach und so schnell geht das eben im Umweltausschuss, wenn man die Protokolle als Vorsitzender selbst schreibt. Wieder einmal dient eine Mitgliedschaft zur Profilierung einzelner.
Kommentar/Resümee
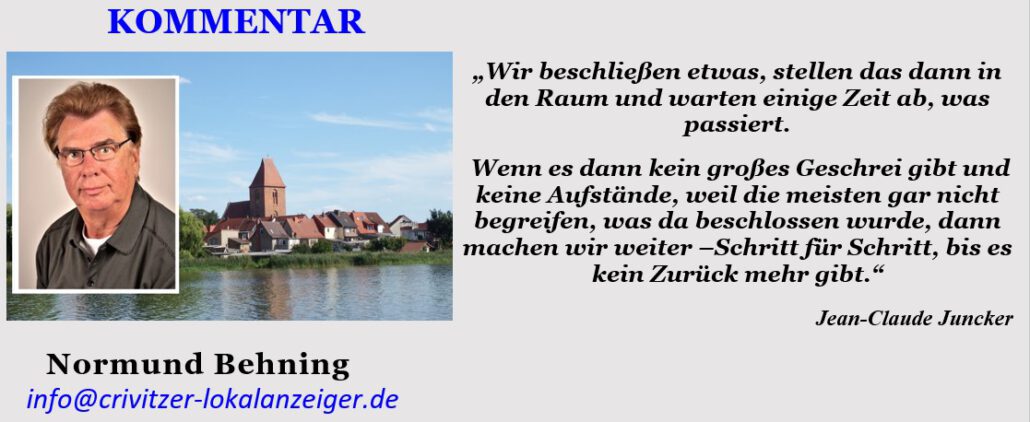
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
Es sollten eigentlich nur drei Hauptthemen für das Jahr 2024 gelten, wie es auf der Sitzung des Umweltausschusses im Januar 2024 bekannt wurde. Die Themen lauten: 1. Der Stadtpark, 2. Das Arboretum und 3. Die Umweltpreise und 4. Der Aufbau einer Karbonisierungsanlage im Gewerbegebiet Crivitz.
So stellt es aber eine Herausforderung dar, die Mitgliedschaft im Verein AGFK MV, das heißt „Arbeitsgemeinschaft für Fahrrad – und fußgängerfreundliche Kommunen in MV“, zu besetzen, was der Umweltchef Herr Hans – Jürgen Heine selbstverständlich übernimmt. Nun kommt die nächste Mitgliedschaft im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ hinzu. „Wer sich profilieren will, gesteht, dass er noch kein richtiges Profil hat“. Walter Ludin
Öffentliche Vorberatungen scheinen nicht mehr so in Mode zu sein im Umweltausschuss, zumindest nicht ca. 11 Wochen vor der Kommunalwahl. Alles muss wieder rasant gehen. Es ist schon erstaunlich, dass der Umweltausschuss seit einiger Zeit wieder einmal eigenmächtig über dieses Thema diskutiert und die Ortsteilvertretungen hierzu nicht in Betracht zieht.
Wie auch beim „Grünen Band“ in Crivitz, es wurde zwar nicht gefördert, aber es wurde schließlich schnell beschlossen. Jetzt sollen die Wanderwege auf einer großen Übersichtstafel gezeigt werden. Außerdem sollen Flyer gedruckt werden. Für diesen Zweck möchte man etwa 7000 € ausgeben und eine Arbeitsgemeinschaft bilden, die die Aufgaben übernimmt. Ebenso möchte man bei den Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Umweltschutz der Stadt Crivitz sparen und die Firmen bitten, diese Preise zu sponsern, um den Haushalt der Stadt Crivitz nicht unnötig doll zu belasten.
Man kann nur hoffen, dass die Bürger spätestens im Juni 2024 in Crivitz bei der Abgabe ihrer Stimme erkennen, dass man eine Vielzahl von politischen Parteien und Initiativen auswählen sollte. Die sich mit diesem Thema umfassend und in einer größeren Anzahl als bisher auseinandersetzen sollten. Natürlich sollte das Ganze gemeinsam geschehen.
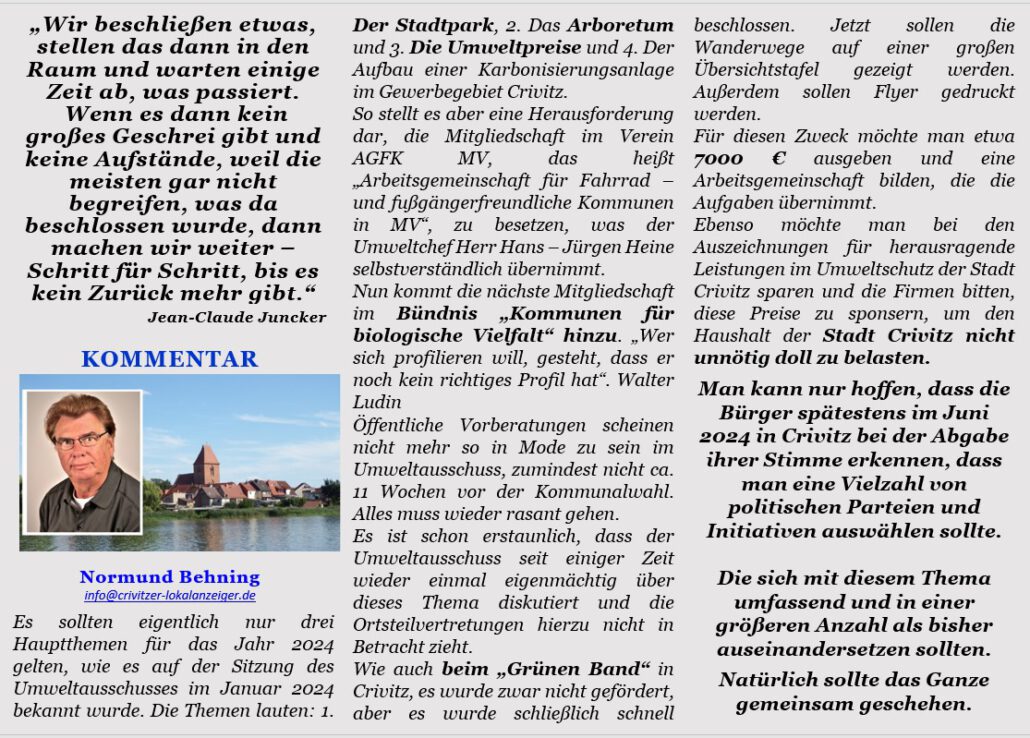
13.März -2024/P-headli.-cont.-red./354[163(38-22)]/CLA-191/29-2024
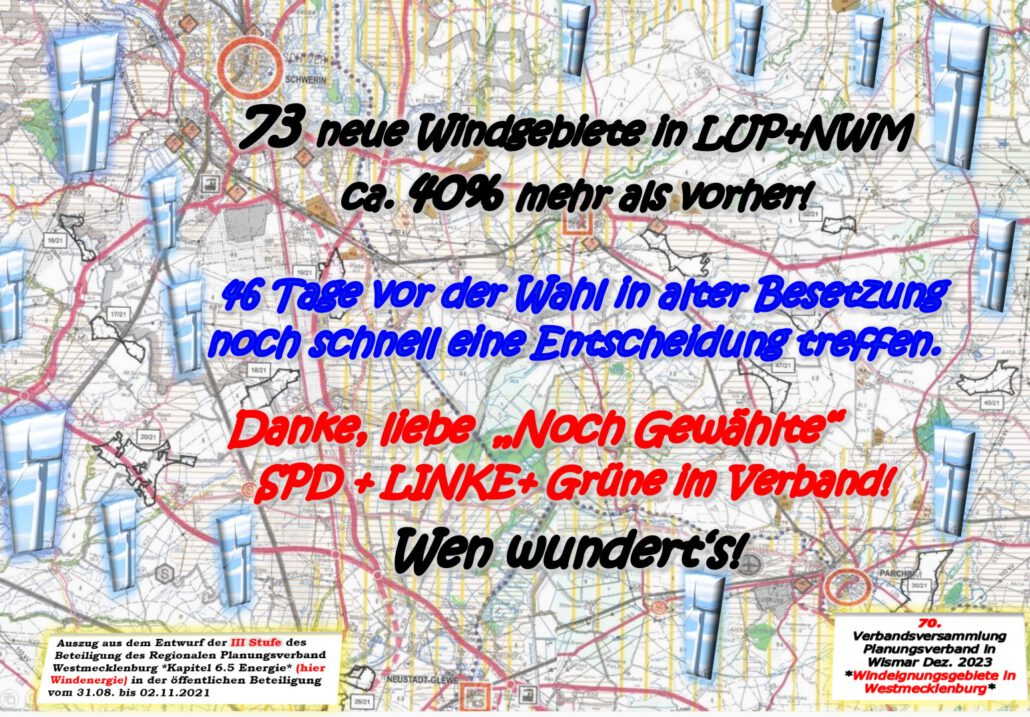
Die Schwierigkeiten im regionalen Planungsverband Westmecklenburg beim Thema Windenergie sind hausgemacht.
Das ganze Hin und Her geht schon seit 2014 und nun steht der Verband vor einem Scherbenhaufen seines eigenen Handelns! Damals hatten der ehemalige Vorsitzende des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Herr Rolf Christiansen und sein Stellv. Thomas Beyer (SPD-Fraktion) einen Beschluss im Verband mit herbeigeführt, ein ganz bestimmtes Windeignungsgebiet zu streichen. Gegen diese Herangehensweise wurde erfolgreich geklagt wegen eklatanter verwaltungsrechtlicher Fehler und seitdem wird an diesem Plan herumgebastelt, mit fatalen rechtlichen Folgen. Der Plan hat bis heute keine Rechtskraft oder eine vergleichbare Zielsetzung.
Eine überarbeitete Planung bis 2027, die sowohl neue Flächen als auch aufgeweichte Artenschutzkriterien und ein neues Kriterium berücksichtigt, soll soeben endlich die Rettung bringen. Selbstverständlich muss alles noch vor der Wahl am 24.04.2024 in der alten Akteursbesetzung stattfinden und gleichzeitig beschlossen werden. Damit nach der Wahl keine weiteren Veränderungen oder Einflüsse mehr den Plan beeinflussen können.
So wurde bereits auf der Sitzung im Dezember 2023 in Wismar beschlossen, dass die Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie (Windenergie) vom 31.08.2021 bis zum 02.11.2021 abgeschlossen ist. Die verschiedenen Gesetzesänderungen, insbesondere des Naturschutzgesetzes, sowie veränderte artenschutzrechtliche Bestimmungen waren hierfür die Grundlage. Was für eine Erleichterung, denn jetzt ist es möglich, anstelle der vorher 52 Windeignungsgebieten auch die Potenzialflächen zu berücksichtigen und somit 73 neue Windeignungsflächen zu generieren. Da die Ausweisung von mindestens 2,1 % der Regionsfläche bis zum Ende des Jahres 2027 erfolgen muss.
Das können auch die Fraktionsvorsitzenden Christian Geier, der CDU-Fraktion und Heiko Böhringer Freier Horizont/FREIE WÄHLER nicht mehr ändern, die mit einem erneuten gemeinsamen Schaufensterantrag im Kreistag LUP am 14.03.2024 etwas anderes bewirken wollen. Sie fordern den Landrat von LUP auf, einen Antrag in der kommenden Vorstandssitzung + Verbandsversammlung einzureichen, der mindestens 1,4, höchstens jedoch 1,5 % der Regionsfläche umfassen sollte. Es ist unverständlich, warum der Landrat diesen Antrag einbringen soll, obwohl selbst Herr Heiko Böhringer + Nico Skiba und Dirk Flörke (beide CD-Fraktion) im Vorstand des Planungsverbandes vertreten sind. Ein sinnloses Unterfangen und dient eigentlich nur der persönlichen Profilierung und dem Wahlkampfgetöse. Bereits in den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass es bei ähnlichen Anträgen der beiden Akteure keine Zuständigkeit im Kreistag gibt.
Seit dem Kreisparteitag der CDU in Neustadt-Glewe, wo sich auch das Erdwärmeheizwerk befindet, hat sie plötzlich übergroße KRAFT-Anwandlungen und präsentiert sich angeblich geerdet und realitätsnah gegenüber dem Bürger. Angeblich kann man alles besser! Fragt sich einerseits nur was und andererseits ob mit oder ohne die Brille eines massiven Machtanspruches? Plötzlich rückt das Thema Windkraft wieder in den Vordergrund, und so ist die CDU-Kreistagsfraktion gegen einen zügellosen Ausbau der Windenergie in LUP, obwohl man zuvor schon in einer Regierungsverantwortung ganz anders agierte und argumentieren musste. Eigentlich fehlt nur noch das Thema „Südbahn“. Das Lieblingsthema des CDU-Kreisvorsitzenden Wolfgang Waldmüller, das speziell bei Landtags- und Kreistagswahlen hoch im Kurs steht und seit zehn Jahren immer wieder hervorgekramt wird.
Überraschend ist, dass auch im Vorstand des Planungsverbandes Frau Iris Brincker (Fraktion DIE LINKE) vertreten ist und den Landkreis Nordwestmecklenburg vertritt. Sie ist auch Amtsvorsteherin im Amt Crivitz im Landkreis LUP. Einerseits ist die bewährte Regel, Amt und Mandat zu meiden, hier verschwommen dargestellt. Es stellt sich jedoch die entscheidende Frage, welche Interessen sie nun konkret vertritt; sind es nun die Angelegenheiten des Landkreises LUP oder Nordwestmecklenburg?
Die WEMAG – AG hatte in der letzten Sitzung des Planungsverbandes eine neue Sternstunde. Sie durfte sogar einen Vortrag über die Netzintegration halten. Das neue Schlüsselwort im Planungsverband lautet jetzt „Netzintegrationsfähigkeit“. Es wurde eigens ein neues Kriterium für die Abwägung geschaffen, ob bereits eine geeignete Stromnetzinfrastruktur im Windparkgebiet vorhanden ist oder nicht, um das Windeignungsgebiet gesamtsystemisch effizient mit der geeigneten Stromnetzinfrastruktur zu erschließen.
Das bedeutet, wo bereits Netzverknüpfungspunkte existieren (früher Umspannwerk) oder Leitungen vorhanden sind, sollen verstärkt Solar- und Windeignungsgebiete ausgewiesen und geplant werden. Dies betrifft insbesondere Görries (Schwerin – Süd), Parchim – Süd, den Ortsteil Wessin (Stadt Crivitz) und das Umland. Es geht primär darum, neue Kapazitäten für die Integration der neuen Windenergieanlagen in das Netz zu erschließen, wobei es nicht um die Synchronität von Erzeugung und Verbrauch geht. Daher ist das Urteil bereits für diese Gemeinden an Netzverknüpfungspunkten (Umspannwerken) ergangen, was bedeutet, dass sie sämtliche Solar- und Windenergieanlagen verstärkt erhalten werden.
Das Ganze soll nun zügig am 24.04.2024 beschlossen werden, da (noch) die Mehrheit der Mitglieder des Oberzentrums Schwerin und des Mittelzentrums Wismar sowie der Fraktion DIE LINKE+ Grüne+ SPD aus den Landkreisen LUP +NWM diese Vorgehensweise in der Planung begrüßen dürften!
Kommentar/ Resümee
„Denn sie wissen nicht, was sie tun“!
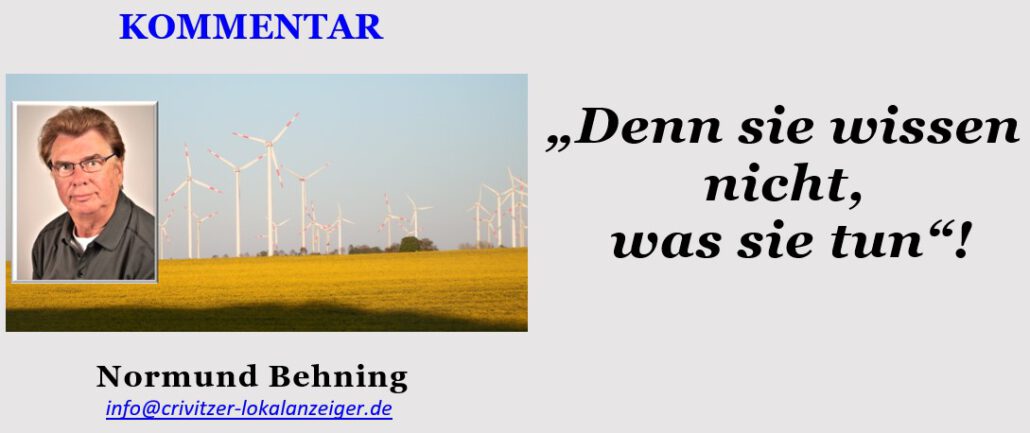
Die Berliner Ampel entpuppt sich immer mehr zu einer Regierung, die sich nicht darum kümmert, was die Menschen im Land wirklich wollen und benötigen. Sie bedient die Interessen einzelner Lobbygruppen, verändert und modifiziert Gesetze nach Gutsherrenart und beeinträchtigt dadurch das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Inzwischen haben wir uns Habecks Landschafts-Verspargelungsgesetz genauer angesehen. Es wäre möglich, es als Naturvernichtungsgesetz zu bezeichnen.
Allein die „Zuwegung“ zu einem Windrad erfordert eine „bis zu 5 m“ mit „Schotter befestigte Zuwegung“. Heißt: eine Straße durch den Wald oder die Landschaft. Bei einem Windpark heißt das, der halbe Wald ist weg. Kleintiere und Vegetation auch. Dies ist jedoch nach dem neuen Gesetz nicht von Bedeutung. Der grüne Minister hat entschieden: Die Natur hat sich dem Menschen unterzuordnen.
Wer wissen möchte, wie das Deutschland der Zukunft ausschaut, braucht nur einmal die B 392 nach Kladrum und weiter die K 116 weiter nach Gebbin zu fahren. Da war man sehr fleißig mit Windrädern. Eine ganze Region, ein ganzes Naherholungsgebiet, eine ganze Naturlandschaft: für immer vernichtet. Dem Tier, dem Menschen und der touristischen Nutzbarkeit entzogen.
Und machen wir uns nichts vor: Was einmal kaputt ist, bleibt beschädigt. Gewiss. Wir benötigen Energie.
Sehr sehr viel Energie. Aber noch gibt es „Zwischenlösungen“ und der Weg Richtung Wasserstoff und Kernfusion ist sichtbar. Müssen wir also wirklich das kleine Deutschland kaputtspargeln, mit Energieerzeugern, deren Effizienz bei gerade einmal 25 % liegt?
Diese Frage sei erlaubt. Auch wenn es jetzt wohl bei der einen oder dem anderen
rote oder grüne Flecken auf dem Gesicht gibt!
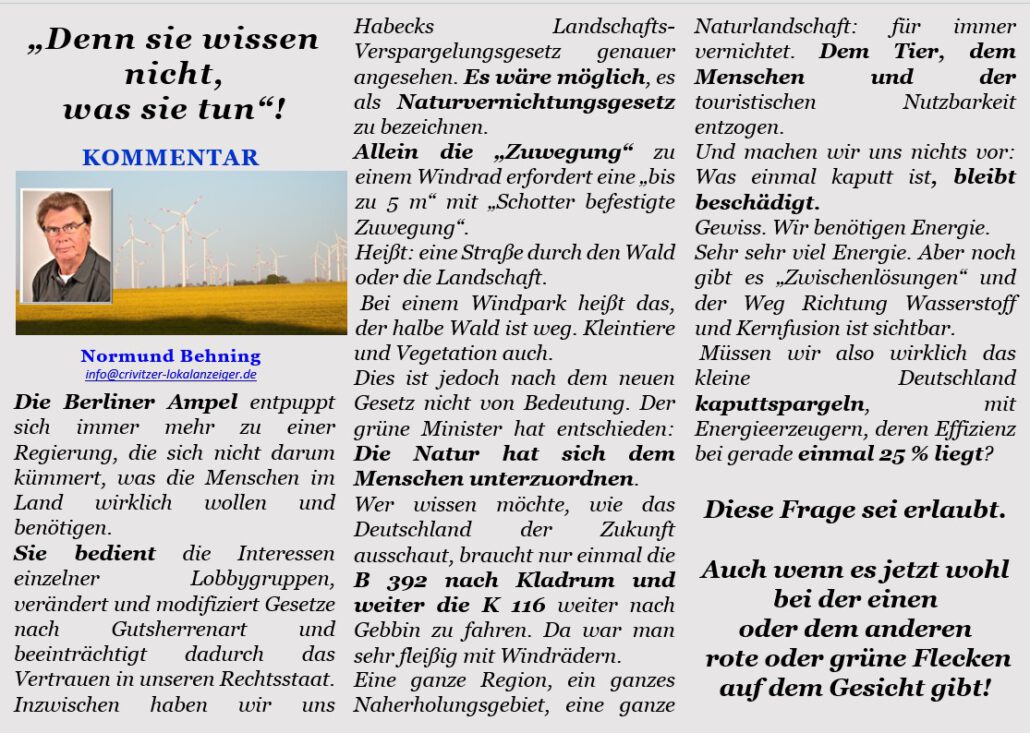
09.März -2024/P-headli.-cont.-red./353[163(38-22)]/CLA-190/28-2024
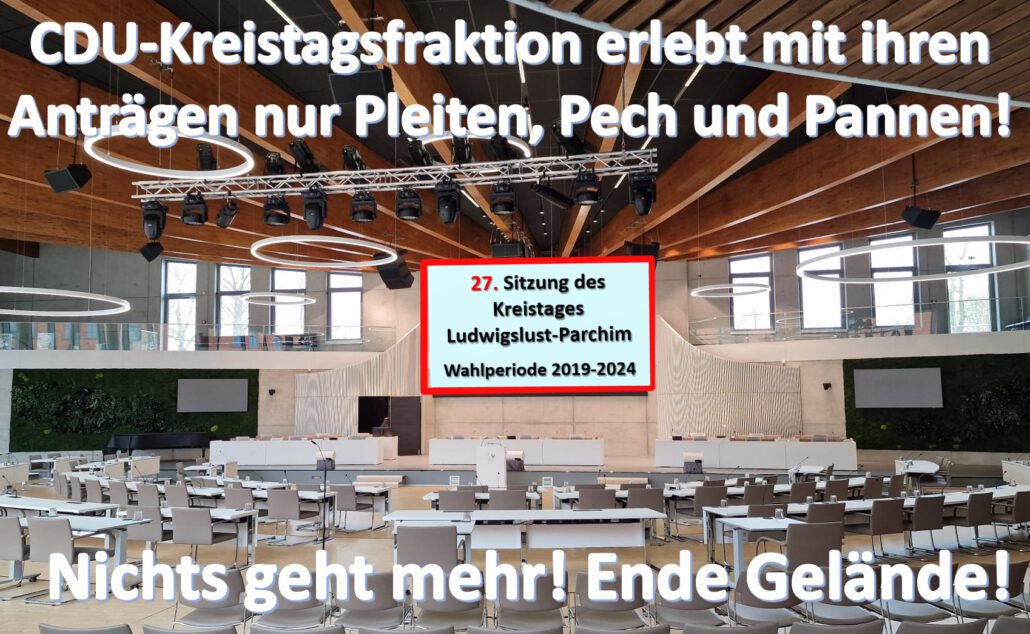
„Sie machen einen auf AFD, aber sie können es eben nicht“ Zitat einer Fraktion.
Eine Wahlkampfshow sondergleichen!
Dies war nur ein Beispiel von einem Zitat, das von einer Fraktion über die CDU-Anträge ausgesprochen wurde, neben den ganzen anderen Beiträgen. Die vorletzte Sitzung des Kreistages (27. Sitzung in der Wahlperiode) vor der Neuwahl wurde um 22:30 Uhr abgebrochen und vertagt nach ca. 5 Std. eines Possenspiels in der Debatte. Der Steuerzahler trägt erneut die Kosten (ca. 3.000 € Sitzungsgeld+ Fahrkosten + Verpflegung) für die Fortsetzung der 27. Sitzung des Kreistages am 14.03.2024. Die Einzelprofilierung einzelner Akteure der CDU-Kreistagsfraktion ist gescheitert, die Aufmerksamkeit wurde zwar erzielt, jedoch blieb es insgesamt eine große Blamage für das Gesamtbild des Landkreises LUP, was dort abgeliefert wurde.
So wurden nur vier Anträge von der CDU behandelt.
1.- „Verabschiedung einer Resolution des Kreistages LUP zur Migrationspolitik des Landes und des Bundes“
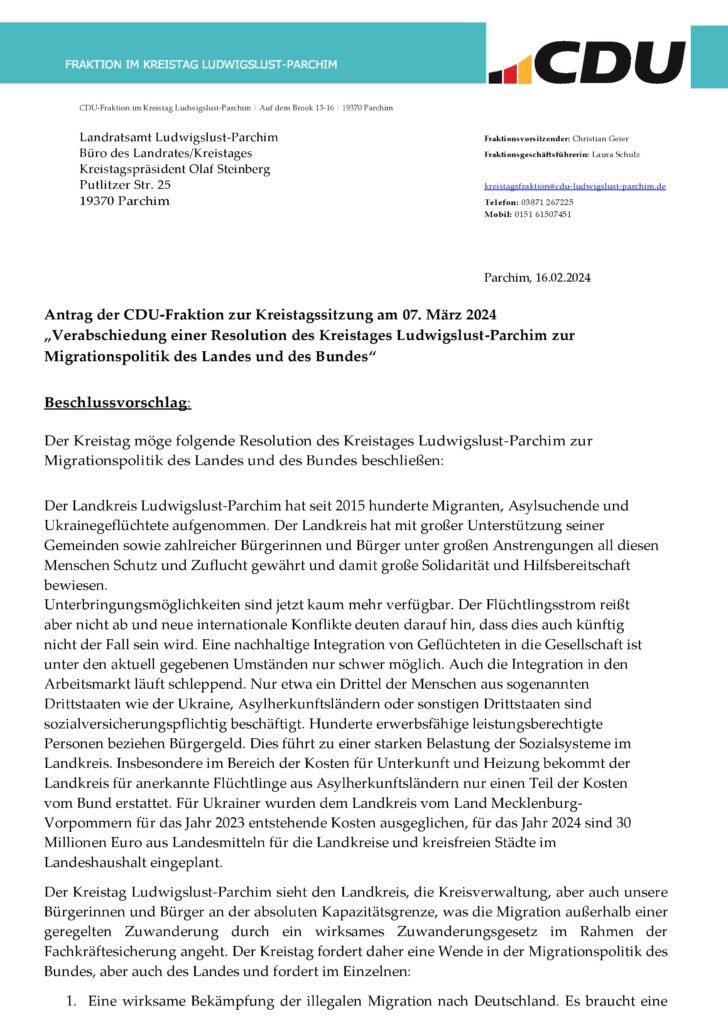
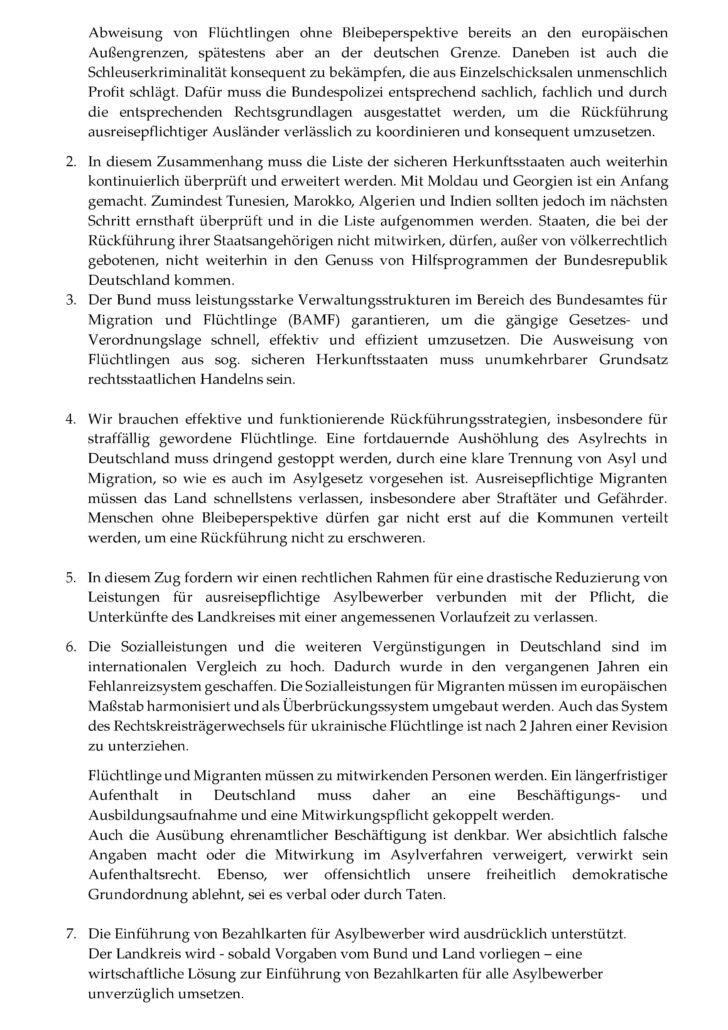
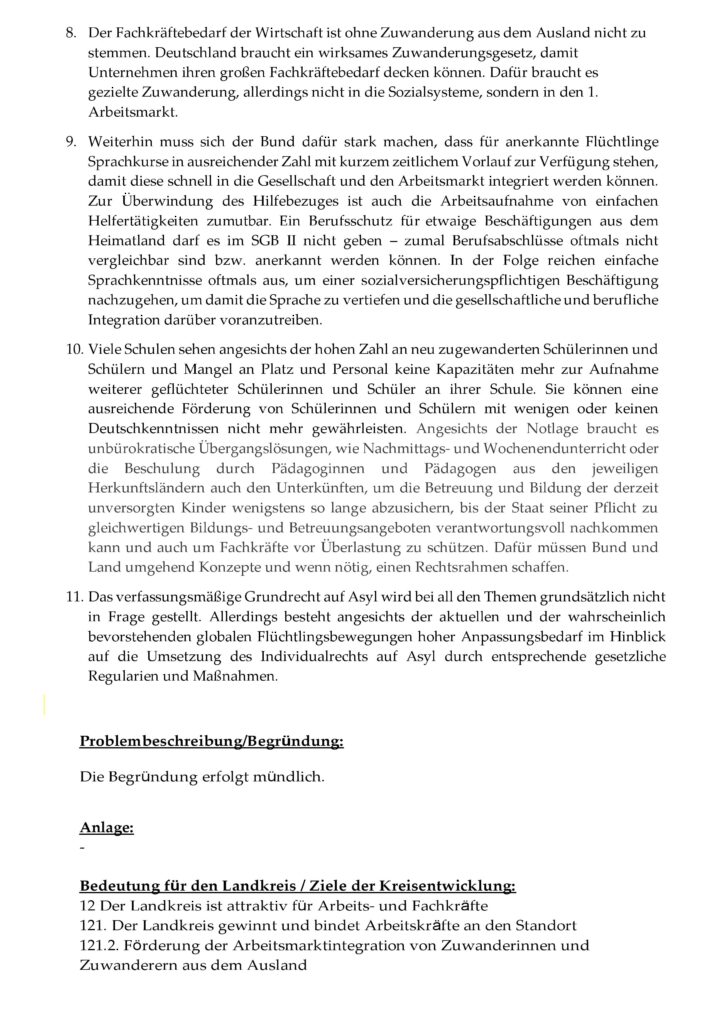
2.- „Umstellung der Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf wiederaufladbare Sachbezugs- bzw. Bezahlkarte“
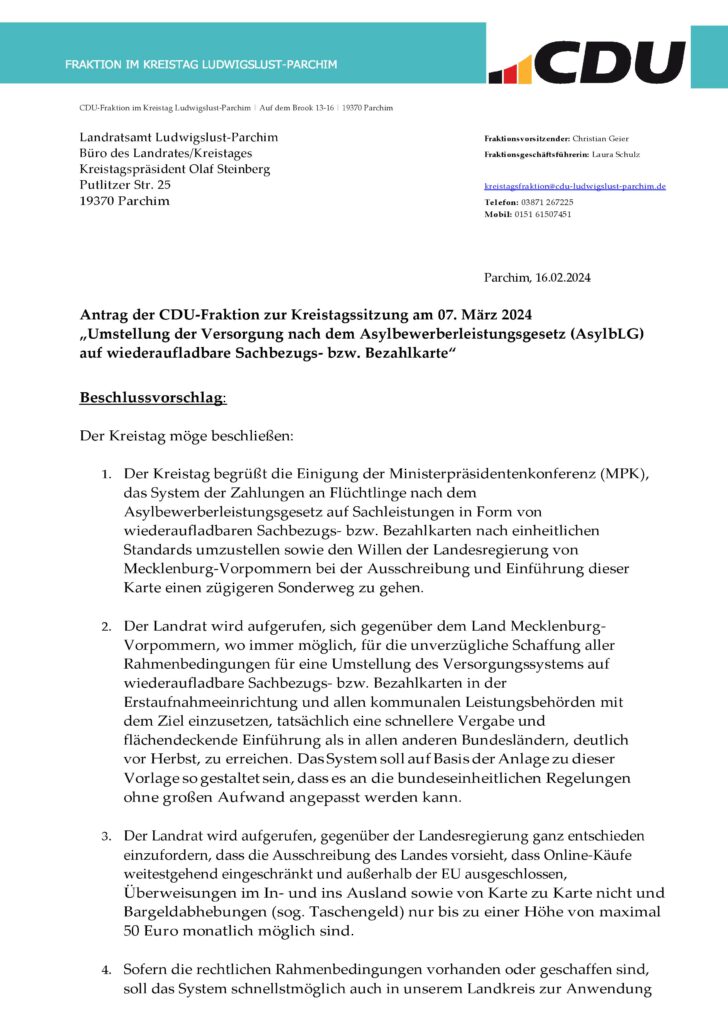
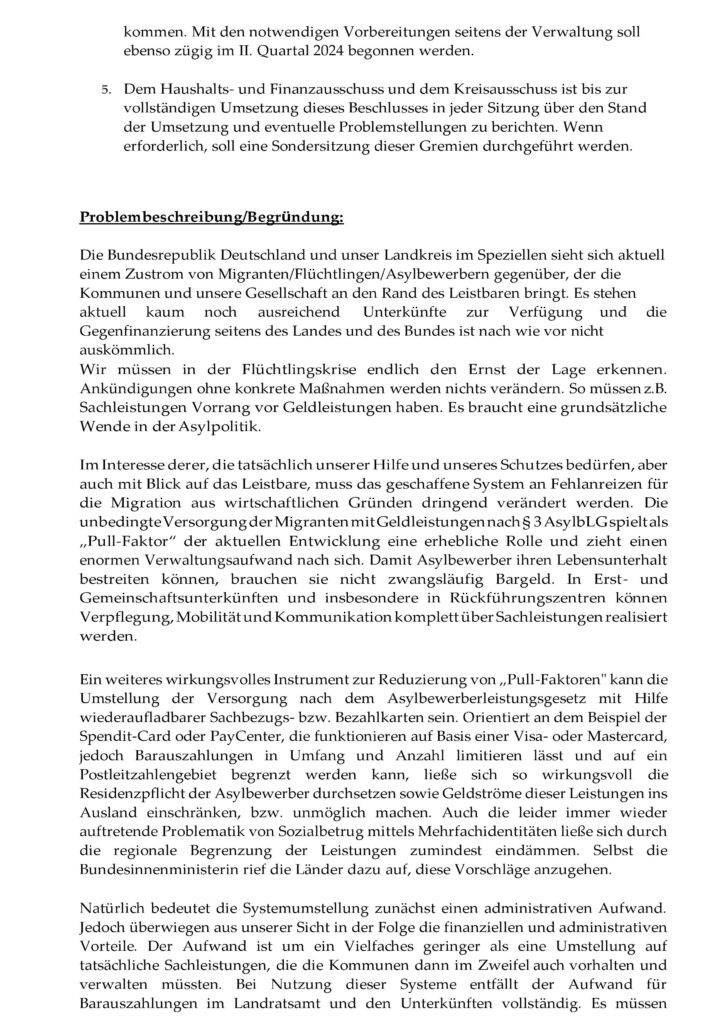
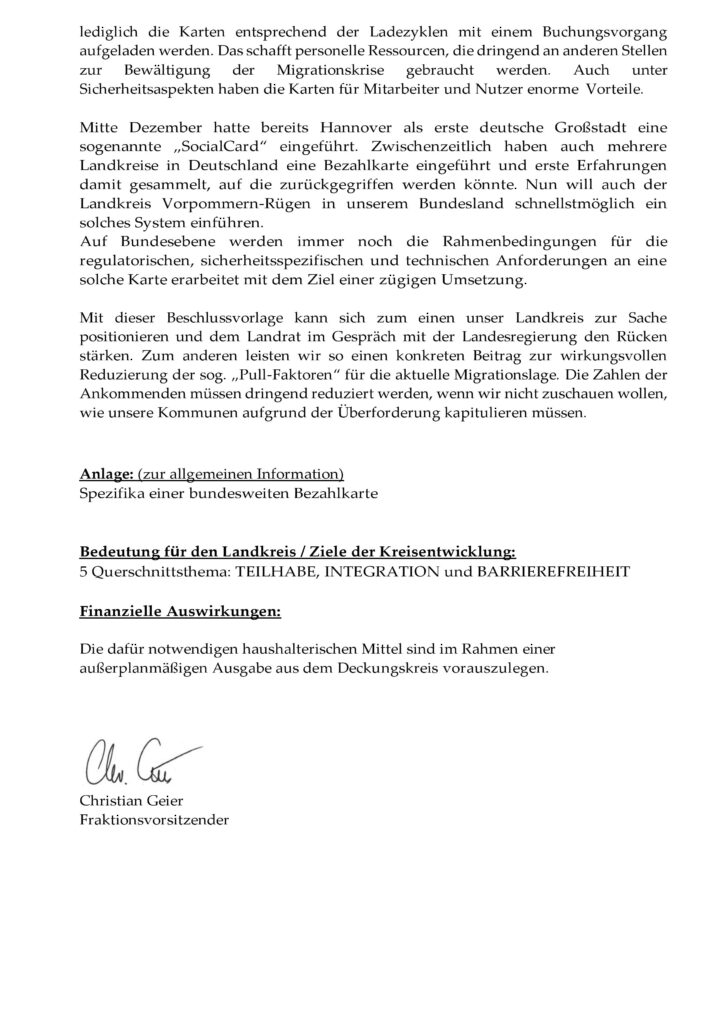
3.- „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II sowie § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Landkreis LUP etablieren.“
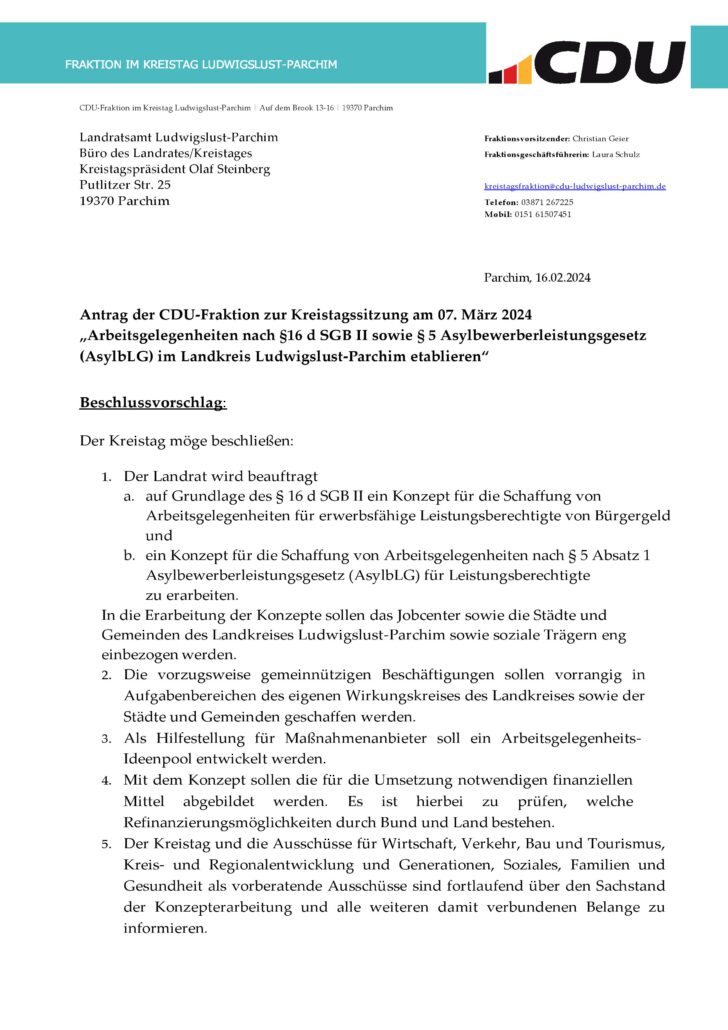
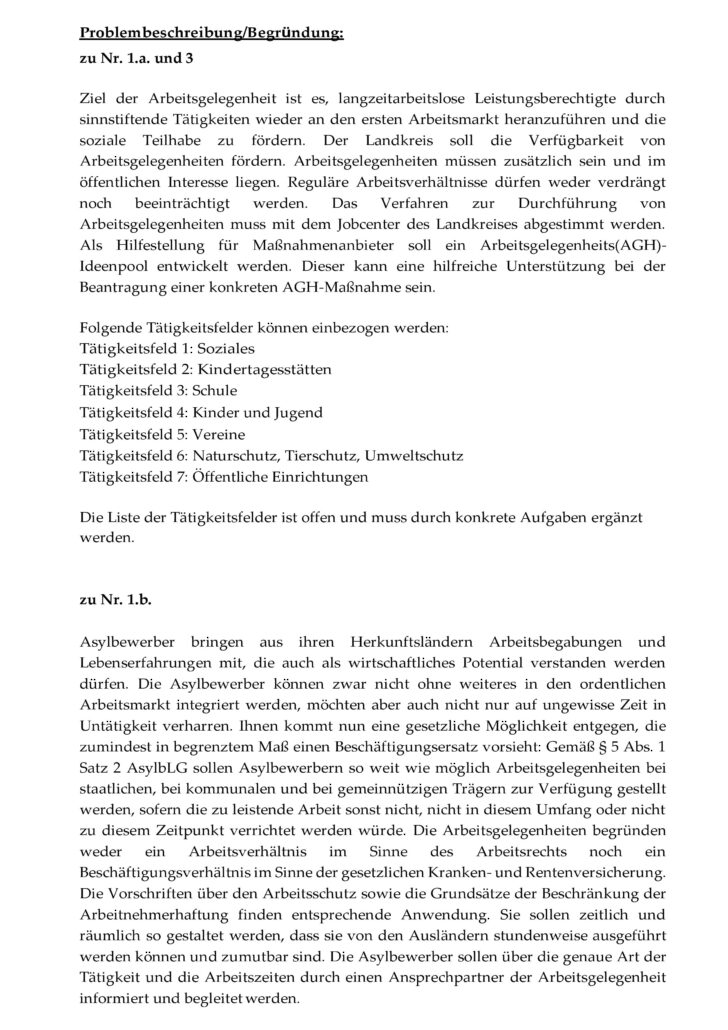
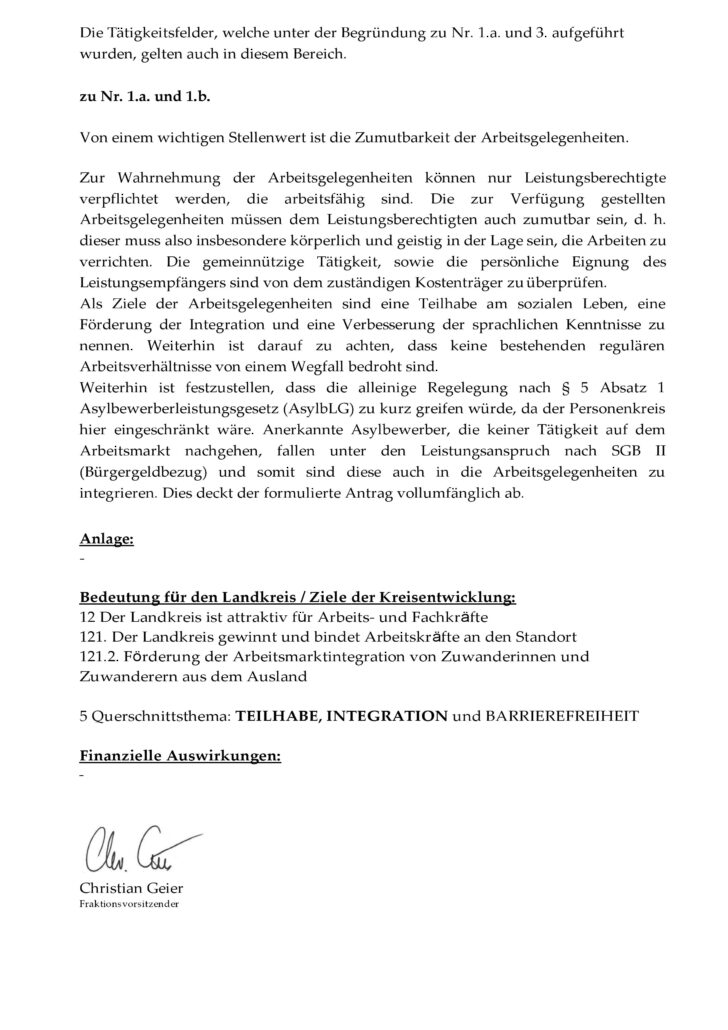
4.- „Keine Entmachtung des Kreistages bei Personalentscheidungen“
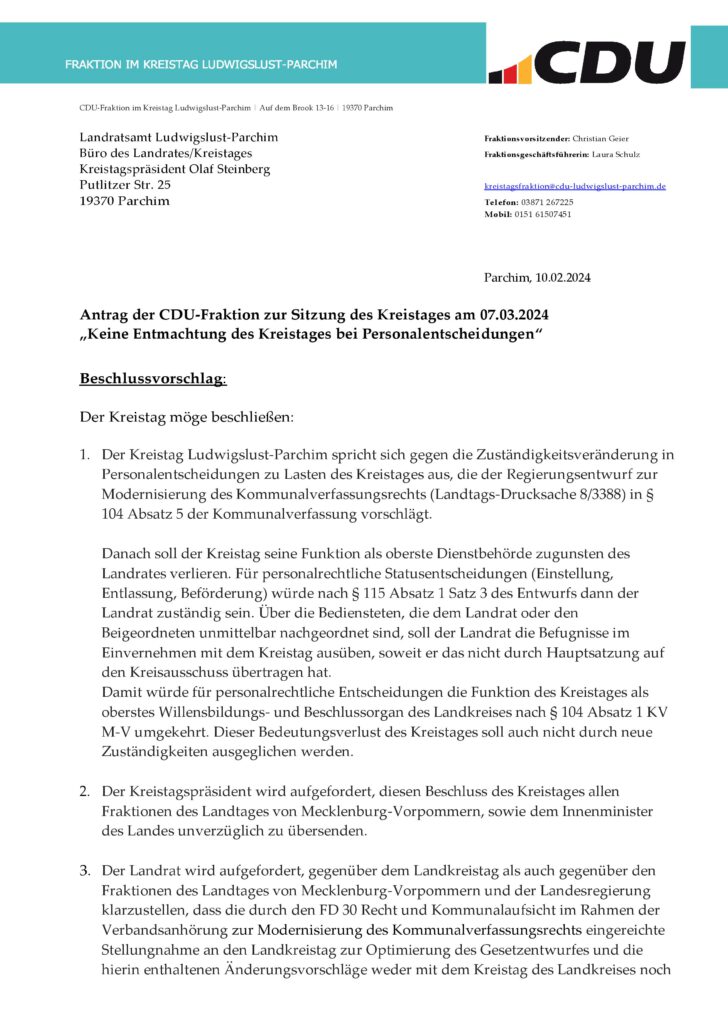
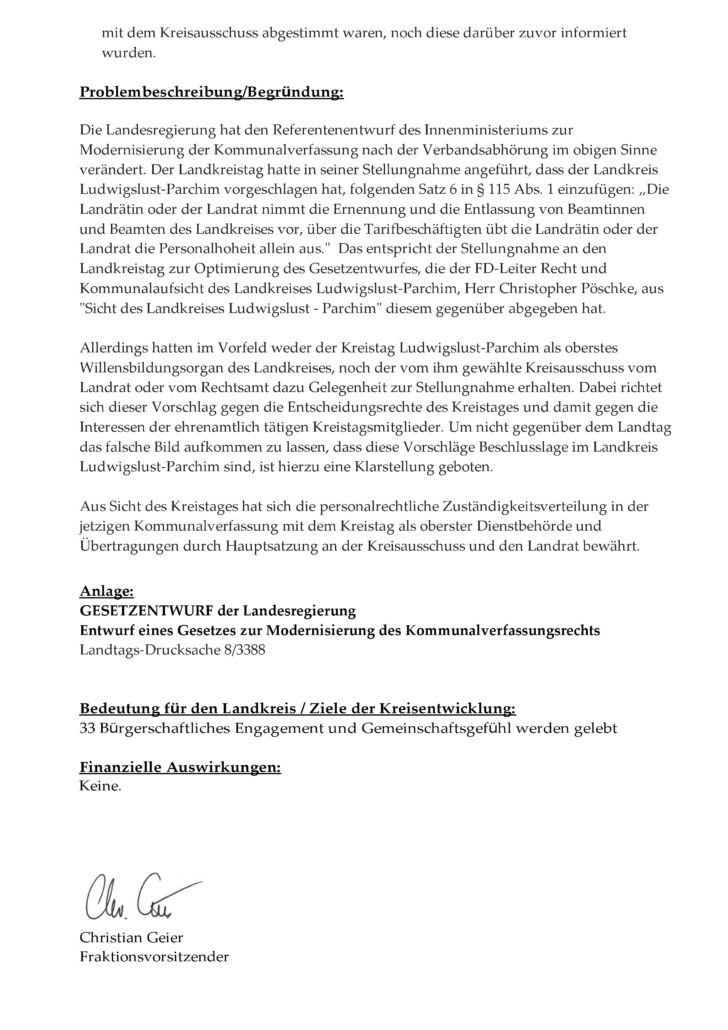
Die Anträge der CDU-Fraktion waren schlecht recherchiert, miserabel formuliert und enthielten wenig Sachargumente und Regionalität. Die Vortragenden waren dieselben alten Akteure mit den gleichen alten Argumenten. Als den Rednern der CDU – Fraktion die Argumente ausgingen und man keine mehr hatte, stellte man sich als Opfer hin, weil man nicht angehört oder nicht informiert oder einbezogen wurde. Seit fünf Jahren wiederholt sich immer wieder dieselbe Leier! Hinzu kommt, dass die CDU-Fraktion keine eigenen Ideen hat, sondern aus Thüringen übernommen hat. Alle Anträge wurden daraufhin folgerichtig abgewiesen. Vielen Dank, Thüringen, für diese Lehrstunde!
In der Diskussion kam es zu einigen Beleidigungen, persönlichen Befindlichkeiten und Sticheleien altbekannter Akteure.
Der stell. Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Christiansen, erklärte, dass der Inhalt der Resolution auf die Bundes- und Landesebene bezogen ist und nicht auf den Landkreis, sondern auf die globale Weltpolitik. Er forderte die CDU-Kreistagsfraktion auf, „kommen sie aus dem diffusen zum konkreten Handeln im Landkreis“ zu bewegen.
Christian Geier, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, pochte auf das Recht seiner Fraktion, das Thema zu diskutieren und sich auszutauschen. Allerdings fehlte es ihm wie immer an konkreten Details im Landkreis, wo Probleme herrschten. Seine Erklärung „an vielen Orten“ war lediglich ein Beispiel für sein fundiertes Faktenwissen.
Die stellv. Vorsitzende der Kreistagsfraktion die LINKE Steffi Pulz-Debler hielt einen staatstragenden politischen ideologischen Vortrag über die Polarisierung der Gesellschaft. Zur Sache selbst und zum Inhalt der Anträge hatte sie wenig zu sagen, sie wollte eben etwas sagen. Polemik pur! Der Vorsitzende der LINKEN Kreistagsfraktion, Andreas Sturm, zog es vor, den ganzen Tag zu schweigen und war beschäftigt mit der Anfertigung von Selfies von seiner Fraktionsrednerin. Dies könnte die Kosten für den Steuerzahler von 60,00 € Sitzungsgeld + Fahrtkosten + Verpflegung zuzüglich der monatlichen Aufwandsentschädigung von 620 € vielleicht rechtfertigen.
Die Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Ulrike Seemann-Katz verglich die Anträge der CDU mit den Anträgen der AFD und erhielt vom Kreistagspräsidenten eine Rüge, weil sie diese Anträge der CDU als „dämliche Anträge“ bezeichnete. Zu dem Inhalt der Anträge war wenig Konkretes zu hören. Sie wollte eben auch etwas sagen. Sie forderte, dass man sich im Landkreis „für eine gute Stimmung“ und „eine Willkommenskultur“ einsetzen müsse. Als Flüchtlingsrat MV e. V. äußerte sie sich vorrangig zu dieser Arbeit, zum Landkreis fehlte konkretes wie üblich. Ihr Ehemann Andreas Katz, als neues Kreistagsmitglied, wollte auch etwas zum Thema sagen, was ihm jedoch nicht gelungen ist.
Der Fraktionsvorsitzende Freier Horizont/FREIE WÄHLER Heiko Böhringer schwieg den ganzen Abend über. Es handelte sich ja auch nicht um Windkraftanlagen. Zu anderen sachfremden Themen fehlt wahrscheinlich der Zusammenhang.
Die AfD-Fraktion hat sich das Ganze angesehen und in den fünf Stunden lediglich mit acht Sätzen einmal geantwortet. Die Kommunikation war spärlich und man hat den Eindruck, dass die Damen und Herren völlig überfordert sind. Es ist unglaublich, wie nahe doch eine Ruine liegt.
Exklusiv hatte die Fraktion „Heimat und Identität“ ihr großes Comeback bei diesen Themen und war bestens vorbereitet für die Diskussion und das Streitgespräch. Abgesehen von dem Inhalt und den einzelnen Aussagen war es eine Politsatire aller Couleur.
Es stellt sich die Frage, ob es sich um eine Wahlkampfveranstaltung mit Showeinlagen handelte oder ob es sich um eine kostspielige Theaterproduktion, die vom Steuerzahler finanziert wurde.
Lösungen zum Thema wurden bisher nicht präsentiert.
Kommentar/ Resümee

„Diskussionen sind ein beliebter Zeitvertreib zur Selbstdarstellung.“ Erhard H. Bellermann
Die CDU-Kreistagsfraktion präsentiert sich auf der Sitzung mit einer blassen, farblosen und unprofessionellen Vorbereitung sowie der Austragung von persönlichen Fehden mit dem politischen Gegner! Nicht die AfD-Fraktion war der Nutznießer des Abends, sondern die Fraktion Heimat und Identität. Sie erhielten endlich eine Bühne und führten eine Generalabrechnung mit der CDU-Fraktion durch. Alle vier eingereichten Anträge sind kläglich gescheitert. Die Themen wären besser für den Landtag oder Bundestag geeignet, aber zum Kreis LUP fehlte der Bezug und die Regionalität. Die CDU-Fraktion hat große Worte und wenig Konkretes für eine Aufmerksamkeit verwendet, doch das wurde bereits auf dem Kreisparteitag der CDU angekündigt.
Einzig und allein der Landrat Stefan Sternberg, das muss man wirklich eingestehen als Beobachter, war hervorragend vorbereitet im Faktenwissen und teilte auch kräftig an die Fraktion aus. Er erläuterte viele Dinge klar, mit Fakten und in logischer Reihenfolge, sodass selbst seine eigene Fraktion blass aussah. Man merkte ihm an, wie sehr ihn die Herangehensweise der CDU-Fraktion erregte.
Es war selten, dass er derart klar und deutlich sprach. Nur kurz ein Beispiel: Im Rahmen der Art und Weise eines Vortrages, mit deutlichen Angriffen auf den Landrat, von Klaus-Michael Glaser, welcher über eine angebliche Entmachtung des Kreistages bei dem Entwurf zu der neuen Kommunalverfassung thematisierte. Antwortete der Landrat klar: „Das Belehrende“ kennt man seit etlichen Jahren und die „Schärfe des Vorwurfes sei völlig ungerechtfertigt“ in diesem Text. Herr Glaser kritisierte, dass er als Kreistagsmitglied seine 250 € monatlich (+ Sitzungsgeld + Fahrkosten) nicht als „Schweigegeld“ betrachtet und dazu eine andere Meinung vertritt.
Liebe Kreistagsmitglieder, es ist Zeit für Neuwahlen bei Ihnen. Um endlich wieder Lösungen für die Bürger zu präsentieren, anstatt nur einer steuerfinanzierten Selbstdarstellung.
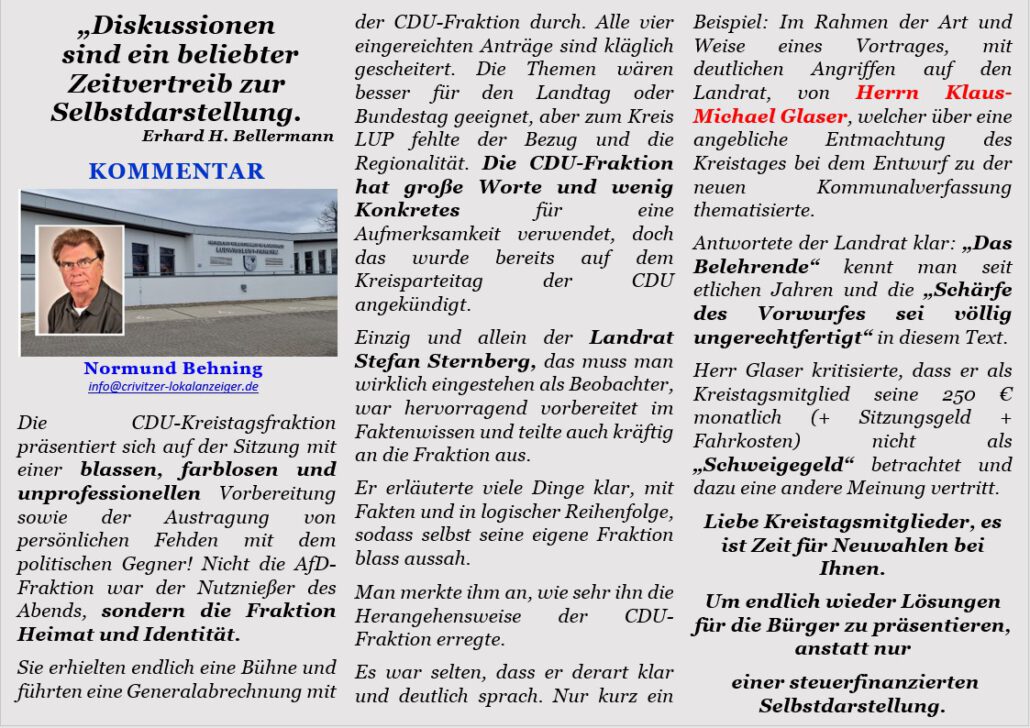
8.März -2024/P-headli.-cont.-red./352[163(38-22)]/CLA-189/27-2024

05. März -2024/P-headli.-cont.-red./351[163(38-22)]/CLA-188/26-2024

Es handelt sich immer um dieselben Akteure.
Die CDU-Fraktion LUP fordert seit ca. 6 Monaten politische Resolutionen im Kreistag, scheitert jedoch und landet fast immer im Ausschuss. So forderten sie zum Beispiel im Sommer 2023 letzten Jahres eine politische Resolution „Umlandbewohner schützen, Moore bewahren – Klares Nein des Kreistages zur Nordumgehung für Schwerin in der geplanten Trassenführung“. Die Grünen leisteten Schützenhilfe und applaudierten. Es ist schon erstaunlich, was die CDU-Kreistagsfraktion plötzlich im Wahlkampf für grüne Themen entdeckt. Zuerst der Wolf, dann den Windkraftausbau und nun die Schweriner Nordumgehung!
Es war ein seltenes Eingeständnis, dass nicht nur die Grünen Kreistagsfraktion ins Schmunzeln geriet, als Herr Klaus-Michael Glaser versuchte, den Antrag seiner Fraktion zu begründen. Obwohl er nicht der umweltpolitische Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion ist, fühlte er sich persönlich angesprochen, die Gründe für diesen Antrag vorzutragen. Anfangs stellte er fest, dass das Thema eigentlich in der Zuständigkeit der Stadt Schwerin liegen sollte, doch die Auswirkungen der geplanten Nordumgehung betreffen auch das Gemeindegebiet Leezen, genauer gesagt den Ortsteil. Allerdings befindet sich diese wiederum im Amtsbereich des Amtes Crivitz im Landkreis LUP. Jedoch, wenn man alles aus der Verwaltungsperspektive betrachtet und immer die Frage nach Zuständigkeit in den Vordergrund stellt, ist das schon eine sehr banale Begründung. Es wäre viel sinnvoller gewesen, alles der Stadt Schwerin zu überlassen und nur aus der Sicht eines Randbeteiligten zu bewerten! Anstatt politische Resolutionen vom Kreistag zu fordern. In seiner Begründung bezog er sich auf die aktuelle Trassenführung der Schweriner Nordumgehung. Wohl gemerkt, es geht um die bereits beschlossene Trassenführung vom Schweriner Stadtparlament.
So monierte er, dass sich mit der vorliegenden Planung der Stadt Schwerin lediglich der Verkehr an die B-104 verlagern wird in den Ortsteil Rampe. Diese Trassenführung soll nicht nachhaltig sein und auf einer angeblich veralteten Planung beruhen. Erst als der Landrat klarstellte, dass nicht von Schwerin erwartet werden kann, nach einer solchen Resolution die günstigste Variante für die Abfahrt A-14 NORD (bei Plate) für den Landkreis LUP zu befürworten, wurde der Fraktion die Lage bewusst. Im Vorfeld des behördlichen Beteiligungsverfahrens zur Nordumgehung sollte solch ein politisches Signal durch den Landkreis nicht gesendet werden. Der Antrag zu dieser Resolution wurde schließlich an den Ausschuss zur Beratung weitergeleitet und ist dort versandet.
Beim nächsten Beispiel im Herbst 2023, als der Kreistagspräsident dem Abgeordneten Herrn Klaus-Michael Glaser das Wort entzog. Aufgrund seiner Ungeduld an einer falschen Stelle kam er dann zu Wort beim aktuellen Anlass und bat um Auskunft. Er hielt einen Vortrag über die Zulässigkeit eines Gegenrederechts bei Wortmeldungen zu Geschäftsordnungsanträgen. Im Folgenden wurde auf das Minderheitenrecht der Opposition verwiesen, Anträge stellen zu können und denen muss man nach seiner Meinung erst einmal zuhören. Andernfalls lässt sich erst nach der Anhörung feststellen, ob sie rechtswidrig sind. Er forderte den Landrat auf, zunächst einmal zuzuhören, wie er es angeblich auf einer anderen Veranstaltung versprochen hatte. Der Landrat sollte also mit den Mitgliedern des Kreistages beginnen. Auch dieser Intervention löste nur Kopfschütteln im Saal aus und ein verhaltenes Schmunzeln bei allen anderen Fraktionen.
Seit diesem Zeitpunkt wurde das Thema Migration durch die CDU – Kreistagsfraktion neu entdeckt und stigmatisiert. Die AFD-Fraktion feierte dies in der Sitzung und löste damit heftige Diskussionen aus. Jetzt steht das Thema Migration erneut im März 2024 auf der Agenda und es wurde ein Fragenkatalog mit 55 Fragen der CDU-Fraktion zur Asyl- und Flüchtlingssituation gestellt, die vom Fraktionsvorsitzenden Herrn Christian Geier ausgearbeitet wurden. In der Migrationsthematik fand er im Kreistag sein eigenes Thema für seine Profilierung. Selbstverständlich ist der Windkraftausbau sein eigentliches Lieblingsthema, das er wiedergefunden hat. Bereits 2014 haben sich die Partei die LINKE und 2019 die FDP mit dem Thema Windkraft befasst, jeweils als Opposition im Wahlkampf. Soeben 2024 ist die CDU-Kreistagsfraktion LUP an der Reihe.
Es ist nicht möglich, von einer Antragsflut der CDU – Kreistagsfraktion zu sprechen, wenn man erst auf den letzten Metern vor der Wahl erkennt, dass man sich als Opposition bemerkbar machen muss. Vier Jahre lang wurde jede andere Argumentation von der CDU-Kreistagsfraktion schöngeredet, um das gute Miteinander zu fördern. Doch plötzlich erwacht man aus dem Koma und es soll sich der Tonfall und die Themen ändern. Was für ein schönes Schauspiel!
Kommentar/Resümee
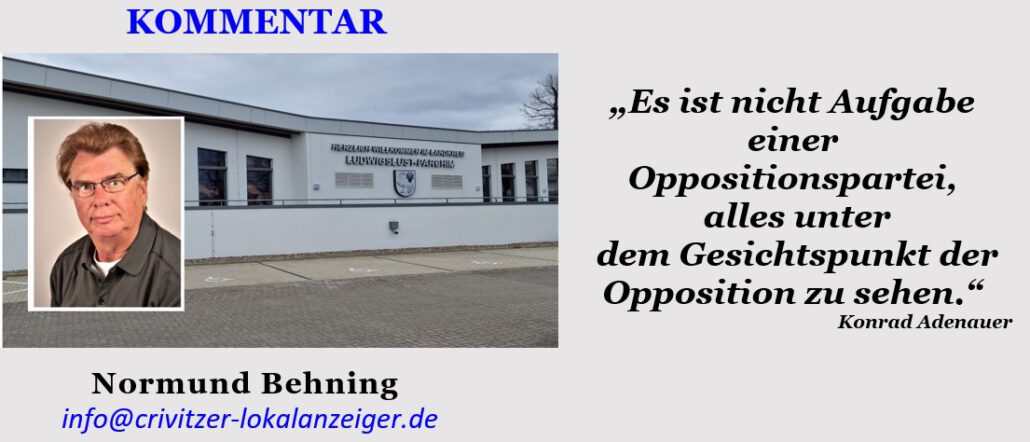
Es ist nicht ratsam, Opposition lediglich als Selbstzweck zu betrachten. So ist es schon erstaunlich, was die CDU-Kreistagsfraktion des Landkreises LUP plötzlich alles an KRAFT-Anwandlungen in der Nähe des Erdwärmeheizwerkes in Neustadt-Glewe erhalten hat. Seit Ihrem Kreisparteitag am vorigen Wochenende in Neustadt-Glewe stellt sie sich angeblich als geerdet sowie realitätsnah am Bürger dar und kann es angeblich? Fragt sich einerseits nur was und andererseits ob mit oder ohne die Brille eines Machtanspruches?
Plötzlich wird das Thema Windkraftausbau wieder in den Vordergrund gerückt und man ist gegen einen zügellosen Ausbau, obwohl man vorher in einer Regierungsverantwortung ganz anders agierte bzw. argumentierte. Eigentlich fehlt nur noch das Thema „Südbahn“. Es ist das Lieblingsthema des CDU-Kreisvorsitzenden Wolfgang Waldmüller, das besonders bei Landtags- und Kreistagswahlkämpfen hoch im Kurs steht und seit zehn Jahren immer wieder hervorgekramt wird.
So war zu lesen, dass die CDU im Landkreis LUP angeblich die führende Kraft im Landkreis LUP werden will, da die einen abgehoben sind und die anderen ein Trümmerhaufen sein sollen. Man sollte immer daran denken, wenn man mit dem Finger auf jemanden anderes zeigt, zeigen zugleich immer noch drei Finger auf einen selbst zurück.
Die Argumentationsschemata, hier die Ideologen und dort der Trümmerhaufen, helfen uns nicht weiter und sind lediglich auch nur platte Wahlkampfparolen. Der Populismus hat wieder Hochkonjunktur im Kommunalwahlkampf in LUP!
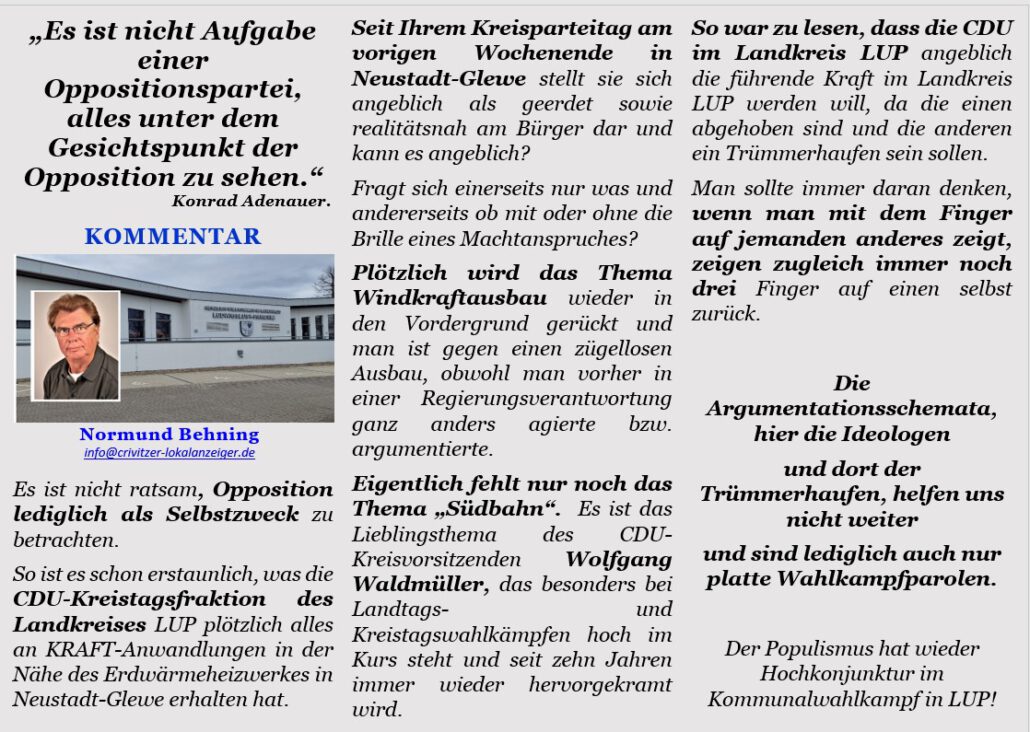
03. März -2024/P-headli.-cont.-red./350[163(38-22)]/CLA-187/25-2024
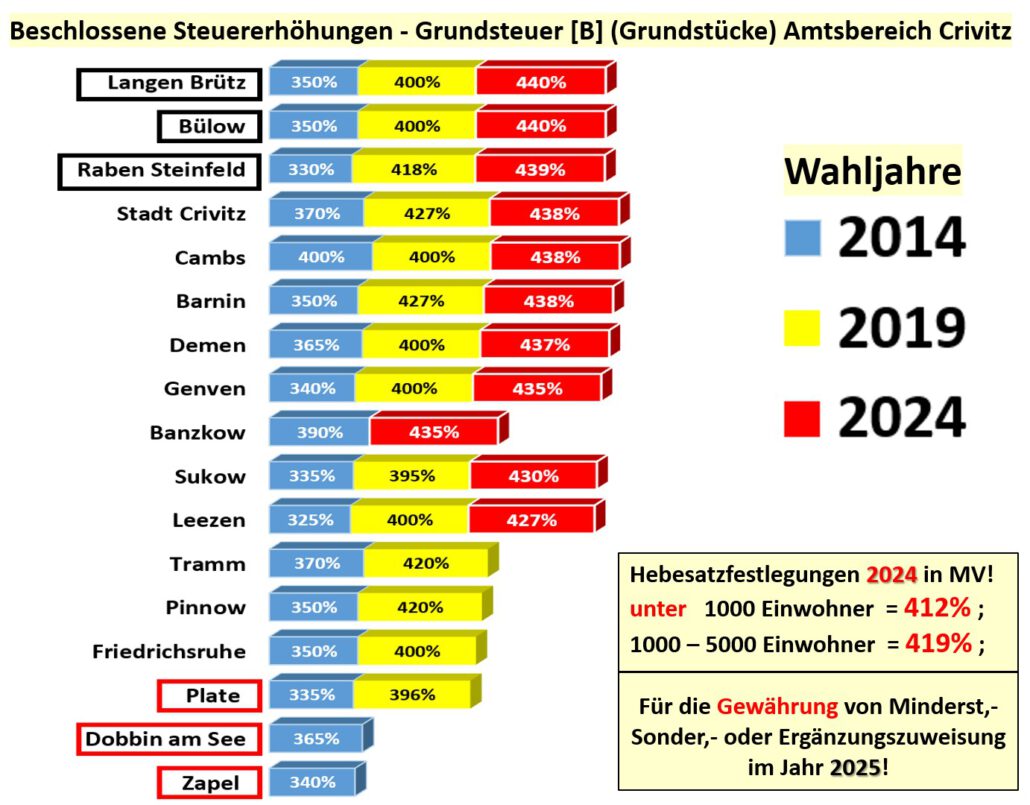
Die meisten Kommunen im Amtsbereich Crivitz erhöhen ihre Hebesätze für die Grundsteuer stärker als notwendig, bevor der Bund im Jahr 2025 eine neue Berechnungsgrundlage für den Messbetrag vorlegt.
Ist es wirklich notwendig, dass die Kommunalpolitiker die Grundsteuer derart erhöhen, oder handelt es sich dabei um ein politisches Kalkül, da ab dem 01.01.2025 die neue Grundsteuerberechnung des Bundes greift?
Bei den meisten Kommunen war das klare politische Kalkül der Entscheidung, die Grundsteuern bereits jetzt an die neuen Nivellierungshebesätze bis 2027 vom Land MV anzupassen. So besteht die Hoffnung, dass die Bürger im Wahljahr 2024 nicht allzu genau hinsehen werden. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Berechnungsgrundlage für neue Messbeträge des Bundes bereits im Jahr 2025 vorliegen wird. Eine spätere Grundsteuererhöhung erst im Jahr 2025-2027 durch Anpassung der Hebesätze der Gemeinden wäre mit erheblichen Protesten verbunden.
Die neue Grundsteuer, die ab 2025 erhoben wird, basiert auf der Rechnung Wert des Grundbesitzes x Steuermesszahl x Hebesatz der Gemeinde. Um den Wert des Grundbesitzes zu ermitteln, werden folgende Faktoren berücksichtigt: Bodenrichtwert. Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete. Ohne Unterscheidung zwischen Gewerbe und Wohnen werden diese neuen Messbeträge nach dem Grundsteuer-Reformgesetz mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz verrechnet. So soll jedes Grundstück individuell bewertet werden. Dies könnte erneut zu einer Erhöhung der Grundsteuer führen. Voraussichtlich wird für Grundstücke und Immobilien auf dem Land oder in strukturschwachen Gebieten weniger Grundsteuer anfallen. Dagegen könnte es für Städter, Besitzer unbebauter Grundstücke und Eigentümer von Einfamilienhäusern teurer werden. Die Grundsteuer ist ein wichtiger Einnahmefaktor für jede Gemeinde.
Sind die Gründe für diese Erhöhungen der Hebesätze bei ca. 65 % der Gemeinden 2024 im Amtsbereich Crivitz die fehlenden Rücklagen, ein vorauseilender Gehorsam oder die vielen Investitionsprojekte, in denen sie auf Zuweisungen vom Land angewiesen sind, wegen mangelnder Eigenliquidität?
Es mag sein, dass die Gründe für die Entscheidungen variieren, doch die Auswirkungen auf Eigentümer, Unternehmen und Mieter (Betriebskosten) werden deutlich spürbar sein. Selbstverständlich spielen auch finanzpolitische strategische Fehlentscheidungen eine wichtige Rolle, die man in den vergangenen Jahren getroffen hat. Aufgrund der drastisch schwindenden Kapitalreserven und liquiden Mittel wird versucht, vor der Wahl 2024 noch etwas nachzuholen, bevor es zu spät ist.
Der kommunale Finanzausgleich (FAG) dient der Verringerung von Unterschieden zwischen starken und schwachen Kommunen und der gleichmäßigen Verteilung öffentlicher Gelder innerhalb eines Landes. Für die weitere Verteilung wurde ein Schlüssel berechnet, der nicht das tatsächliche örtliche Aufkommen erfasst, sondern eine gewisse Nivellierung unter den Gemeinden vornimmt. Damit soll verhindert werden, dass Gemeinden mit einer besonders einkommensstarken Bevölkerung vergleichsweise hohe Steuererträge erzielen, Gemeinden in strukturschwachen Regionen dagegen sich mit einem sehr niedrigen Aufkommen begnügen müssen.
Dazu wurden Landes-Hebesätze als Nivellierungssätze beschlossen, die für den Zufluss von öffentlichen Geldern und Förderungen ausschlaggebend sind. Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer (Realsteuern) wurden für die Jahre 2024 bis 2027 folgende Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt: Grundsteuer A: 338 Prozent, Grundsteuer B: 438 Prozent, Gewerbesteuer: 390 Prozent.
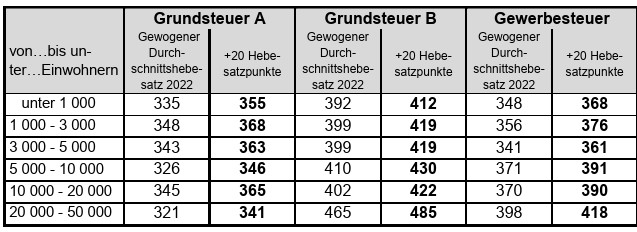
Um aber nach § 27 FAG M-V im Jahr 2025 eine Mindestzuweisung oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen erhalten zu können, müssen die kreisangehörigen Gemeinden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2024 so festsetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2022 liegen.
In 65 % der Gemeinden im Amtsbereich Crivitz wurde die Grundsteuer bereits aber weit über 20 % erhöht, und man hat sich schon an die Nivellierungshebesätze des Landes bis 2027 gehalten. Damit die Gemeinden nicht erneut die Grundsteuer erhöhen müssen, wie zuvor bereits erwähnt. Jedoch sind die Belastungen enorm hoch!
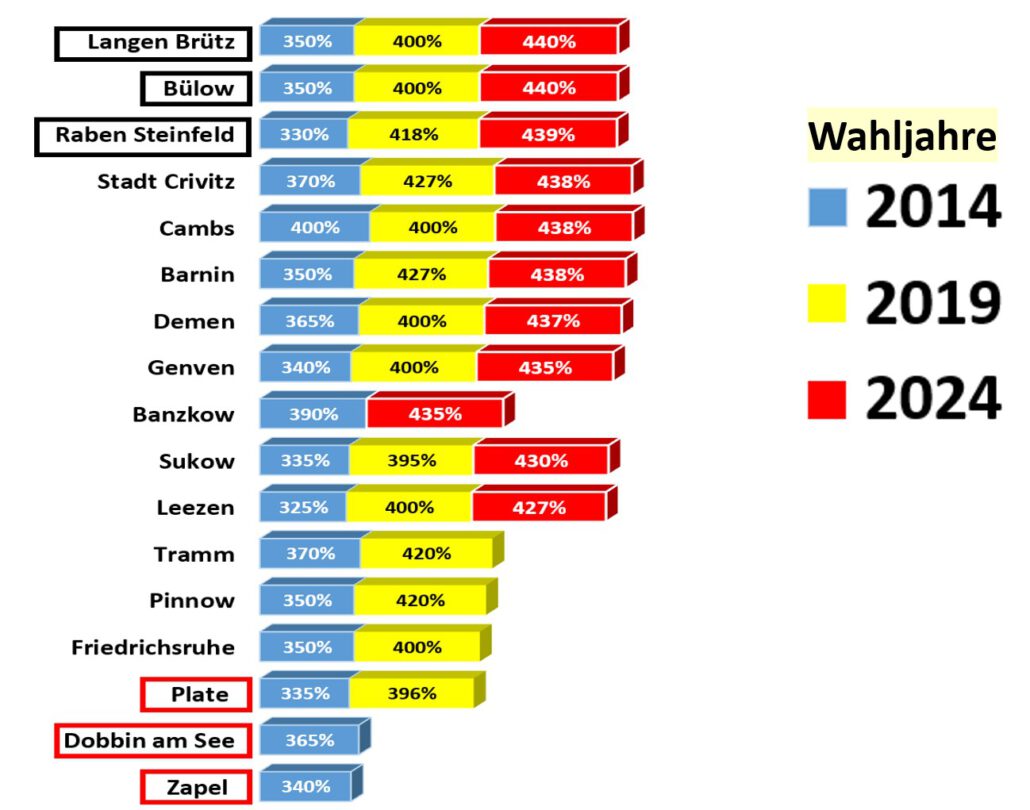
Etwa 40 % der Kommunen im Amtsbereich Crivitz müssen die Steuererhöhungen noch umsetzen, wenn sie die Mindest- oder Sonderzuweisungen 2025 erhalten möchten oder diese unangenehmen Angelegenheiten ihrem neu gewählten Abgeordneten nach der Wahl am 09.06.2024 überlassen wollen.
Die 17 Kommunen im Amtsbereich Crivitz werden im Jahr 2024 zusammen etwa 2.756.400 € Grundsteuer einnehmen. Spitzenreiter ist die Stadt Crivitz mit ca. 580.700,00 €, gefolgt von der Gemeinde Plate mit 336.600,00 € und der Gemeinde Pinnow mit 250.000,00 € Grundsteuereinnahmen.
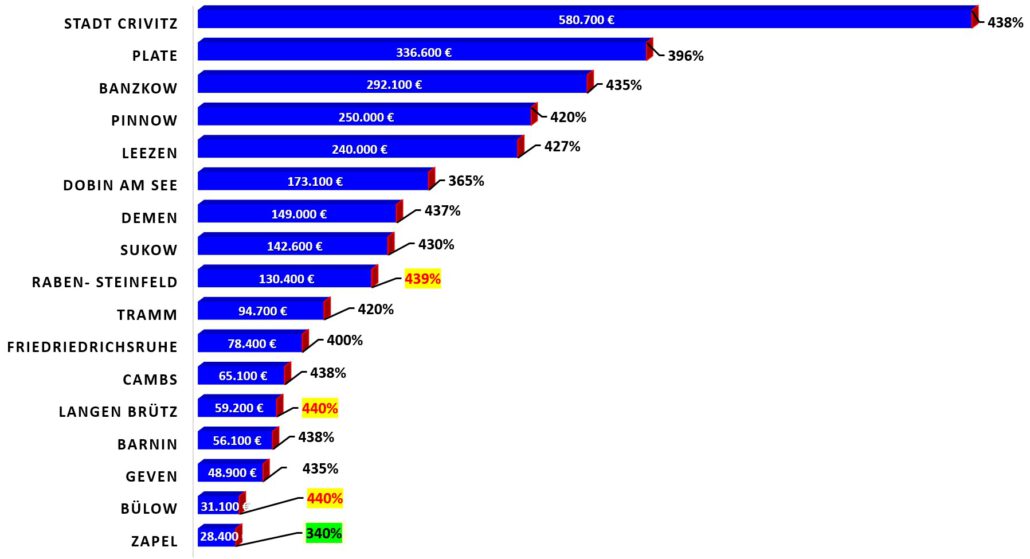
Daher ist es von Bedeutung, dass die frisch gewählten Abgeordneten nach der Wahl in den Gemeinden stets ihre eigene Liquidität und Steuerkraft im Auge behalten, wenn sie sich für großflächige Investitionen interessieren und planen sollten.
Denn durch ständige Steuererhöhungen ist der Abbau von Rücklagen, Eigenkapital und Liquidität nicht aufzuhalten und nicht allein zu bewältigen.
Resümee/ Kommentar
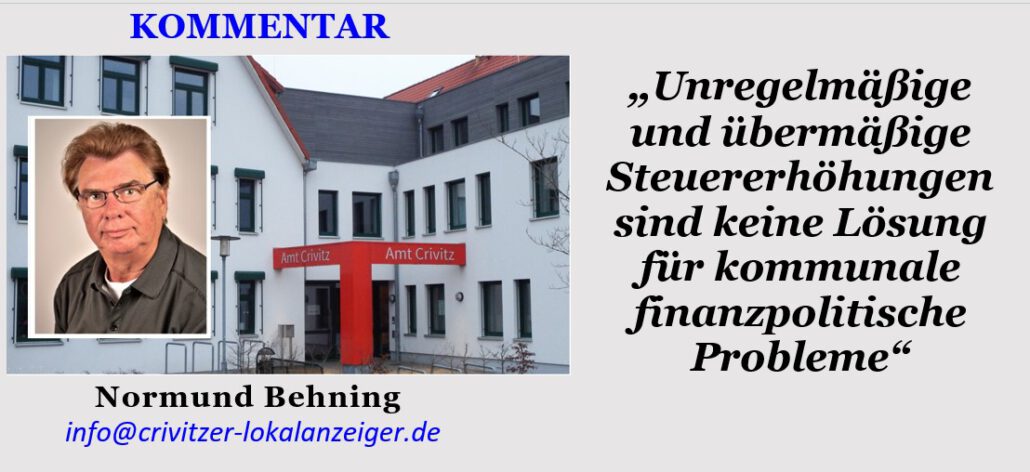
Unregelmäßige und übermäßige Steuererhöhungen sind keine Lösung für kommunale finanzpolitische Probleme. Sie verursachen lediglich zusätzliche Belastungen für die Bürger und die Wirtschaft sowie für die Entwicklung der Region.
Nur darf man eines bei dieser Tatsache nicht vergessen, dass es bei der neuen Grundsteuer-Berechnung auf drei Größen angeht: den Einheitswert (ab 2025: Grundsteuerwert oder Grundsteueräquivalenzbeträge), die Steuermesszahl und den individuelleren Hebesatz der Kommune. Wie hoch die Grundsteuer ab 2025 ist, entscheidet sich erst im Jahr 2024. Jeder zahlt bis Ende 2024 seine Grundsteuer wie bisher. Erst ab 2025 wird die neue Grundsteuer fällig.
Wenn die Grundsteuer in den Gemeinden bereits jetzt kräftig angehoben wird, weil man möglicherweise in der Vergangenheit etwas Strategisches versäumt hat oder um Förderungen für Bauprojekte zu erhalten, dann ergibt sich automatisch eine Steigerung in der neuen Grundsteuer-Berechnung ab 2025.
Das ist natürlich alles nicht so populär in dem gegenwärtigen Mainstream der Handelnden. Zum einen muss man den Bürgern gegenüber seiner eigenen politischen Handlungsweise erklären und es auch können, zum anderen muss man mit Fragen rechnen, wie die eigene Tätigkeit der letzten Jahre aussah und auch kritikfähig sein.
Die Doppik zeigt ihre Wirkung. 12 Jahre nach Einführung der Doppik rächen sich nun, dass immer noch keine aktuellen Jahresabschlüsse für die Kommunen vorliegen, sondern lediglich fortgeschriebene Daten auf vorläufigen Rechnungsergebnissen, genauer gesagt angenommenen Planungsdaten. Die Rücklagen der Gemeinden sind aufgebraucht und die liquiden Mittel gehen zur Neige. Über Jahre glaubte man sich in finanzieller Sicherheit durch das zusätzliche Anlagevermögen, das durch die Doppik eingeführt wurde. Das ist jedoch vorbei, jetzt wird deutlich, wer die Finanzstrategie gut umgesetzt hat.
Die Erhöhung der Steuern löst das Problem nicht. Sie verschiebt es nur.
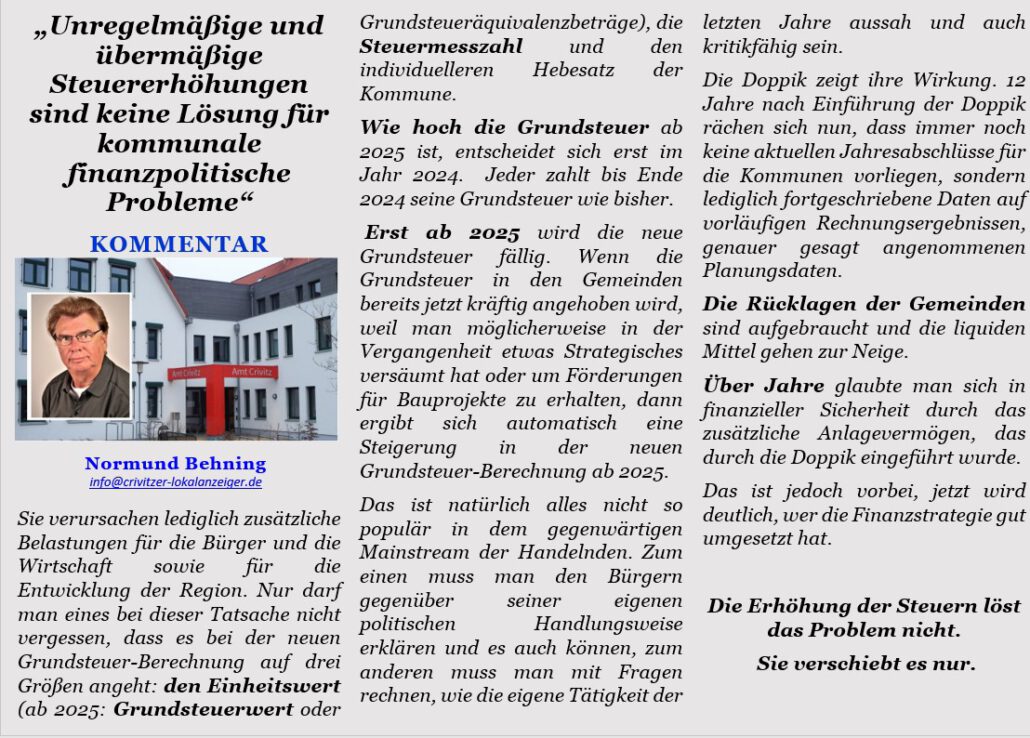
01. März -2024/P-headli.-cont.-red./349[163(38-22)]/CLA-186/24-2024
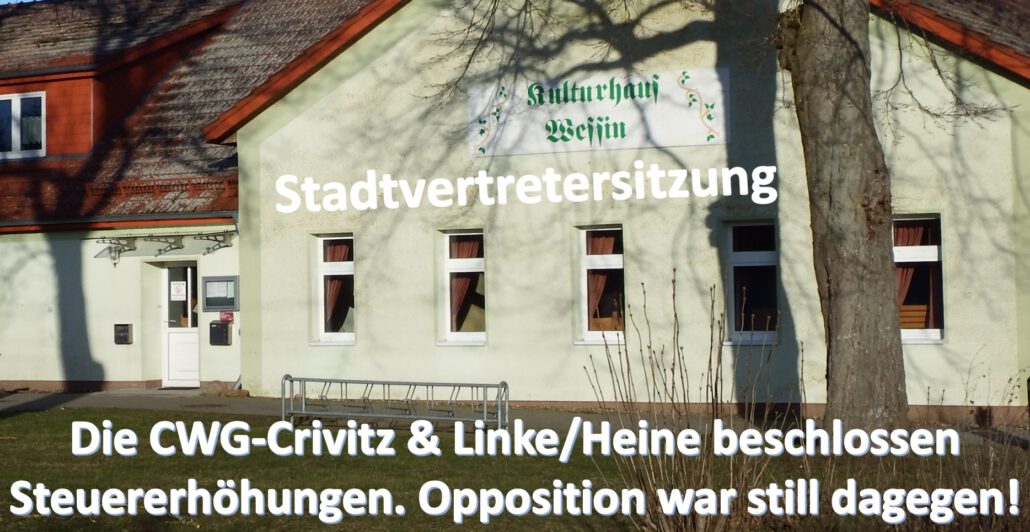
Crivitzer, die sich trotzdem noch für Kommunalpolitik interessieren, werden derzeit auf eine harte Probe gestellt. Die Stadtvertretersitzungen werden immer mehr zu Wiederholungen von Spektakeln, wie seit Jahren.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Haushalt 2024 und die Erhöhung der Steuern ab dem 01.01.2024. Weiterhin wurden Grundsatzbeschlüsse gefasst, die etwa 1,5 Mio. € an Baukosten für die Jahre 2025 bis 2026 binden und somit eine Aufgabe für die neuen Abgeordneten darstellen. So war es auch erstaunlich, dass die CDU-Fraktion Crivitz und Umland erstmals seit etwa 21 Monaten vollständig anwesend war und Frau Beate Werner von der CDU-Fraktion plötzlich wieder ca. 12 Wochen vor der Wahl zu dieser Art der Veranstaltung erschien. Wenn dieses Engagement nun auch noch in den Ausschüssen der Fall ist, könnte man fast meinen, dass die CDU-Opposition bereits 12 Wochen vor der Wahl aus ihrem Winterschlaf erwachte. Möglicherweise sind es die Umfragen, die plötzlich diesen Eifer hervorbringen oder einfach nur der Leistungsdruck!
Der Haushalt 2024 mit den Steuererhöhungen wurde eigentlich recht schnell abgearbeitet. Der Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe der CWG – Crivitz Herr Andreas Rüß und die Fraktion die Linke /Heine argumentierten, dass man bereits in einer Arbeitssitzung darüber gesprochen und alle Fragen ausführlich diskutiert habe und daher keine weiteren Diskussionen wünschte. Es wäre einfacher gewesen, an dieser Arbeitssitzung teilzunehmen und die Fragen zu stellen, anstatt jetzt zu diskutieren.
Das ist schon eine seltsame Argumentation, um andere Meinungen zu verhindern, genauer gesagt abzuwehren, aber dies ist die gelebte Praxis der CWG-Fraktion seit fünf Jahren. Man wolle keine Diskussionen über die Steuererhöhungen führen wegen des Imageverlusts der Wählergruppe CWG + der Linken/Heine vor der Wahl und auch nicht an die Öffentlichkeit bringen. Oje, welch ein Verlust an demokratisches Handeln!
Trotz einiger leiser Anmerkungen und Rechtschreibergänzungen zu dem vergangenen Protokoll sowie einiger kleinen Zwischenbemerkungen beschränkte sich die CDU-Fraktion auf eine namentliche Abstimmung. In der sie dann ganz kategorisch aber auch energisch mit einem hörbaren „NEIN“ antwortete. Das war es dann aber auch, was man von der sogenannten CDU-Opposition hören konnte. Sie hatte entweder keine Vorbereitung auf inhaltliche Argumentationen oder war vielleicht nicht mehr bereit, sie vorzutragen, weil es wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll erschien vor der Wahl. Die Entscheidung, ob diese Methode auch in Zukunft erfolgreich sein wird, obliegt den Crivitzer Wählern in 3 Monaten.
Also beschloss man kurz und fix als Maßnahme für 2024 erneut gegenüber den Bürgern die Hebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen und die Gewerbesteuer für alle Unternehmen ebenfalls. Es ist die vierte Steuererhöhung (2015,2018,2020,2024) in der bisherigen zehnjährigen Dienstzeit der Bürgermeisterin (Frau Britta Brusch-Gamm) mit der Wählergruppe CWG – Crivitz und die Linke/Heine. Ohne Murren und Zaudern wurden die Steuererhöhungen beschlossen, und alle sind glücklich darüber!
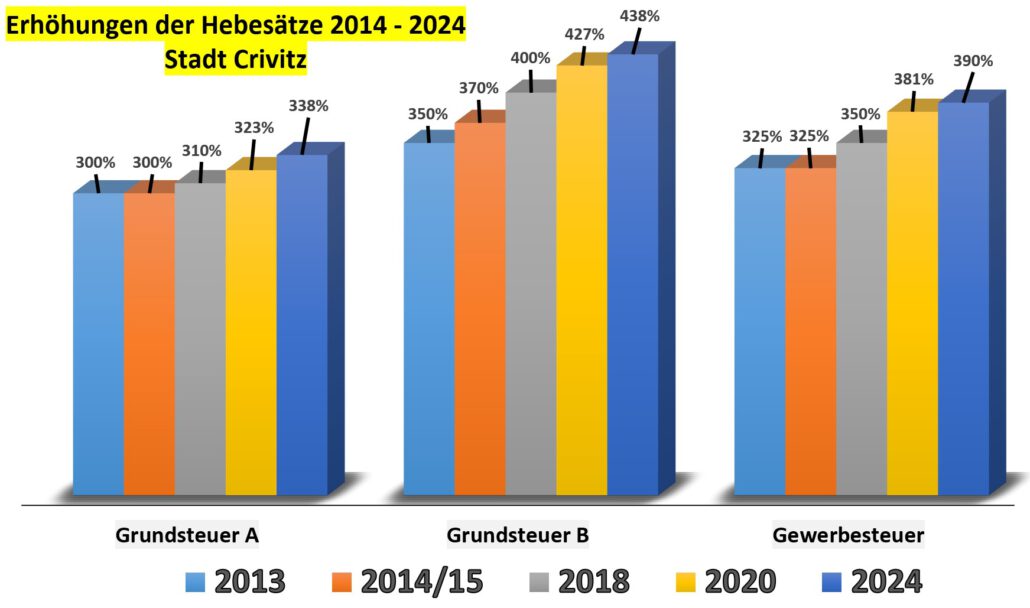
Die Hebesätze werden für die Grundsteuer A) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf 338 % und für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf den Wert von 438 % sowie die Gewerbesteuer auf 390 % angehoben. Das dürfte auch die Mietnebenkosten in Crivitz enorm erhöhen!
Plötzlich und unerwartet kam es erneut zu einer lebhaften Stimmung in der Sitzung, als es darum ging, neue Posten zu besetzen, mit denen man viel Einfluss gewinnen kann. Es sollen zwei Bevollmächtigte der Stadt Crivitz berufen werden, um Verhandlungen mit möglichen Investoren, Energieversorgern, benachbarten Kommunen sowie Fachkräften für regenerative Energieformen zu führen. Diese Bevollmächtigten werden die Interessen der Stadt Crivitz aktiv vertreten und etwaige Entscheidungen für die Stadtvertretung unterstützend vorbereiten. Zuerst wurde eine Unterbrechung gefordert.
Die Fraktion DIE LINKE/Heine konnte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und so bot sich sofort der Fraktionsvorsitzende Herr Alexander Gamm an, die Schlüsselposition zu besetzen. Die Fraktion der CDU wird auch vertreten durch Herrn Jens Reinke und seinen Stellvertreter Herr Joachim Herbert. Herr Alexander Gamm verfügt jedoch über eine so umfassende und allwissende Kompetenz, dass er keinen Stellvertreter benötigt und auch nicht wollte. Es fühlte sich niemand in der Wählergruppe der CWG – Crivitz in der Lage, diese Vertretung an der Seite des linken Fraktionsvorsitzenden zu übernehmen.
Was für ein Schauspiel!
Das Schweriner Theater hätte es bestimmt, in einer späten Abendstunde nicht besser darstellen können!
Kommentar/Resümee
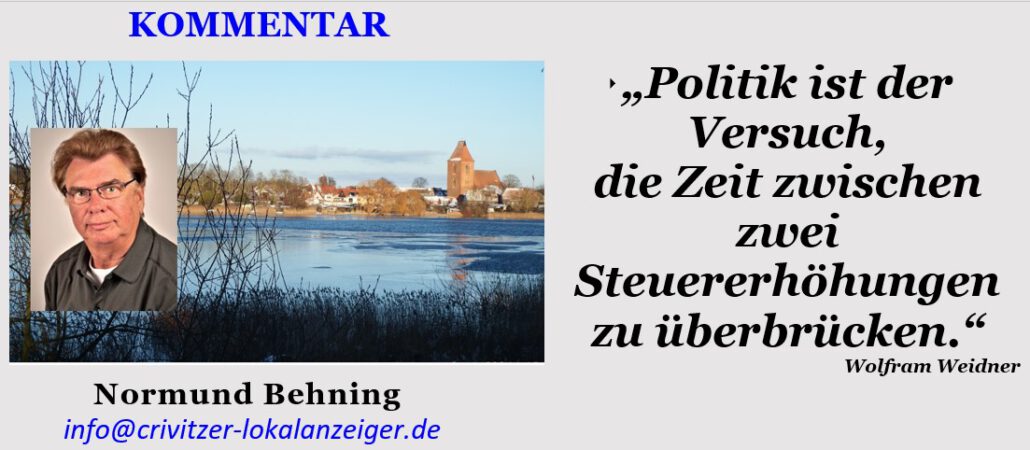
„Politik ist der Versuch, die Zeit zwischen zwei Steuererhöhungen zu überbrücken.“ Wolfram Weidner
Die Fraktion der CWG und die LINKE werden nun gezwungen sein, ihre misslungenen Sparbemühungen als einen Erfolg der finanziellen Lage zu rechtfertigen und als notwendige Investitionen zur Weiterentwicklung der Stadt Crivitz zu präsentieren. Die mehrheitsführenden Fraktionen der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine haben die Ausgaben in jeder Hinsicht mit großer Begeisterung vorangetrieben.
Die CDU – Fraktion Crivitz und Umland hat in der Vergangenheit, wegen des friedlichen Zusammenlebens, diese Belange geduldet und durch eine unzureichende Intervention als größte Oppositionskraft mitgetragen. So, dass die finanzielle Lage so ist, wie sie jetzt ist, und das wird sicherlich auch der Wähler in Crivitz erkannt haben. In der zukünftigen Entwicklung ist es wichtig zu erkennen, dass alle drei Akteure dazu beigetragen haben. Dies ist das Dilemma, das die nächsten Abgeordneten und Parteien ab dem 09. Juni 2024 ausbaden müssen.
Wir sind gespannt, wie die Darsteller der CWG – Crivitz und die LINKE/ Heine und der CDU-Fraktion sich inzwischen neu erfinden und wieder neu präsentieren werden
All das zeigt, die Kommunalwahlen in ca. 12 Wochen sind dringend nötig in der Stadt Crivitz. Neue Bürger, neue Argumente wären nicht das Schlechteste für die Debatten und Entscheidungen!
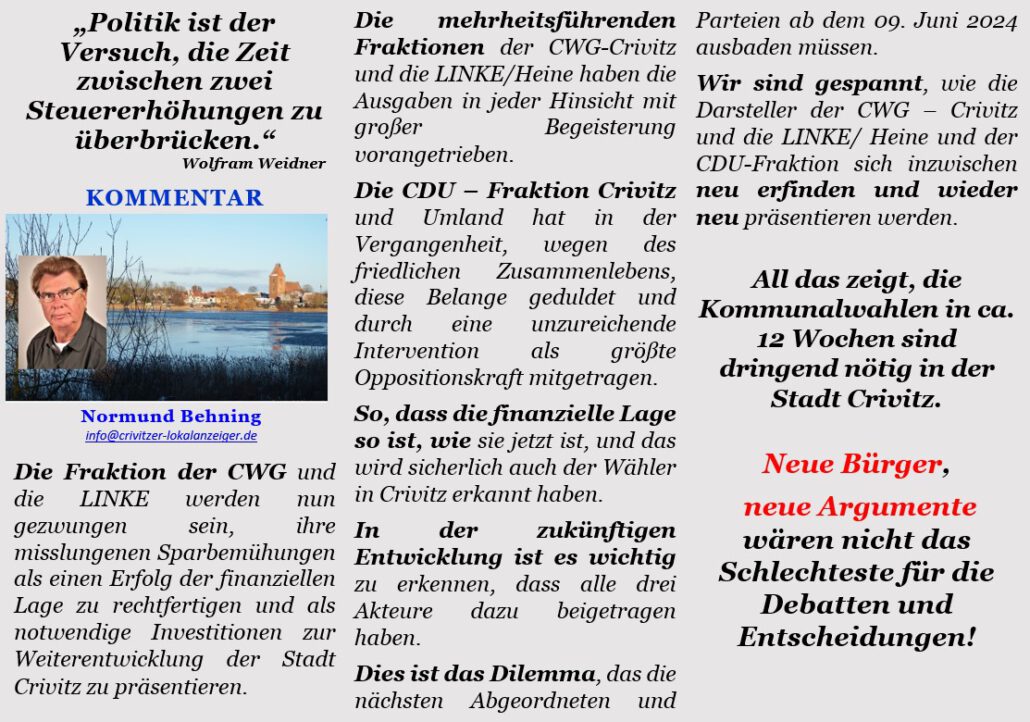
28.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./348[163(38-22)]/CLA-185/23-2024
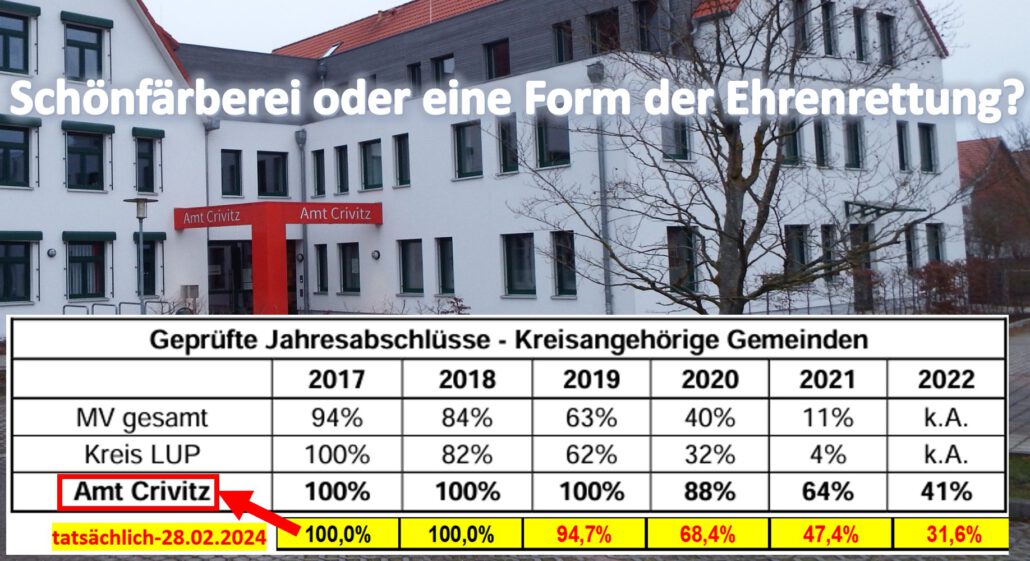
Es ist schon erstaunlich, was die Amtsvorsteherin (Frau Iris Brincker) und ihr Fachbereichsleiter vom Rechnungsprüfungsamt (Herr Michael Rachau) im Jahresabschlussbericht 2023 und Ausblick 2024 an Aussagen so vorlegen. Außer versteckte Hinweise und Andeutungen und eine korrekturbedürftige Erfüllungstabelle mit Hinweis auf eine Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft für das Rechnungsprüfungsamt waren wenig aussagekräftige Inhalte zu lesen.
Erst im Dezember 2023 hat der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Crivitz (Herr Hans-Joachim Merthen) mitgeteilt, dass er ab dem Jahr 2024 nicht mehr für dieses Ehrenamt zur Verfügung stehen wird. Seit 2019 gibt es nur eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses, die vom 14. 11. 2023 datiert ist. Alle anderen Sitzungen, genauer gesagt deren Tagesordnungen, sind im Internet – Nirvana – verschwunden oder werden streng geheim gehalten. In der Informationspolitik des Amtes Crivitz stellt diese Vorgehensweise keine Neuheit dar.
Der Rechenschaftsbericht weist lediglich darauf hin, dass nach der Wahl im Juni 2024 eine inhaltliche oder organisatorische Neuausrichtung der örtlichen Prüfung erfolgen könnte, dass lässt sich jedoch nicht beurteilen. Dies bedeutet, dass es keine genauen Informationen gibt und es wahrscheinlich zu längeren Wartezeiten bei der Bearbeitung der Jahresabschlüsse kommen wird. In diesen versteckten Hinweisen findet man kaum einen Plan oder eine Strategie, das vermisst man bei dieser Vorgehensweise wirklich.
Den Kommunen (17 Mitgliedsgemeinden, das Amt Crivitz + der Schulverband Sukow = 19 Jahresabschlüsse) im Amtsbereich Crivitz fehlt es an aktuellen, *aufgestellten*, *geprüften* und *festgestellten* Jahresabschlüssen von 2019 – 2022 für eine genaue Haushaltsplanung 2024/25! Warum wird in *aufgestellt*, *geprüft* und *festgestellt*, unterschieden? Nun, die Jahresabschlüsse gelten als aufgestellt, wenn sie durch das Rechnungsprüfungsamt erarbeitet wurden. Danach wird in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Crivitz der Entwurf des Rechnungsprüfungsamts geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk verabschiedet. Erst dann können die Gemeinden diesen Entwurf durch einen Beschluss endgültig feststellen.
Der Jahresabschlussbericht 2023 und der Ausblick 2024 des Rechnungsprüfungsamts Crivitz weist wesentliche Fehler in der Darstellung auf. Einige geprüfte Jahresabschlüsse der Kommunen existieren bis jetzt nicht und wurden falsch dargestellt.
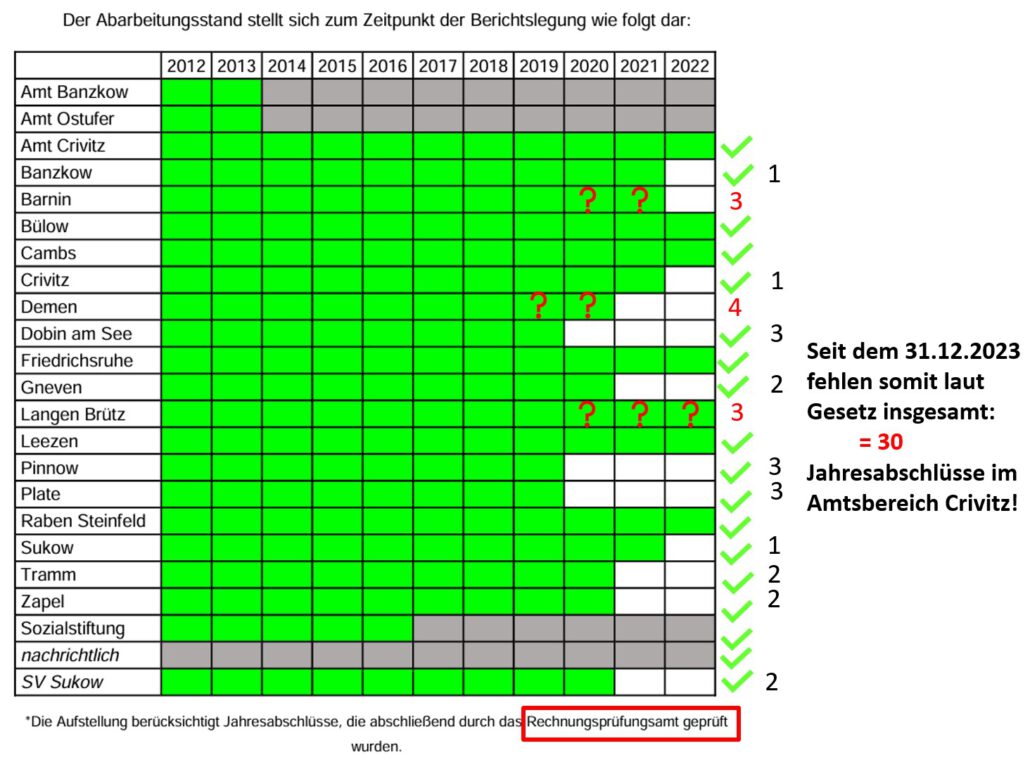
Die obere Abbildung wird aufgezeigt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss angeblich Prüfungen vorgenommen hat, die nicht existieren.Die Haushaltspläne 2024 der Kommunen (in Grün bei den Fragezeichen) zeigen, dass sie diese Jahresabschlüsse nicht besitzen. Auch im ALLRIS – System sind die Jahresabschlüsse in der Darstellung (in Grün bei den Fragezeichen) nicht zu finden!
Der Rechnungsprüfungsausschuss führte seine Sitzungen am 06.03.2023; 04.07.2023; 03.09.2023 und eine Sondersitzung am 14.11.2023 durch, in denen man die tatsächlichen geprüften Jahresabschlüsse nachlesen kann.
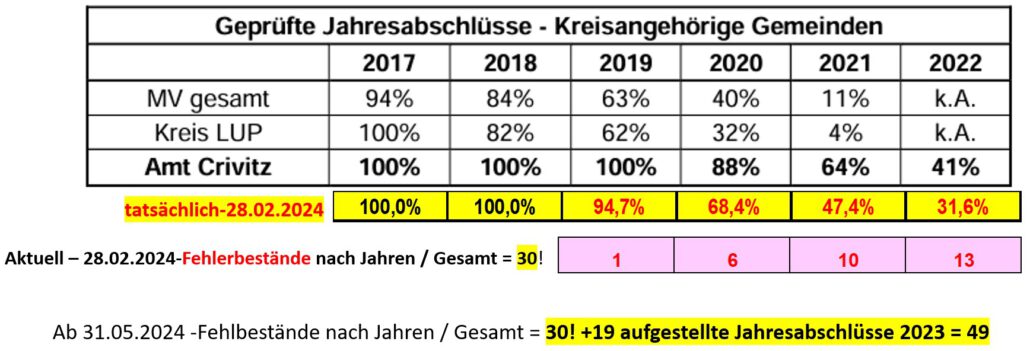
Die Abbildung veranschaulicht, wie sich die erfüllten Prozentzahlen unterscheiden und ein anderes Bild der Aufgabenerfüllung ergibt. Demzufolge fehlen 30 Jahresabschlüsse zum 01.01.2024. Gemäß Kommunalverfassung MV § 60 (4) ist der Jahresabschluss innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres „aufzustellen“.Die Vertretung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres „zu beschließen“.
Auch wenn die Kommunen für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 von einer gesetzlich getragenen Fristverlängerung Gebrauch machen konnten, hätten diese spätestens bis zum 31. Dezember 2021 oder 31. Dezember 2022 festgestellt sein müssen. Sowohl das Gesetz als auch die Verordnung traten mittlerweile außer Kraft. Der Gesetzgeber hat keine weiteren Fristverlängerungen für die Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse gewährt. Demzufolge müssen laut Gesetz seit dem 31.12.2023, die Jahresabschlüsse auch vom Jahr 2021 und 2022 festgestellt worden sein!
„Trotzdem sieht der Landesrechnungshof die rechtswidrigen Zustände bei der Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse mit Sorge. Die Rechtsaufsichtsbehörden sind aufgefordert, auf die Feststellung der Jahresabschlüsse auch mit rechtsaufsichtlichen Mitteln hinzuwirken. Anderenfalls sind fundierte Aussagen zur aktuellen Haushalts- und Finanzlage der Kommunen nicht möglich.“ Teil 2- Kommunalfinanzbericht- 15.12.2023- Landesrechnungshof MV
Auch ein Vergleich mit den Zahlen des Landkreises LUP oder MV kann nicht dazu beitragen, das Desaster zu beschreiben und Gesetzesverstöße zu legalisieren! Hier werden Beamte und Angestellte vom Amtsausschuss für Tätigkeiten bezahlt und die Verantwortlichen viel zu wenig zur Rechenschaftslegung aufgefordert.
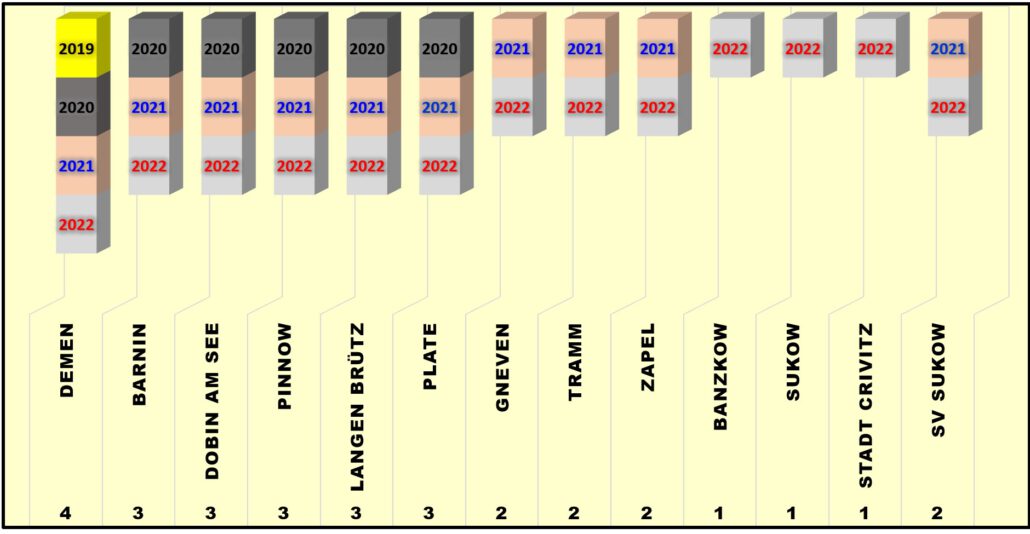
Die Abbildung zeigt die aktuellen Fehlbestände der Jahresabschlüsse – zum Stand am 28.02.2024 im Amtsbereich Crivitz
Nur ein aktueller Jahresabschluss nach dem Gesetz ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit und den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune für die Haushaltsplanungen der Folgejahre zu erkennen. Die Aussagekraft der Finanzplanung bis 2027 in den Haushaltsplänen der Kommunen von 2024 ist schwer zu beurteilen. In einigen Kommunen des Amtes Crivitz muss man sich wirklich sehr sicher sein, dass die nachfolgenden Abgeordneten die Haushaltsführung 2024 ohne Bedenken übernehmen können.
Auch die Aussage im Jahresabschlussbericht 2023 und der Ausblick 2024 des Rechnungsprüfungsamtes Crivitz „Denkbar ist auch eine Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft Rechnungsprüfungsamt“ wurde bereits öffentlich diskutiert. Die Verwaltung des Amtes Crivitz sollte noch vor den Wahlen hierzu Rechenschaft ablegen und die Folgekosten detailliert darstellen. Es ist von Bedeutung, die Bedingungen und Kosten der Überarbeitung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem jetzigen Partner (Amt Hagenow – Land) vor dem Hintergrund der Einführung des § 2b UStG darzustellen und nicht nur angedeutet werden.
Zusammenfassend ist festzustellen: Es ist zu erwarten, dass Bürgerbeschwerden bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landkreis LUP im Jahres 2024 eingehen werden, da diese Handhabungen insgesamt eindeutig Verstöße darstellen.
Kommentar/Resümee
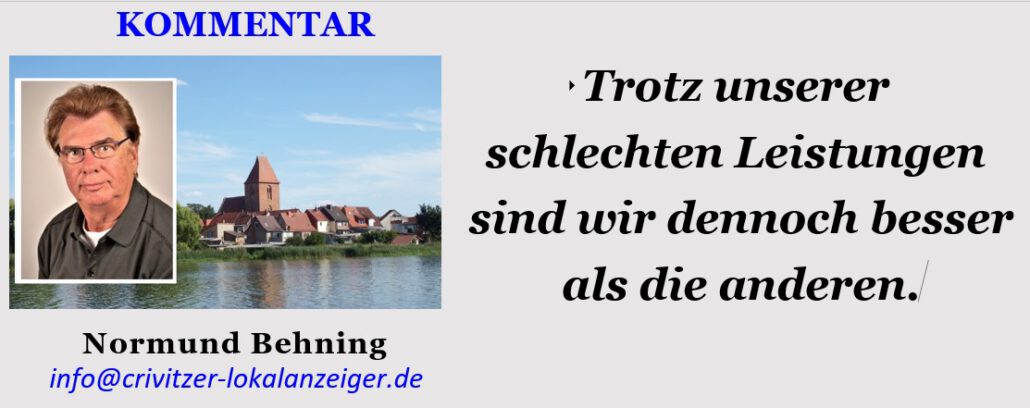
Trotz unserer schlechten Leistungen sind wir dennoch besser als die anderen.
Auch ein Vergleich mit den Zahlen des Landkreises LUP oder MV kann nicht dazu beitragen, das Desaster zu beschreiben und Gesetzesverstöße zu legalisieren! Hier werden Beamte und Angestellte vom Amtsausschuss für Tätigkeiten bezahlt und die Verantwortlichen viel zu wenig zur Rechenschaftslegung aufgefordert.
Es ist und bleibt ein Gesetzesverstoß, wenn die Jahresabschlüsse für 2019 bis 2022 bisher nicht seit dem 31.12.2023 vorliegen! Nur ein aktueller Jahresabschluss nach dem Gesetz ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit und den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune für die Haushaltsplanungen der Folgejahre zu erkennen.
Der Jahresabschluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft nachweisen. Über Jahre fehlende Jahresabschlüsse sind keine FORMALIE, sondern ein Verstoß gegen gesetzlich normierte Haushaltsgrundsätze und lassen Zweifel an der geordneten Haushaltswirtschaft der betreffenden Kommunen aufkommen. Die angestrebte erhöhte Transparenz und qualifizierte Informationsbereitstellung werden nicht erreicht. Wichtige Elemente der kommunalen Doppik kommen nicht zur Wirkung. Die Verwendung eingesetzter Steuermittel wird ohne Jahresabschlüsse nicht transparent nachgewiesen.
Wer entlastet dann die Bürgermeister für geprüfte und Jahre zurückliegende Jahresabschlüsse, wenn sie nicht mehr im Amt sind nach der Wahl im Juni 2024? Wer übernimmt dann die Verantwortung für die zurückliegenden geprüften Vorgänge und die noch verbleibenden liquiden Mittel der Jahresabschlüsse?
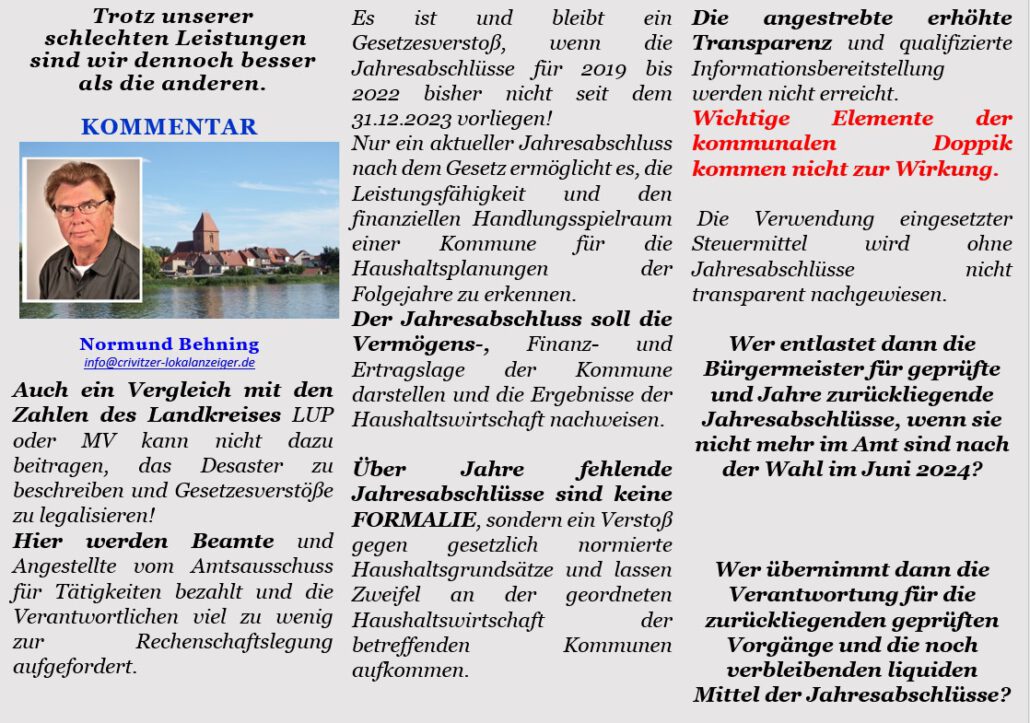
26.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./347[163(38-22)]/CLA-184/22-2024
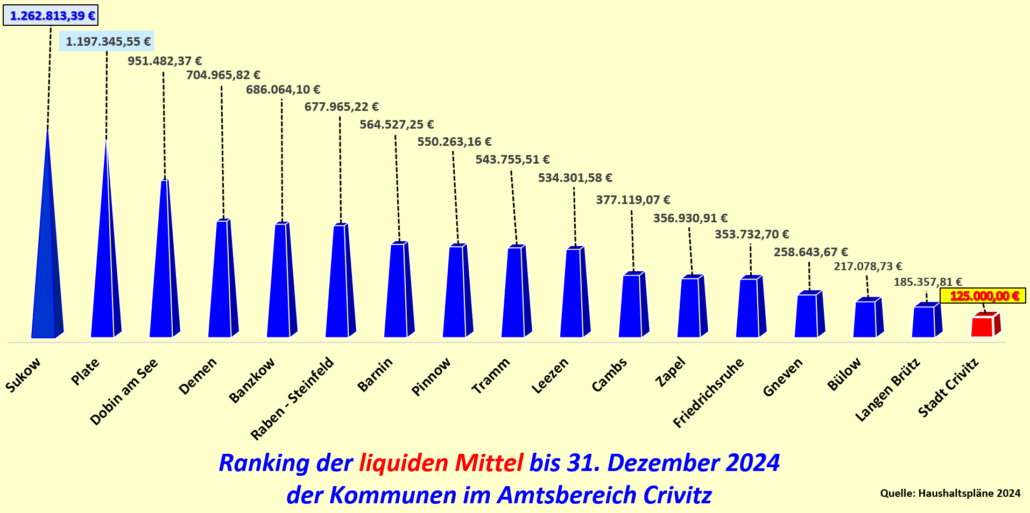
Es gibt keine einfachen Lösungen, um mit Haushaltsmitteln umzugehen.
Als liquide (flüssige) Mittel, Zahlungsmittel oder Finanzmittel wird alles verstanden, was zur Finanzierung dient. Dies sind z. B. Bargeldbestände, Guthaben auf Girokonten, Schecks oder Wechsel.
Liquidität heißt – Können wir uns das leisten? Rentabilität bedeutet – Lohnt sich das? Jeder Mensch ist sich bewusst, dass ein 1 € nur einmal ausgegeben werden kann. Dieser Euro muss irgendwoher kommen, um ausgegeben zu werden. Dies scheint oft nicht klar zu sein, sobald Rathäuser betreten werden. Es scheint, dass Wähler und Wahlbewerber dies rasch vergessen, sobald es um das Geld der Steuerzahler geht.
Auch in Crivitz ist dies der Fall. Die Investitionsquote der Stadt Crivitz liegt seit sieben Jahren bei 140 % bis 400 % und gleichzeitig sind die regulären (fixen Kosten) Ausgaben im Haushalt (Personal, Bauhof, Reinigung, Verwaltung, Bewirtschaftung und geringwertige Wirtschaftsgüter) exorbitant angestiegen. Dies führt zu einer erheblichen Belastung des Finanzhaushalts und verringert die Liquidität und erhöht die Schulden. Durch die Investitionsprojekte von 2018 bis 2025, die sich jährlich auf 17 bis 25 Projekte belaufen, wird auch der Finanzhaushalt der Stadt Crivitz ab dem 31.12.2025 sichtbar in die Knie gezungen.
Es handelt sich nicht mehr um einen Investitionsstau, sondern um bewusstes wirtschaftliches Handeln, das weit über die eigenen Verhältnisse hinausgeht. Die nachfolgenden Abgeordneten werden ab dem 09.06.2024 nur noch wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben, wenn es um eine weite Gestaltung oder die nächsten Jahre geht.
Worin unterscheiden sich die Gemeinden in Sukow und Plate von den anderen Gemeinden?
Die Sache ist ganz einfach. Die Gemeinde Plate hat zum Beispiel über Jahre positive Jahresabschlüsse bis 2022 vorzuweisen und der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug 6.849.223 €. Bei diesem Betrag kann man auch kräftig investieren und das tut die Gemeinde im Jahr 2023/24 auch. Sie hat immer noch einen positiven Saldo am 31.12.2024 und der Saldo beträgt 3.983.623 €. Hier hat man mit Bedacht gehandelt und genügend finanzielle Mittel für Investitionen folgerichtig bereitgestellt. Man kann das auch jetzt bezahlen. Auch in der Gemeinde Sukow ist die Situation ähnlich.
Der § 43 der Kommunalverfassung (KV) enthält den Haushaltsgrundsatz: Grundsatz der Sicherstellung der Liquidität. Dieser Grundsatz (§ 43 Abs. 2) verlangt von jeder Gemeinde, auch eine Geldflussrechnung (Finanzhaushalt, § 46 Abs. 4 Nr. 2 KV) durchzuführen und darüber jederzeit die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die Handlungsfähigkeit einer Gemeinde hängt stark von deren Liquidität ab, da die Bedarfsdeckung überwiegend durch direkte oder indirekte Zahlungsvorgänge bewerkstelligt oder veranlasst wird. Bevor Investitionsvorhaben begonnen werden, muss die Finanzierung gesichert sein.
Im Zuge der Haushaltsdurchführung muss die Gemeinde darüber wachen, dass die den Plänen zugrunde liegenden Einzahlungserwartungen, die die Auszahlungsplanungen erst rechtfertigen, tatsächlich realisiert werden können. Ist absehbar, dass geplante Einzahlungen in einem für die Finanzierung der Investition notwendigen Umfang nicht erzielbar sind, darf die Investition nicht begonnen werden, solange die Deckung des Finanzierungsbedarfes nicht aus anderen Quellen gesichert ist.
Kommentar/Resümee
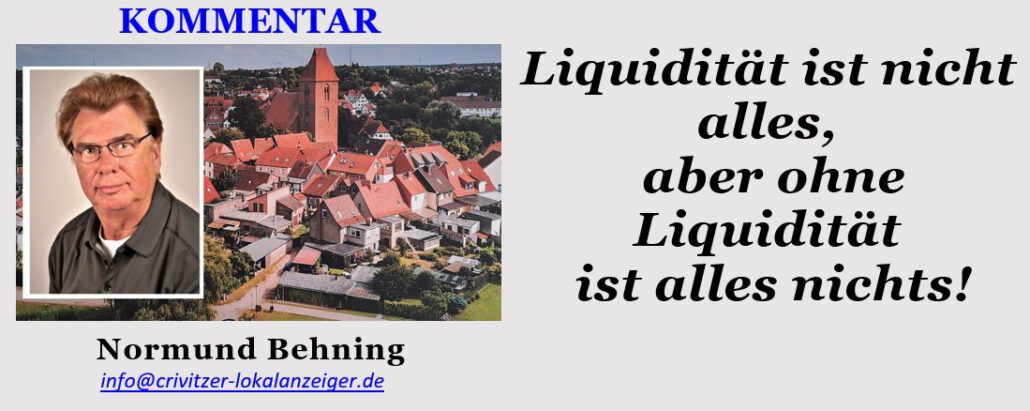
Liquidität ist nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts.
Der Grundsatz der Generationengerechtigkeit (§ 43 Abs. 1 KV) stellt einen entscheidenden Grundsatz in der Haushaltsführung dar. Wie viel Last (Steuern, Gebühren, Schulden) kann man den nachfolgenden Generationen zumuten? Die Kredite der vergangenen Jahre belasten die kommenden öffentlichen Haushalte durch erhebliche Zinslasten und Tilgungspflichten. Damit werden in Zukunft Steuern für öffentliche Güter und Leistungen erhoben, deren Nutzen in der Vergangenheit liegt. Diese Situation ist ungerecht gegenüber den Generationen. Es ist wichtig, dass jede Generation nur das verbraucht, was sie selbst erwirtschaftet. Es darf keine Lasten auf die kommenden Generationen verlagert werden.
Es wäre ratsam, die noch gewählten Stadtvertreter in Crivitz zu sensibilisieren, dass sie nicht nur auf Sicht planen, sondern auch mit einer aufgesetzten Brille eine lange Zeit planen.
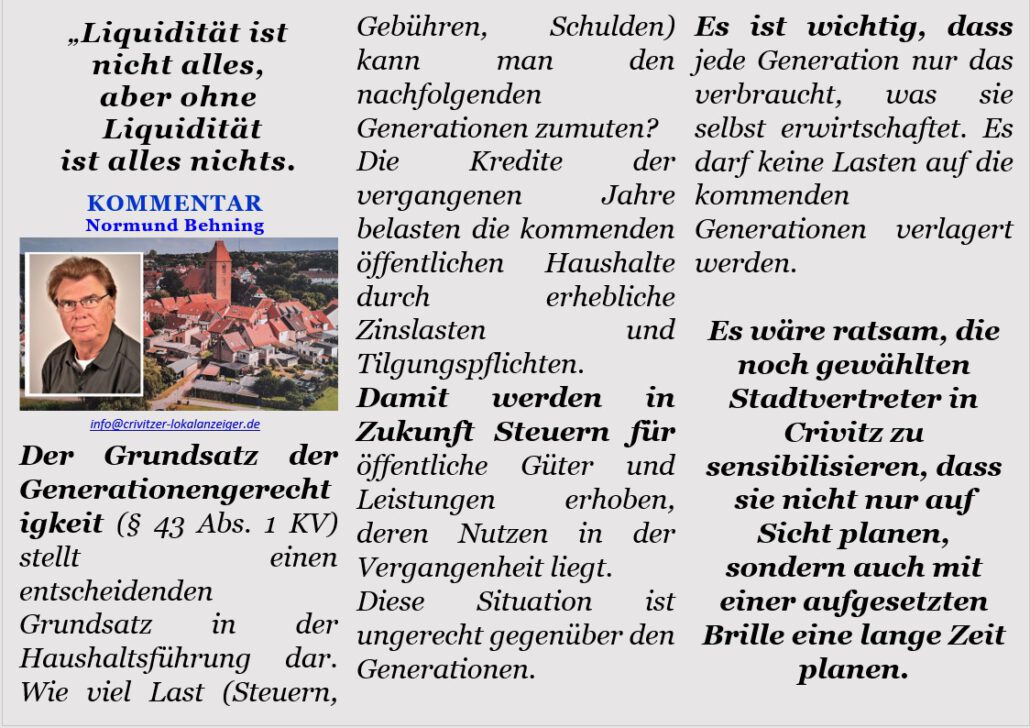
24.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./346[163(38-22)]/CLA-183/21-2024
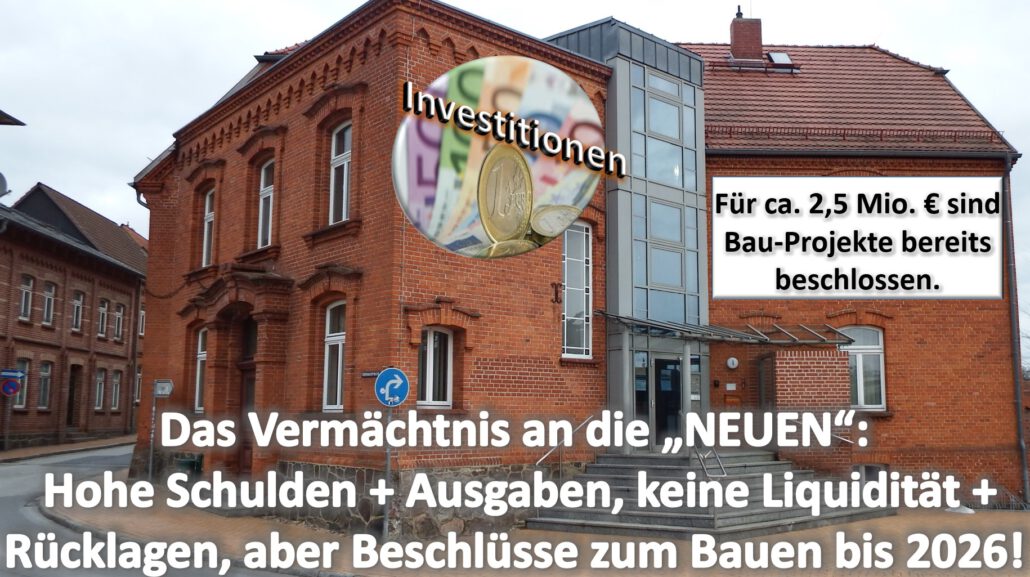
Während bundesweit die steigenden Baupreise und Bauzinsen, die Lieferengpässe und die erhebliche Verschärfung der Finanzierungsbedingungen die Investitionstätigkeit belasten, befindet sich die Stadt Crivitz auf einem gänzlich anderen Kurs.
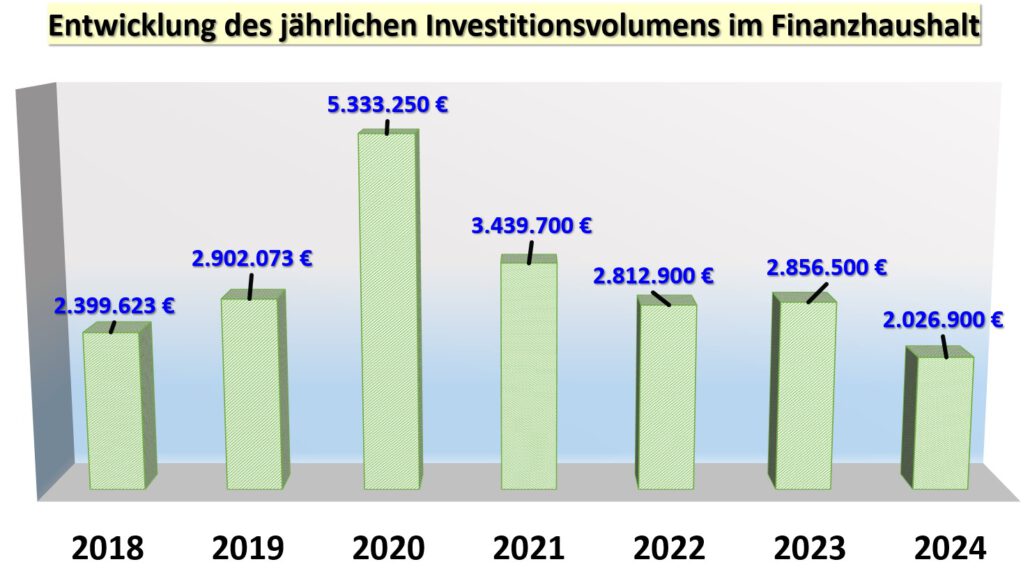
Folgende Investitionen wurden für 2024 beschlossen:
– Kauf Grundstück für Regenrückhaltebecken OT Wessin= 17.000 €;
– Planung Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen, Lindenallee= 30.000 €;
– FFW Crivitz-Fahrzeug (TLF16/25) = 320.000 €;
– FFW Crivitz – Beschaffung der LF 20=480.000,00 €;
-FFW Crivitz-LF 20 Rüstsatz=30.000 €;
-FFW Crivitz -Schlauchpflegesystem=60.000 €;
-FFW Crivitz -Planung Fahrzeughalle=30.000 €;
– Erneuerung Sportplatz Grundschule=500.000 €;
– Regionale Schule – Server = 10.000 €;
– Regionale Schule-Brandschutz 1. Bauabschnitt = 237.000 €;
– Kita Wessin-Schaukel-/ Rutschkombination=12.400 €;
– Spielplatzgeräte Neustadt= 15.000 €;
– Regenwasser -Goldberger Straße & Eichholzstraße samt Gehweg=40.000 €;
– Parkplatz ehemaliger Sparmarkt am Markt= 125.000 €;
– Grabendurchlass Settiner Weg=10.000 €;
– Anschaffung GWG bis 1000 € =117.200 €;
Folgende Investitionen sind für 2025 in der Planung:
– Bauhof Crivitz-Anschaffung Baufahrzeug = ca. 145.000 €;
– Bauhof Crivitz – Anschaffung Transportfahrzeug = ca. 60.000 €;
– FFW Crivitz – Anschaffung -Einsatzleitwagen = ca. 155.000 €;
– Bauhof Crivitz-Erneuerung der Heizvorrichtung = ca. 55.000 €;
– Löschteich Wessin ca. 30.000 €;
– Kreativhaus (Sanierung) = ca. 200.000 €;
– 2. Ausfahrt Gewerbeallee = ca. 120.000 €;
Folgende Investitionen sind bereits beschlossen ab 2025:
– FFW Crivitz – Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses mit Schlauchturm= 917.000 €;
– Straßensanierung Gewerbeallee= ca. 240.000 €;
-3. BA Ortsdurchfahrt ca.= 360.000 €;
– Regionale Schule-Brandschutz 1. Bauabschnitt=235.000,00 €.
Folgende Investitionen sind bereits beschlossen ab 2026:
– barrierefreie Erschließung und Umgestaltung des Eingangsbereiches für die Regionale Schule =464.200,00 €;
-Fassadensanierung inkl. Windfänge und Einbau außen liegender Sonnenschutz für die Regionale Schule = 366.700,00 €.
Offen sind dagegen die Planungen der Investitionen ab 2027:
– Regenentwässerung Parchimer Straße =ca. 130.000 €
– Umbau und Neubaugestaltung Marktplatz in Crivitz= ca. ???Mio.€€
-Erschließung des Gebiets B-Plan Trammer Straße (Vogelviertel) für neue Wohnhäuser ca.=500.000 €
-Neue 2. Zufahrt als „Bahn-“ Überführung oder Übergang für das Vogelviertel = ca. 1,3 Mio. €
-Erschließung – B-Plan „Auf dem Mühlenberg“ + neue Wohnbauflächen = ca. 360.000 €.
Hier hat man wahrscheinlich heimlich eine Glaskugel und kann in die Zukunft schauen bis 2027 oder will auf den letzten Meter alles ausgeben, bevor sich vielleicht im Juni 2024 die Mehrheitsverhältnisse im Stadthaus ändern könnten!
Die Investitionsquote 2018 betrug 290 %, 2019= 335 %, 2020 = 381 %, 2021 = 185 %, 2022= 276 %, 2023= 310 % und 2024= ca. 140 %. Die Prognose für 2025 liegt nur bei ca. 130 % nach den vorliegenden Ermächtigungen und weiterführenden Planungen aufgrund der mangelnden Liquidität.
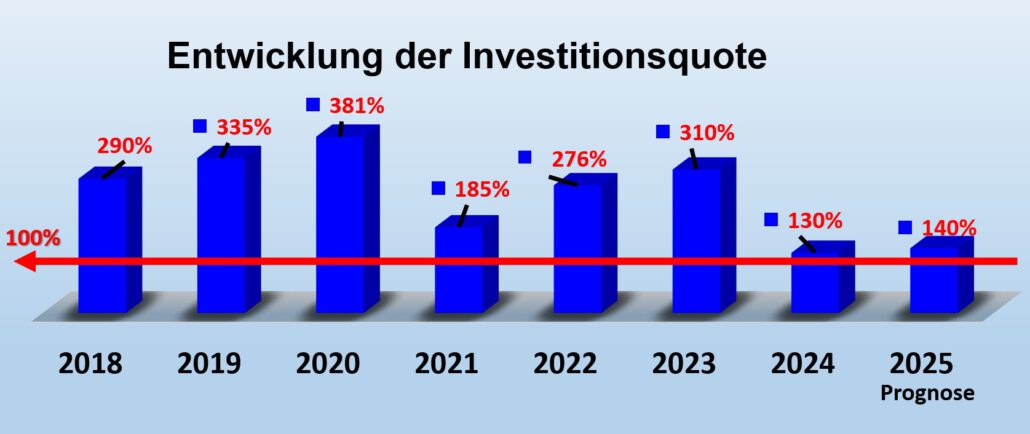
Diese hohen Investitionsquoten an Investitionen der letzten sieben Jahre decken nicht nur den Wertverlust des Anlagevermögens ab, sondern sind weit über die reine Substanzerhaltung hinausgegangen. Um den Wertverlust des Anlagevermögens auszugleichen, sollte die Investitionsquote im Idealfall nur 100 % betragen, da die steigenden Abschreibungen in der Haushaltsführung der Stadt Crivitz erwirtschaftet werden müssen.
Die erhöhten Abschreibungen auf die überdurchschnittlichen Investitionen werden den Ergebnishaushalt der Stadt Crivitz in den kommenden Jahren zusätzlich belasten.
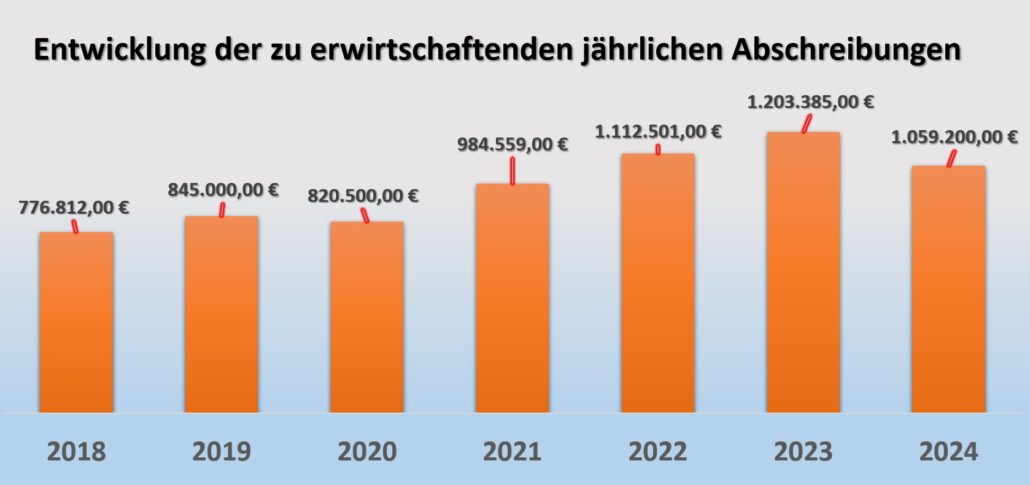
Die Investitionsprojekte von 2018 bis 2024, die sich jährlichen auf 17 bis 25 Projekte belaufen, werden auch den Finanzhaushalt der Stadt Crivitz ab dem 31.12.2025 in die Knie zwingen.
Es handelt sich nicht mehr um einen Investitionsstau, sondern um ein wirtschaftliches Handeln über die eigenen Verhältnisse hinaus.
Resümee/ Kommentar
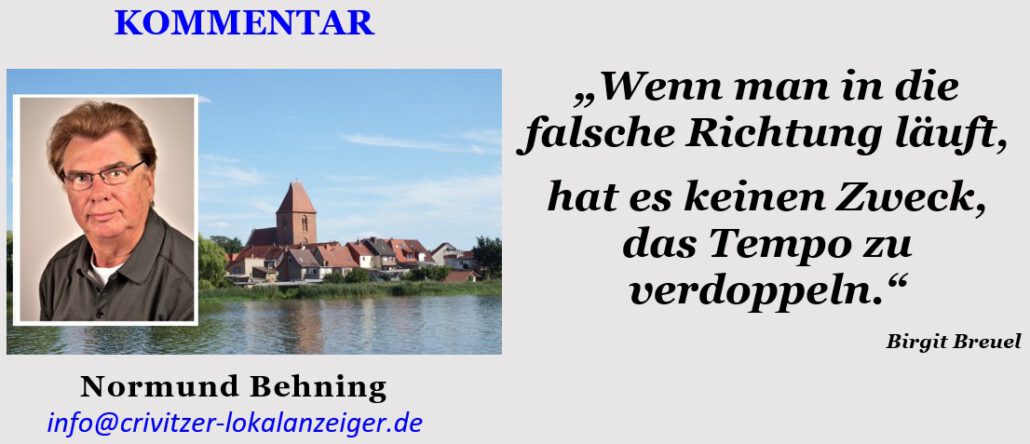
„Wenn man in die falsche Richtung läuft, hat es keinen Zweck, das Tempo zu verdoppeln.“ Birgit Breuel
Es soll das entscheidende Bauboomjahr für den Wahlkampf 2024 werden, um sich Monumente für die Ewigkeit zu errichten. Seit sieben Jahren liegt die Investitionsquote der Stadt von 140 % bis 400 % und gleichzeitig sind die regulären Ausgaben im Haushalt (Personal, Bauhof, Reinigung, Verwaltung, Bewirtschaftungen) exorbitant gestiegen. Dies führt zu einer enormen Belastung des Finanz- und Ergebnishaushalts und mindert die Liquidität und erhöht die Schulden.
Die nachfolgenden Abgeordneten werden daher ab dem 09.06.2024 nur noch wenig Möglichkeiten haben für eine weite Gestaltung für die nächsten Jahre. Durch diese Herangehensweise geht jeder öffentliche Haushalt eines Tages in die Knie und das wird ab dem 31.12.2025 in der Stadt Crivitz vollständig der Fall sein.
Außer Bauvorhaben zu planen und mit Vergabeverfahren die determinierte einheimische Unternehmerschaft wohlwollend zu fördern und zusätzlich die Steuern zu erhöhen, um diese dann mit vollem Einsatz auszugeben, gab es keine weiteren nennenswerten Initiativen von CWG -Crivitz und die LINKEN / Heine außer Ankündigungen. Oder sich dann in den folgenden Baueinweihungen sichtbar zu spiegeln. Steuergelder vollmundig ausgeben, um damit zu glänzen, kann wirklich jeder. Allerdings bleibt jedoch die Frage, was nach fünf Jahren bleibt. In unserem Fall sind es hohe Schulden und Ausgaben, jedoch keine Liquidität und Rücklagen mehr, doch der Wunsch, noch mehr zu bauen und auszugeben!
Die Mehrheitsfraktionen von CWG – Crivitz und die LINKE/Heine wollen ihre Baupläne umsetzen, ungeachtet aller Bedenken und Folgen für die Entwicklung und gefährden damit die finanzielle Existenz von städtischen Einrichtungen für die Zukunft. Die nachfolgende Generation sollte nicht nur für Zins und Tilgung arbeiten, sondern auch eine Gestaltung und Ausgestaltung ihres Umfeldes vornehmen können. Dies wird ihnen durch die aktuellen Planungen für die Folgejahre genommen.
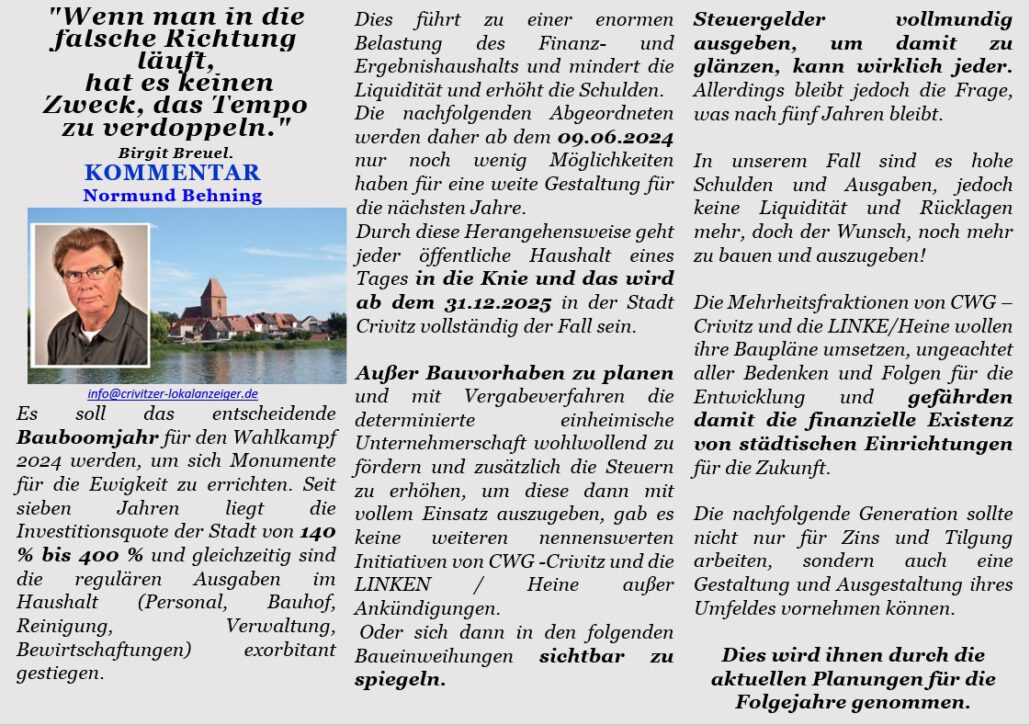
22.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./345[163(38-22)]/CLA-182/20-2024

Man könnte es auch als Schlussverkauf bezeichnen; alles muss raus, bevor die Mehrheitsverhältnisse ab Juni 2024 möglicherweise verändert werden könnten.
Die siebente drastische Erhöhung der Ausgaben der Stadt Crivitz in Folge (seit 2017 bis 2024) deutet darauf hin, als ob es keine Krisen, Inflations- und Zinsanstiege auftreten würden. Man scheint tatsächlich weit entfernt von der Realität zu sein, oder man hat es nicht verstanden, wie man mit den anvertrauten Steuermitteln umgeht.
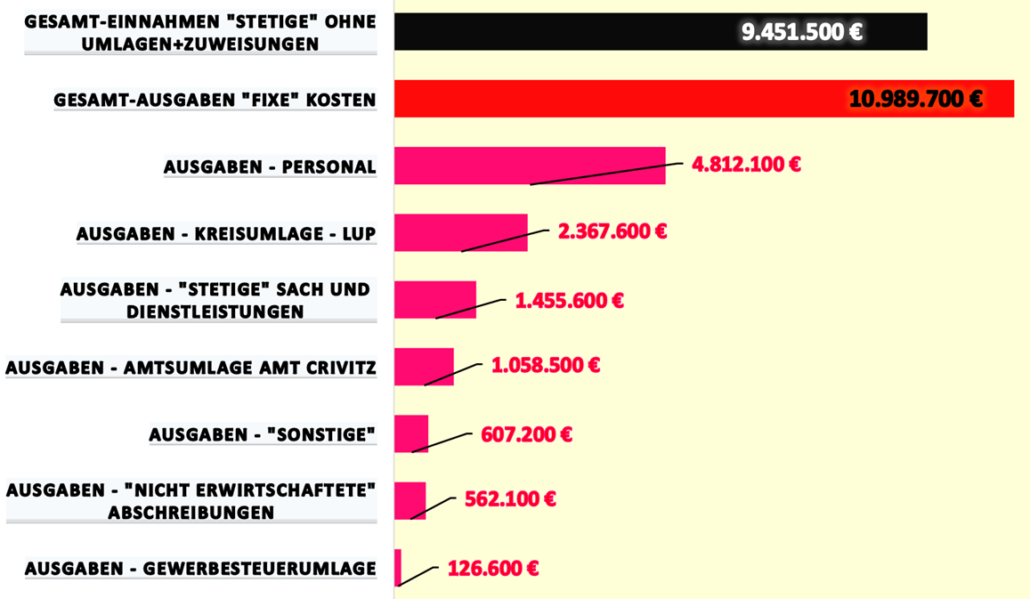
Trotz steigender Schlüsselzuweisungen vom Land MV (2019 = 1.311.136 €; 2024= ca. 2.082.000 €) und drastisch steigender Steuereinnahmen (2019= 3.595.059 €; 2024= 3.926.600) gelingt es der Stadt Crivitz nicht, ihre Kosten zu bewältigen.
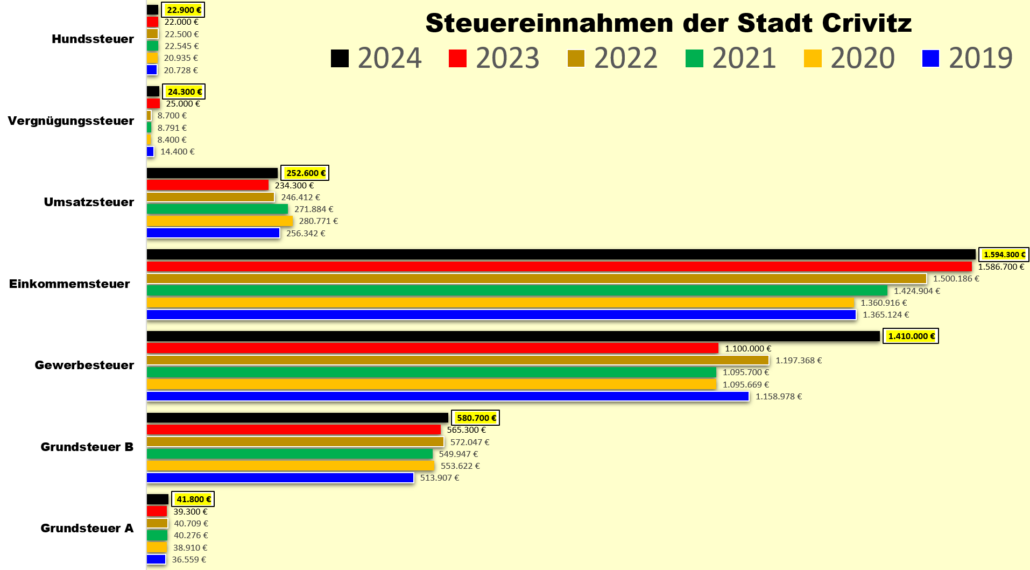
Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein Defizit von -1.150.900 € auf und im Finanzhaushalt 2024 besteht ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -676.000 € sowie ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -859.400 €.
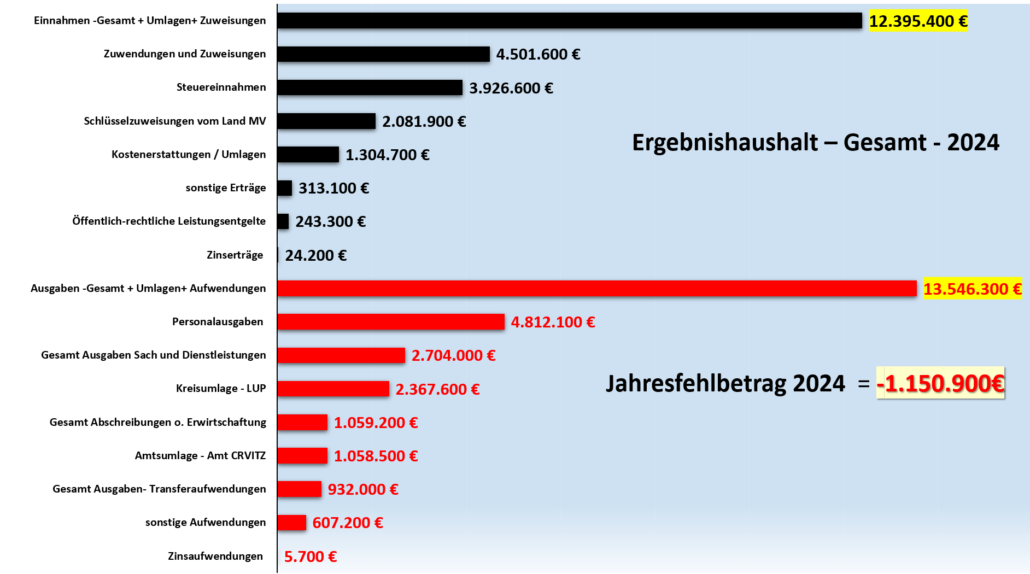
Die größten Ausgaben sind die Personalaufwendungen und der damit verbundene neue Stellenplan, da es sich hierbei nicht um einmalige Ausgaben handelt, sondern um wiederkehrende und stetig wachsende Ausgaben. Seit dem Jahr 2014 sind die Personalaufwendungen um ca. 114 % gestiegen, von 2.253.100 € im Jahr 2014 auf ca. 4.812.100 € im Jahre 2024. Hinzu kommen die sonstigen Personalnebenkosten in Höhe von 34.300 € sowie die Auszahlungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 41.500 €. Daraus ergibt sich eigentlich ein Gesamtbetrag von 4.888.000 €.
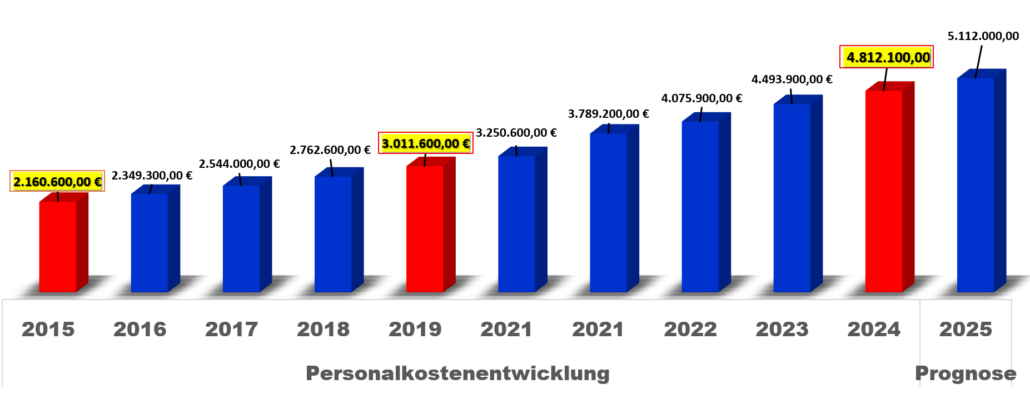
Aufgrund der baldigen Tarifverhandlungen ab November 2024 und der anstehenden Leistungsverhandlungen sowie durch die Reduzierung der tariflichen Wochenarbeitszeit auf durchschnittlich 38,5 Stunden ab 01.01.2025 pro Woche wird mit einer weiteren Steigerung der Personalkosten bis auf ca. 5,112 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet. Die Diskrepanz in der Verteilung der Erträge für die Aufwendungen nimmt der Stadt Crivitz in Zukunft ab 2025 weiter deutliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Stellenplan der Stadt für das Jahr 2024 sieht einen Zuwachs gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2023 in einem Umfang von insgesamt 4 weiteren Stellen vor. Insgesamt werden 122 Stellen besetzt sein. Von 2014 bis 2024 hat sich der Personalbestand um ca. 80 % erhöht. Im Jahr 2014 waren es 68 Mitarbeiter, während es im Jahr 2024 bald 122 Mitarbeiter sein werden.
In der Gebäudereinigung arbeiten mittlerweile 20 Mitarbeiter, +1 Reinigungshelferin. In den Bauhöfen sind es 10 Mitarbeiter + 6 Sportstättenwarte, +1 Friedhofswart + 1 Gerätewart FFw, + 9 Hausmeister. Neue zusätzliche Stellen entstehen: 1x Reinigung, 1x Hausmeister, 1x Aushilfe für Seniorenarbeit und 2 Azubis.
Zum sogenannten Bürgerhausteam gehören jetzt bereits 8 Mitarbeiter, die persönlich die Bürgermeisterin unterstützen. Das sind die Stadtkoordinatorin und zwei Museumshilfskräfte (eine Vollzeit + 30H Teilzeit) und eine Aushilfe Seniorenarbeit. Zu diesem Team gehören auch eine Bibliotheksmitarbeiterin und drei Aushilfen für die Bibliothek.
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht zielführend, dass die Repräsentationskosten im Gegensatz zu 2021 (ca. 39.000 €) nun im Jahr 2024 voraussichtlich 68.700 € betragen werden, wovon allein die Bürgermeisterin (Frau Britta Brusch-Gamm; Wählergruppe CWG – Crivitz) 10.000 € zur Verfügung hat. Des Weiteren sind auch darin enthalten die Repräsentationen ca. 14.500 € der Feuerwehren, das Stadtfest ca. 18.000 € und das Bürgerhaus ca. 8000 € sowie 42.800 € der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Die Prioritäten verdeutlichen, welche Ziele man sich in den letzten drei Monaten der Amtszeit gesetzt hat, um zu glänzen. Es scheint, als ob bereits jetzt Gelder an alle Stellen fließen, die für die Gewinnung von Wählerstimmen wichtig sind.
Also beabsichtigt man jetzt als erste Maßnahme für 2024, um haushaltspolitisch gegenzusteuern, erneut gegenüber den Bürgern die Hebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen und die Gewerbesteuer für alle Unternehmen ebenfalls.
Die drastische Anhebung der Steuersätze ist nicht geeignet, die bevorstehenden finanziellen Schwierigkeiten zu lösen. Diese Handhabung ist zu einseitig da sie auch die Betriebskosten und somit die Mieten erhöht. Es erschwert zudem die Lebensbedingungen der Bevölkerung im ländlichen Raum.
Kommentar/Resümee
Das verflixte siebte Jahr! Wer soll das Ganze in der Zukunft bezahlen?
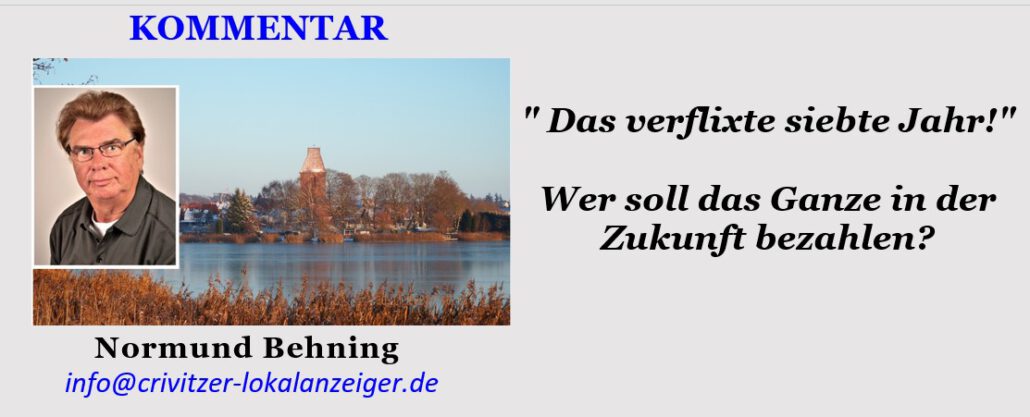
Eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Haushaltspolitik für die nächste Generation und für die neue Wahlperiode ab 2024 sieht anders aus. Die Fraktion CWG – Crivitz feiert sich im Ausgabenrausch im Haushalt 2024 und setzt Schwerpunkte in den Ausgaben bereits für bestimmte Wählergruppen, um ihre Stimmen im Vorwahlkampf 2024 zu festigen. Die erneute Erweiterung des Stellenplans auf 122 Mitarbeiter ist eine wahltaktische Maßnahme, die gezielt auf Wählergruppen abzielt, die man gewinnen möchte. Diese Maßnahmen werden jedoch mit Steuergeldern finanziert!
Die Fraktion DIE LINKE/ HEINE beobachtet dieses Geschehen aufmerksam und profitiert ebenfalls davon. Die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) hat hierzu noch kein Konzept, zumal sie aufgrund ihres guten Willens in der Entscheidung gefangen ist.
Seit Jahren wirtschaftet die Stadt Crivitz über ihre finanziellen Verhältnisse und plant für die kommenden Jahre Defizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt, was unserer gegenwärtigen finanziellen Lage nachteilig ist.
Durch dieses Erbe wird es für die zukünftigen Abgeordneten und Generationen eine große Herausforderung sein, dies zu kompensieren.
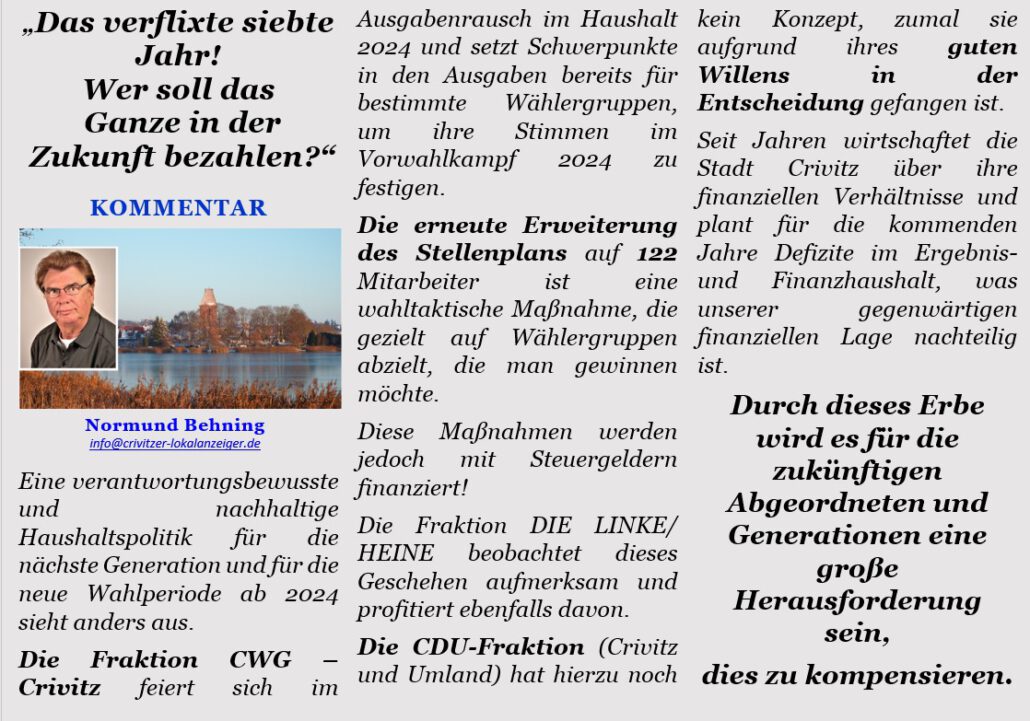
20.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./344[163(38-22)]/CLA-181/19-2024
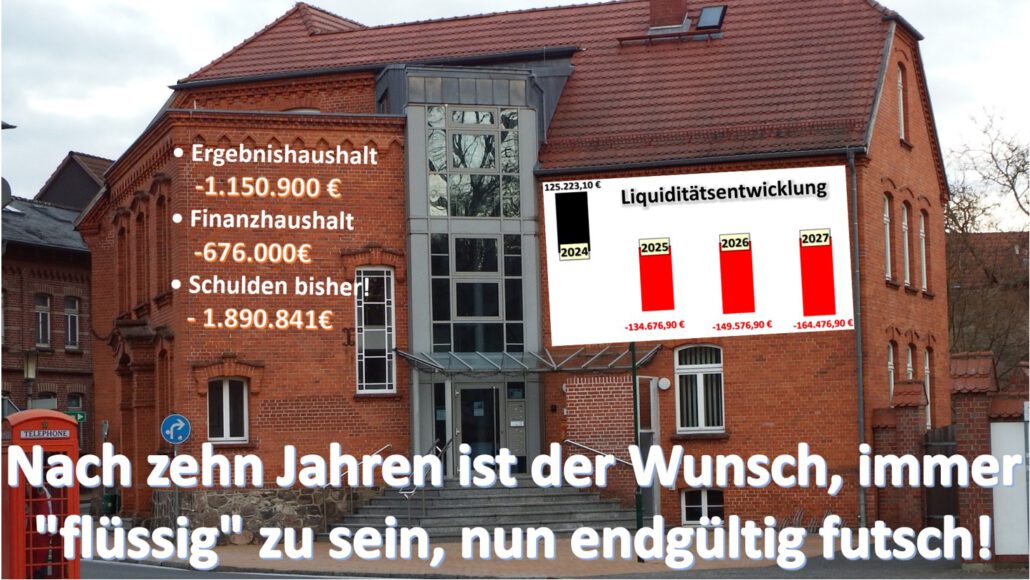
Die irrwitzige Argumentation der Wählergruppe CWG-Crivitz und der LINKEN / Heine seit Jahren, dass man keine Gewinne oder Rücklagen haben muss, sondern gerade nur so viel tun muss, damit alles im Haushalt mehr oder weniger passt. Da ja ab dem 01.01. jedes Jahres das Land die Kasse in Crivitz wieder genügend auffüllt. So führt diese Herangehensweise im Jahr 2024 zu sofortigen Steuererhöhungen in den Grund- und Gewerbesteuern sowie zur Aufnahme eines Kredits zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.190.000 € aufgrund eines Defizits von -1.535.400 € im Finanzhaushalt. Die Stadt Crivitz belegt den 17. Platz unter den 17 Gemeinden im Amtsbereich Crivitz, was die Höhe der liquiden Mittel bis zum 31. Dezember 2024 betrifft.
Trotz steigender Schlüsselzuweisungen vom Land MV seit 2019 und drastisch steigender Steuereinnahmen gelingt es der Stadt Crivitz nicht, ihre Kosten zu bewältigen. Diese Vorgehensweise der Mehrheitsfraktionen (CWG-Crivitz und der LINKEN / Heine) hat die Stadt Crivitz finanzpolitisch seit fünf Jahren zu dem gemacht, was sie heute ist. Ab dem 31.12.2024 können nur noch eingeschränkte Handlungen durchgeführt werden, da die Stadt Crivitz lediglich noch 125.000 € Liquidität besitzt.
Die Jahresabschlüsse für Crivitz liegen nur für das Jahr 2021 vor; sämtliche nachfolgenden Daten im Haushaltsplan 2024 basieren hauptsächlich auf fortgeschriebenen Rechnungsergebnissen oder kumulierten Ergebnisvorträgen sowie angenommenen Planungsdaten bis 2027. Aber, aufgrund der verbesserten Fortschreibungsergebnisse über die Jahre ist es nun möglich, einen realistischen Wert und Aussagekraft in der Finanzanalyse für die Gegenwart und die Zukunft bis 2027 der Stadt Crivitz zu ermitteln. Kurz und knapp, die Salden und Einschätzungen sind sehr realistisch dargestellt im Haushaltsplan 2024.
Der Ergebnishaushalt für 2024 weist ein Defizit von -1.150.900 € aus und wird bis zum Jahr 2027 um weitere – 2.467.600 € anwachsen. Daraus ergibt sich, dass die zweckgebundene Kapitalrücklage ab 2024 nur noch 55,58 € beträgt und die allgemeine Kapitalrücklage 206.758 €. Doch die allgemeine Kapitalrücklage wird am 31.12.2025 lediglich nur noch 58,66 € betragen.
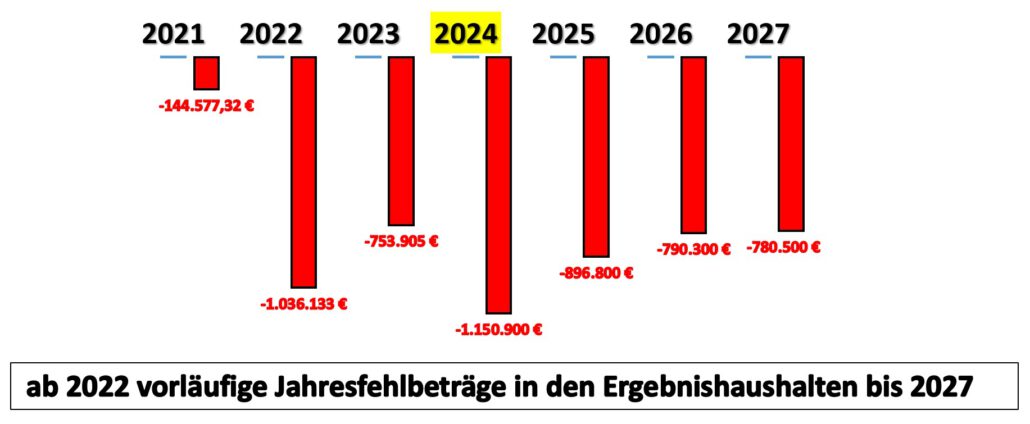
Im Finanzhaushalt biete sich noch ein viel düsteres Bild, so beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, gemindert um die jährliche Schuldentilgung, am 31.12.2024 ein positives Ergebnis in Höhe von 676.802 €. Nur 300 Tage später, am 31. Dezember 2025, beträgt die Differenz lediglich noch -140.197 € und wird bis 2027 auf -499.897 € ansteigen.
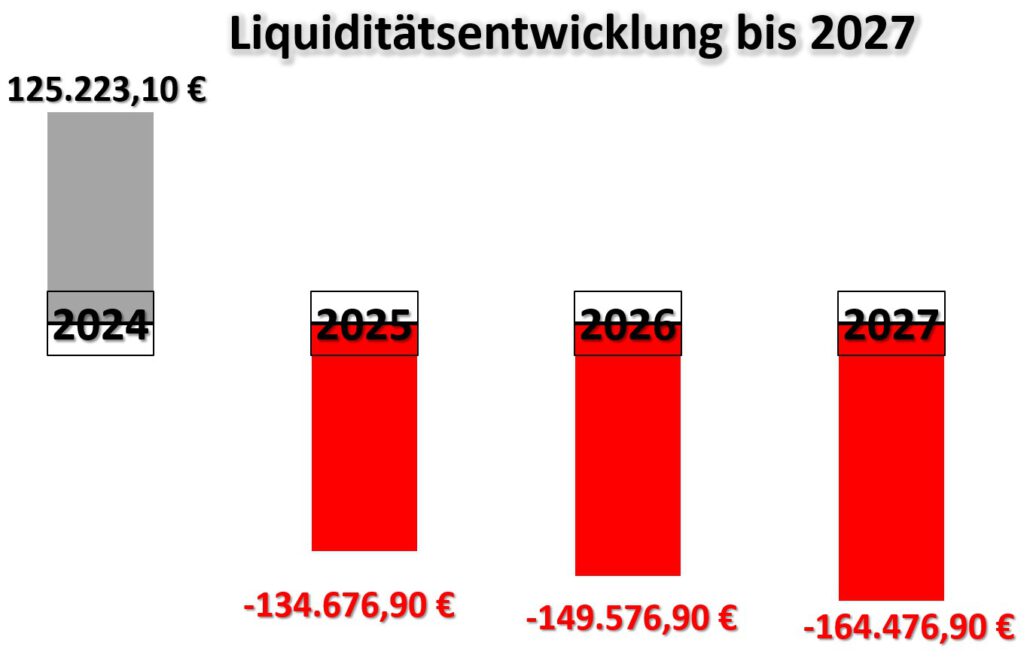
Die liquiden Mittel werden bis zum 31.12.2024 nur noch 125.223 € betragen. Allerdings verbleiben für die Planung des Haushaltsplans 2025 lediglich -134.676 € und diese werden bis zum 31.12.2027 auf – 164.476,90 € steigen.
Somit ist es der Stadt Crivitz nicht möglich, einen Haushaltsausgleich ab dem 31.12.2024 durchzuführen. Außer es erfolgen drastische KÜRZUNGEN in allen BEREICHEN oder weiteren Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, die das Leiden noch verlängern bis zum endgültigen Halt durch den Landkreis LUP.
Also beabsichtigt man jetzt als erste Maßnahme für 2024, um haushaltspolitisch gegenzusteuern, erneut gegenüber den Bürgern die Hebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen und die Gewerbesteuer für alle Unternehmen ebenfalls. Die vierte Steuererhöhung (2015,2018,2020,2024) steht in der bisherigen zehnjährigen Dienstzeit der Bürgermeisterin (Frau Britta Brusch-Gamm; Wählergruppe CWG – Crivitz) an. Die Hebesätze sollen für die Grundsteuer A) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf 338 % und für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf den Wert von 438 % sowie die Gewerbesteuer auf 390 % angehoben werden.
In den kommenden Jahren wird es zu zahlreichen Debatten über Kürzungen von Investitionen kommen, da gleichzeitig die verfügbaren Mittel erschöpft sind und die Fixkosten stetig ansteigen werden. Es ist dringend notwendig, diesen unverantwortlichen Haushaltsirrsinn endlich zu beenden und ihn durch eine neue und verantwortungsbewusste Art der Verantwortungsübernahme zu ersetzen.
Es ist dringend notwendig, eine neue Strategie zur Konsolidierung des Haushaltes zu entwickeln, die auf den allgemeinen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Haushaltsausgleich.
Kommentar/Resümee
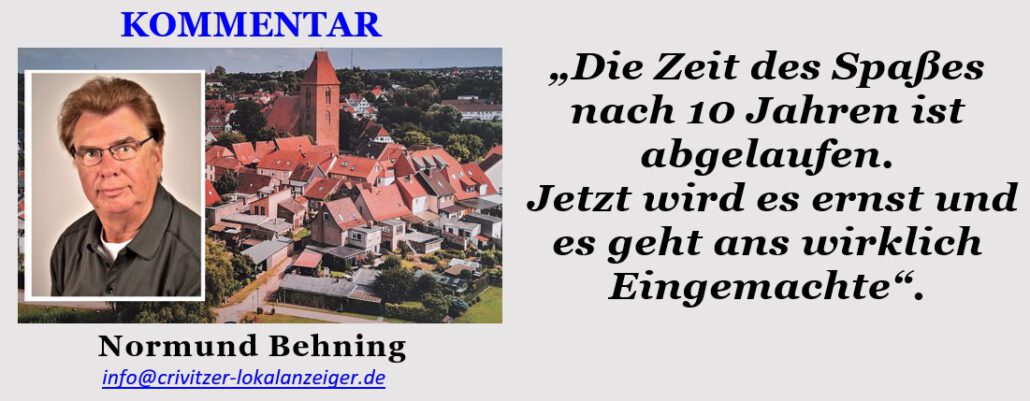
Die Zeit des Spaßes nach 10 Jahren ist abgelaufen. Jetzt wird es ernst und es geht ans wirklich Eingemachte.
Bis zum Jahreswechsel lagen keine Prognosen für das Jahr 2024 vor, doch bis zum 25.01.2024 wurde der Haushalt für Crivitz noch als „Land unter“ bezeichnet. Um eine erneute exorbitante Überschreitung der Ausgaben und Investitionen für das Jahr 2024 zu vermeiden, wurde im Januar eine Arbeitsberatung durchgeführt. In der alles erneut verschoben und gestrichen wurde, sowie Vorhaben ins kommende Jahr verschoben wurden. Die letzten Reserven wurden aus der Schatztruhe entfernt. Diese Maßnahme diente nur dazu, um nicht ein Haushaltssicherungskonzept für 2024 erstellen zu müssen, da dieses sonst der Genehmigung durch den Landkreis LUP unterliegt. Durch die Streichung des Projekts der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses wurde noch einmal der Finanzhaushalt für 2024 der Stadt Crivitz gerettet. Die Probleme aber wurden in die nächste Wahlperiode verschoben.
Das Tafelsilber ist verbraucht und es wird in den nächsten Jahren ans Eingemachte gehen. Die fetten Jahre sind endgültig vorbei. Für die zukünftigen Abordnungen und Generationen stellt es eine Herausforderung dar, sich mit dem, was in den vergangenen zehn Jahren an Wert verloren hat, wieder zurechtzufinden. In den kommenden Jahren wird die Sparsamkeit im Crivitzer Haushalt eine größere Rolle spielen, weshalb die Notwendigkeit der durchgeführten Rekommunalisierung der Reinigung erneut überdacht werden wird. Es ist zu erwarten, dass auch die Kostenintensität der Gemeindehäuser und des Bauhofes erneut auf den Prüfstand gestellt werden, wenn man denn in der Zukunft noch zahlungsfähig bleiben möchte.
Um dann die Herausforderungen in der Infrastruktur und der Dekarbonisierung bewältigen zu können. Die einzige Möglichkeit, um eine Katastrophe zu vermeiden, besteht darin, die Haushaltsführung grundlegend umzugestalten und die finanziellen Mittel dazu einzusetzen.
Wie kann die Bürgermeisterin (Frau Britta Brusch-Gamm; Wählergruppe CWG – Crivitz) von den noch fehlenden Jahresabschlüssen von 2022 bis 2023 entlastet werden, wenn sie nach der Wahl nicht mehr in ihrem Amt bestätigt wird? Wer übernimmt dann die Verantwortung für die zurückliegenden geprüften Vorgänge und die noch verbleibenden liquiden Mittel der Jahresabschlüsse?
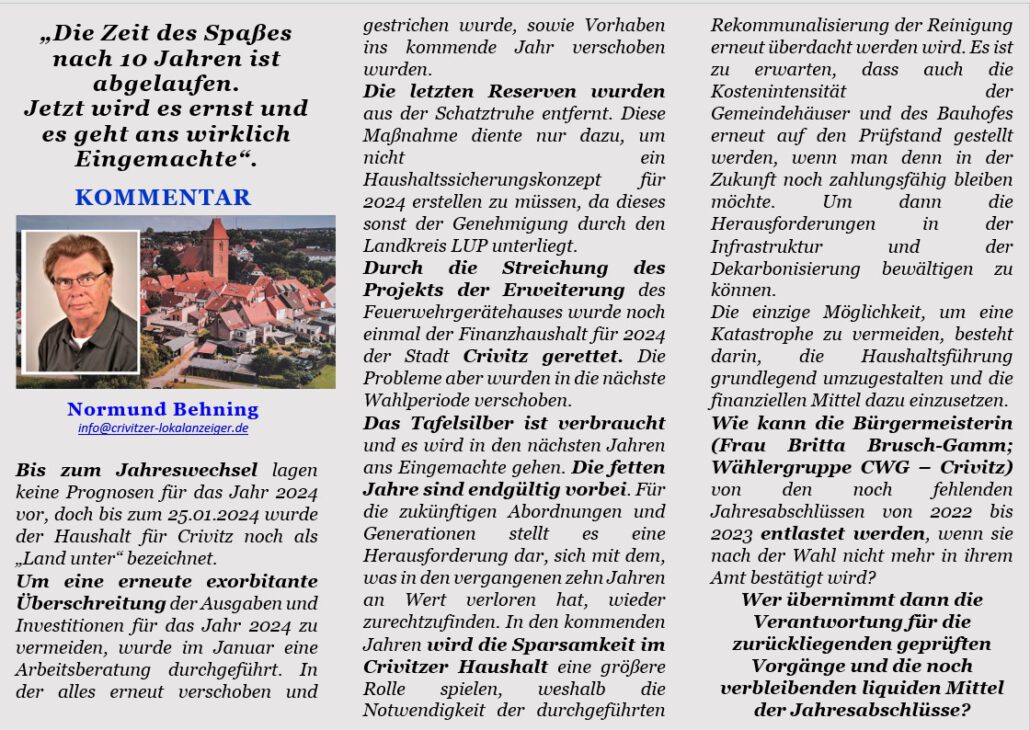
18.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./343[163(38-22)]/CLA-180/18-2024

Die Tätigkeit der nicht öffentlichen Arbeitsgemeinschaft [AG] Strom und Wärme seit 2022 (Vorsitz Alexander Gamm auch Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine und Bauausschussleiter) in Crivitz bleibt weitgehend im Verborgenen. Öffentliche Veranstaltungen oder Diskussionen der AG über das Thema werden in der Regel vermieden, da sonst unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen aufeinandertreffen könnten. Nur einmal auf einem Unternehmerforum 2023, an dem nur einige Teilnehmer anwesend waren und nicht die großen Schlüsselunternehmen von Crivitz, präsentierte er seine persönlichen Vorstellungen von einer gemeinsamen Wärmegesellschaft mit der WEMAG – AG. Es ist offensichtlich, dass er sich für dieses Projekt begeistern und einbringen würde, obwohl es hierzu nur spärliche und oberflächliche öffentliche Erklärungen gibt.
In den Crivitzer Ausschüssen findet hierzu keine öffentliche Debatte zu diesem Thema statt, sondern nur Ankündigungen. Der Gemeindevertreter der Gemeinde Zapel, Herr Jan Neumann, nahm bereits an der Sitzung der AG teil und verkündete stolz, dass auch die geplanten großflächigen Solaranlagen in Zapel in das Gesamtkonzept integriert werden sollen. So wird auch dieses Thema schon jetzt bei Wählergruppen und bald auch bei Parteien eine bedeutende Rolle im Wahlkampf spielen. Die Wählergruppe Bündnis für Crivitz wirbt bereits mit diesem Thema in Ihrem Wahlprogramm. Dies ist auf die Einbindung des Vorsitzenden (Hans-Jürgen Heine) in die Fraktion DIE LINKE/Heine zurückzuführen. Daher ist es selbstverständlich, dass diese ihre diskreten Informationen direkt erhalten und bereits auf dem Tisch liegen.
Allgemein hierzu ist lediglich bekannt, dass die Gemeinden Barnin und Zapel und Crivitz eine gemeinsame Wärmegesellschaft mit der WEMAG AG gründen wollen. Die technische und kaufmännische Verantwortung dieser Gesellschaft soll hauptsächlich in der Hand der WEMAG – AG liegen. Die entscheidenden Absprachen sollen hierzu bereits im Spätherbst 2023 getroffen worden sein. Dazu schätzte der Vorsitzende der AG (Alexander Gamm) auf einer Veranstaltung ein, wahrscheinlich in einem Moment einer intellektuellen Schwäche, dass das gesamte Vorzeigeprojekt eine „Blaupause“ sein wird, wie es bereits in Goldberg existiert. Aufgrund der Tatsache, dass das Hauptrisiko dieser neuen wirtschaftlichen Unternehmung bei der WEMAG AG liegen soll, kann man nicht von einer vollwertigen kommunalen Gesellschaft sprechen, sondern vielmehr von einer kommunalen Minderheitsbeteiligung unter 50 %.
Aus den beteiligten Kommunen wurde mitgeteilt, dass eine Anlage zur Dekarbonisierung im Gewerbegebiet der Stadt Crivitz als Strom- und Wärmeerzeuger für die Neustadt in Crivitz geplant ist. Sie dient zur Erzeugung von Pflanzenkohle und warmen Wasser.
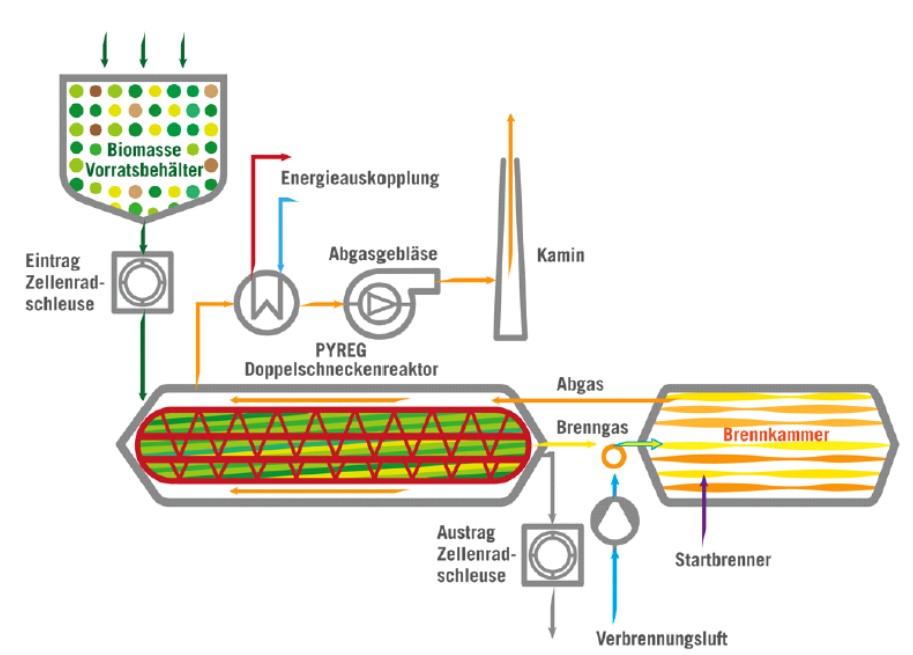
Sie verarbeitet in einem pyrolytischen Verfahren Reststoffbiomasse zu sehr hochwertiger Pflanzenkohle. Der Prozess wird als allotherm bezeichnet. Der Brennstoff besteht aus biologisch abbaubaren Abfällen wie Baum und Strauchschnitt, Grünschnitt, Laub, sonstige Gartenabfälle und landwirtschaftliche Waldhackschnitzel und Reststoffbiomasse. So war auch zu hören, dass angeblich die Agrargenossenschaft Crivitz e.G., falls erforderlich, auch eine Biogasanlage hierzu zusätzlich errichten würde. Vielleicht wird das gesamte Projekt sogar „ein eigenes Stadtwerk“, soweit die Träumereien. Zu diesem gesamten Vorhaben soll das Land Mecklenburg-Vorpommern als Unterstützer gewonnen werden.
Es soll also eine „BLAUPAUSE“ wie in Goldberg werden, die auch für die Gemeinden Barnin/Zapel und Crivitz bald gelten soll! Das Goldberger Großprojekt im Jahr 2017 war das Projekt der „Goldberger Wärme GmbH“. Damals war noch die WEMAG Energie-Dienste alleinige Gesellschafterin. Das technische Schema in Goldberg war anfangs so gedacht, dass die WEMAG Flächen und Gebäude auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft anmietet und pachtet, um dort ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu errichten. Dieses wird auf Basis von Biogas betrieben. Der Rohstoff Rohbiogas wird nicht nur von der Agrargenossenschaft produziert, sondern auch die Wärme, die in einer Biogasanlage entsteht, soll in Goldberg genutzt werden. Beides will man auch weiterhin in Goldberg ausbauen und nutzen, aber hauptsächlich um Strom zu erzeugen. Hierzu wurde festgestellt, dass die Gewinne erst im dritten Jahr nach der Aufnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) fließen werden.
Es ist anzunehmen, dass die von CWG und LINKE/Heine geführte Stadtvertretung möglicherweise weit entfernt von der Realität ist und dies noch ohne Taschenrechner. Es besteht wohl ein Wunsch, dass ein Wunder am Crivitzer See stattfinden würde. Denn der Haushalt 2024 der Stadt Crivitz und die Folgejahre sprechen eine andere Sprache, von den finanziellen Möglichkeiten und Wunschdenken für solche Zukunftsprojekte.
Ohne die Förderung des Landes kann hierzu in den kommenden Jahren nichts passieren.
Der Vorteil für Goldberg ist, dass die WEMAG ein Fernwärmenetz in verschiedenen Straßen errichten will. Ziel ist es, zunächst alle kommunalen Einrichtungen im Bereich der Wärmetechnik zu erschließen, wie Schule, Mehrzweckhalle und in Zukunft auch die Kindertagesstätte. Die Stadt Goldberg verfügt auch über eine eigene Wohnungsgesellschaft Goldberg (WoGeGo) mit Gebäuden und diese sollen ebenfalls in der Zukunft großräumig erschlossen werden.
Die Regelung soll nun auch für die Kommunen in Barnin/Crivitz und Zapel gelten. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass es keine kommunale Wohnungsgenossenschaft gibt und die bisherigen Wärmekraftwerke in privater Hand sind. Immerhin scheint sich die Frage geklärt zu haben, wer die großen Freiflächenanlagen in Wessin und Zapel auf kommunalen Flächen errichten wird. Für den geplanten Energiepark in Wessin ist also soeben ein Favorit benannt worden, wie schon mal 2013.
Darüber dürfte sich auch die landwirtschaftliche Produktion und Absatz eG Wessin sehr freuen, die zudem 75 % der Flächen im Bereich des geplanten Energieparkes besitz. Es ist zu erwarten, dass die 110-KV-Leitung von Barnin über Zapel nach Crivitz auch in einer Investitionshand sein wird. Die Menge an Investitionen und Kosten für alle Projekte wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass die Stromtrasse der 110-KV-Leitung nicht mehr unter der Erde, sondern als Oberleitung verlegt werden wird.
Kommentar/ Resümee
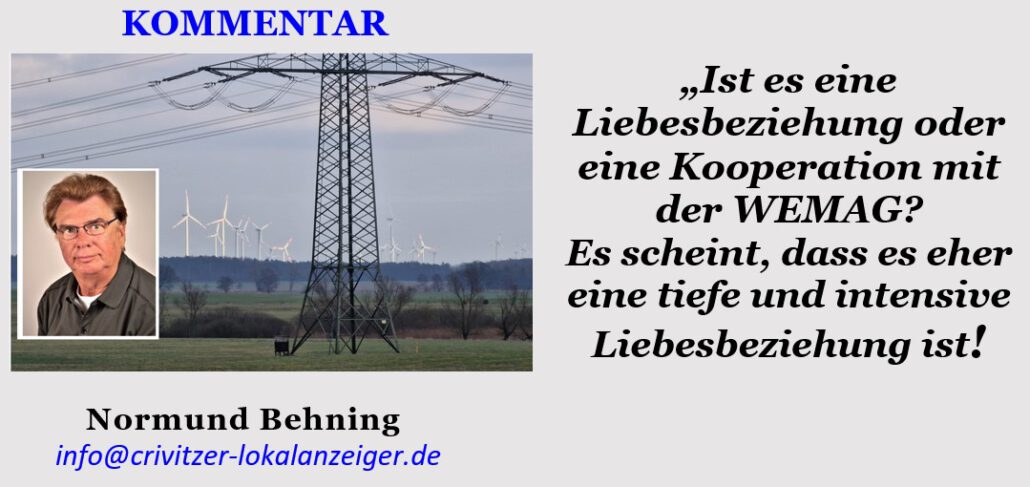
Ist es eine Liebesbeziehung oder eine Kooperation mit der WEMAG? Es scheint, dass es eher eine tiefe und intensive Liebesbeziehung ist!
Denn schon am 10.01.2014 und am 11.02.2014 beschlossen die WEMAG AG und die Stadtvertretung von Crivitz, mehrere Windenergieanlagen in Wessin zu bauen. Vertreter des Städte- und Gemeindetages waren ebenfalls Berater zu diesem Thema. Die Ortsteilvertretung in Wessin hat sich bereits am 12.12.2013 für einen Windpark in Wessin durch die WEMAG ausgesprochen. Die Entscheidung wurde aufgrund der Aussichten auf finanzielle Einnahmen für die Stadt Crivitz getroffen.
Dann kam die Kehrtwende in den Ansichten nach der Kommunalwahl 2014 und nun sorgt erneut eine Rochade seit 2022 für einen Wandel und einen Wiedereinstieg. Ob die Blaupause von Goldberg so funkeln wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt Crivitz hat leider keine eigene kommunale Genossenschaft, die den Wohnungsbau fördert. Die Verlegung einer Fernwärmeleitung bis in die Neustadt wird in Zukunft Millionen in Crivitz verschlingen und große Überzeugungsarbeit bei den privaten Eigentümern erfordern. Auch der Steuerzahler wird dabei bestimmt mitwirken dürfen, ob es über den Strompreis oder über die Gemeindesteuern sein wird.
Es ist erstaunlich, wie weit fortgeschritten die Planungen und Absprachen bereits sind und ausgestaltet wurden. Der normale Bürger wird hierüber nur in Halbsätzen informiert, und wenn überhaupt, bleibt alles wie immer in einem streng geschützten, nicht öffentlichen Bereich liegen. Wie man es seit Jahren gewohnt ist, ist Transparenz nicht die Stärke der Mehrheitsfraktionen der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und die LINKE/HEINE. Aber bezahlen muss dann das alles hinterher der Steuerzahler.
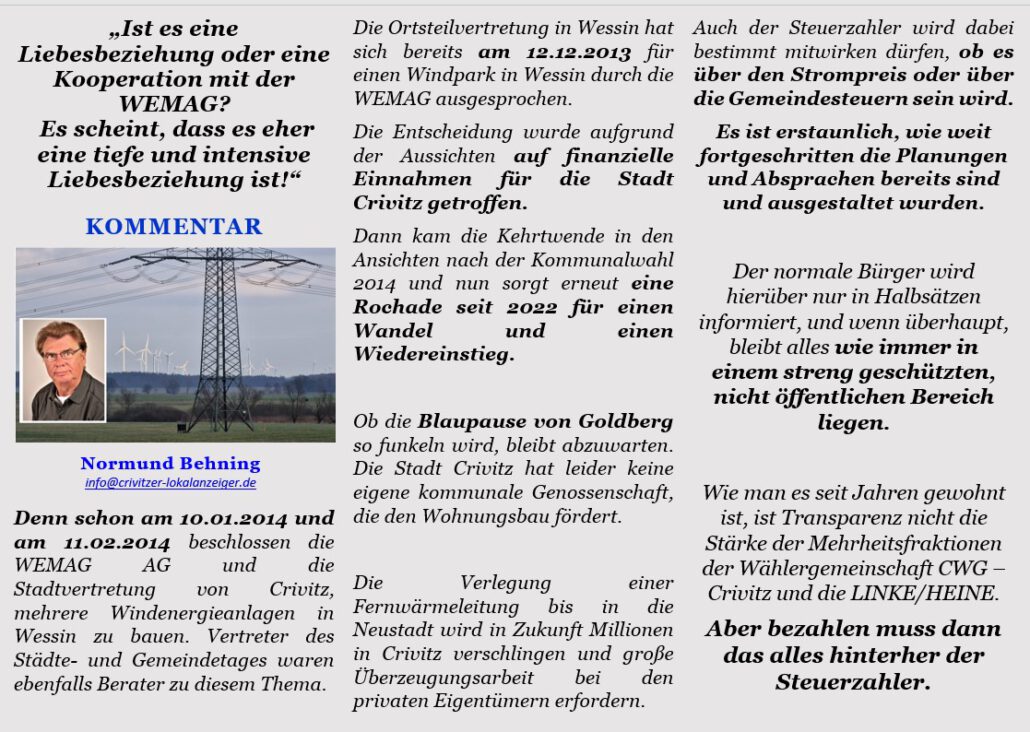
16.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./342[163(38-22)]/CLA-179/17-2024
Spekulative Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Eigenkapital- und Liquiditätsabbau und Investitionsopfer (neues Feuerwehrgebäude) sorgen ab dem 31.12.2026 für eine ungewisse finanzielle Zukunft.
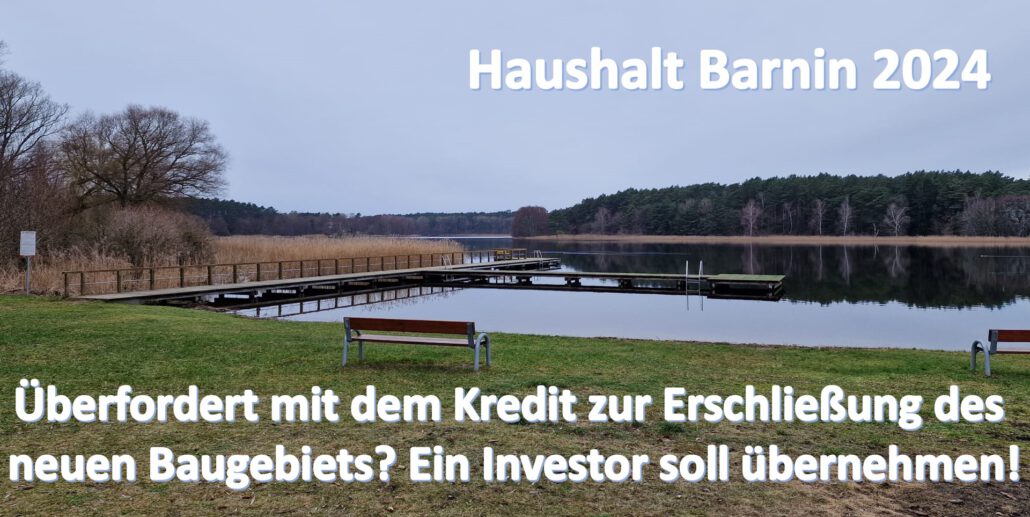
Man weiß nichts Genaues, also alles wie im vorigen Jahr? Investoren sollen nun die Erschließungsprobleme beim Bebauungsplan NR. 1 „AM DORFANGER“ lösen.
Die Dinge sind wie meistens etwas komplizierter!
Für die Gemeinde liegen nur Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 vor; alle nachfolgenden Daten im Haushaltsplan 2024 basieren hauptsächlich auf fortgeschriebenen Rechnungsergebnissen oder kumulierten Ergebnisvorträgen sowie auf angenommenen Planungsdaten bis 2027. Wieso wird diese Vorgehensweise zum Haushaltsplan schon seit Jahren geduldet, es ist ein eindeutiger Gesetzesverstoß?
Die Einnahmen der Gemeinde Barnin 2024 belaufen sich insgesamt auf ca. 664.600 €, wovon ca. 482.000 € Steuereinnahmen sind. Die Ausgaben betragen 2024 = ca. 889.200 € und ergeben somit ein Defizit im Ergebnishaushalt von ca. -224.600 €. Trotz der Verwendung der letzten finanziellen Rücklagen der Kommune kann nur noch durch einen verbleibenden positiven Ergebnisvortrag aus dem Jahresabschluss 2019, seiner kumulierten Fortschreibung bis 2024 eine Darstellung als sogenannter Ausgleich erfolgen. Dieser Ergebnisvortrag wird aber bis 2027 drastisch gemindert. In der vorläufigen Ergebnisrechnung ergeben sich Defizite für das Jahr 2022 = -6.085,39 €, für 2023 = -140.000 € und 2024 = -170.600 €. Ein Ausgleich der Defizite konnte nur erzielt werden, indem die letzten Mittel aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage entnommen wurden. Lediglich in der Infrastrukturpauschale sind noch Mittel von 116.035,62 € vorhanden.
Die Differenzen zwischen den jahresbezogenen Ausgaben und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich aus den Haushaltsplanungen für 2023 mit -250.700 € und 2024 =-186.300 € ergeben, lassen sich lediglich durch die NOCH vorhandenen Vorträge ausgleichen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird der Finanzhaushalt nur noch letztmalig eine positive Summe in Höhe von 12.896 € aufweisen können. Von 2024 bis 2027 werden die liquiden Mittel auf etwa 386.000 € reduziert. Es kommt zu einem Rückgang des Eigenkapitals von etwa 319.000 € bis 2027.
Im Jahr 2022/23 beabsichtigte die Gemeinde, das Baugebiet „AM DORFANGER“ eigenständig die Erschließung zu übernehmen, wobei die Gesamtkosten gemäß „damaligen Kostenschätzungen“ etwa 936.000 € betrugen.
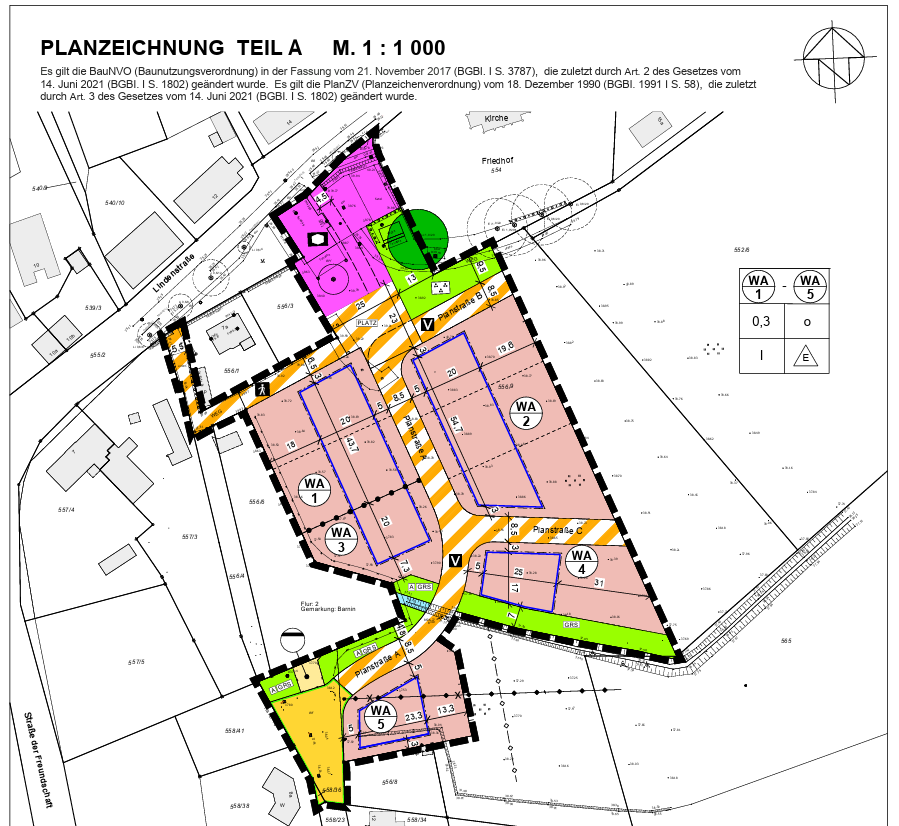
Zu diesem Zweck wurden bereits ca. 33.000 € für Planungsleistungen ausgegeben. Um diese Maßnahme überhaupt finanzieren zu können, hat die Gemeinde 2023 einen Kredit aufgenommen für 3 Jahre mit einem Zinssatz von 4,0 % p. a. (jährliche Annuität =142.158,06 €).

Als Einnahmen plant die Gemeinde dagegen Verkaufserlöse aus acht Grundstücksverkäufen in Höhe von 960.000 €; diese sollten einmal im Jahr 2024 + 2025, jeweils 480.000,00 € betragen. Das bedeutet, dass pro Jahr 2024/25 ungefähr vier Grundstücke veräußert werden sollen.


Jedes Grundstück müsste also jeweils etwa 120.000 € an Erlösen einbringen. Die Genehmigung für den Bebauungsplan ist bis heute nicht erteilt worden. Bis zum Oktober 2023 hatte sich gerade einmal ein Interessent gemeldet. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde noch kein Grundstück verkauft.
Warum wohl?
Es gibt keine Baugenehmigung, zu hohe Baupreise und Zinssätze bis 4,3 %. Genauso ist es ein gewagtes Vorhaben, ein Grundstück in der Barniner Laage für 180.000 € + zuzüglich 6 % Grunderwerbssteuer zu erwerben, ohne eine Baugenehmigung vorliegen zu haben!

Es ist anzunehmen, dass die SPD geführte Gemeindevertretung und die CDU-Fraktion in der Stellvertretung möglicherweise weit entfernt von der Realität waren bei dieser Planung und dazu noch ohne Taschenrechner. Oder es bestand wohl ein Wunschdenken, dass ein Wunder am Barniner See stattfinden würde.
Als erste Maßnahme beabsichtigt man jetzt, um gegenzusteuern, einen Investor zu suchen, welcher das Erschließungsproblem löst und die Kosten übernimmt.
Und als zweite Maßnahme beabsichtigt die Gemeinde Barnin, erneut gegenüber den Bürgern die Hebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen. Die Hebesätze sollen für die Grundsteuer A) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf 338 % und für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf den Wert von 438 % angehoben werden. Die Gewerbesteuer soll erst einmal bei einem Hebesatz von 381 % bleiben „um bestehende Gewerbetreibende zu halten bzw. neue zu gewinnen“.
Die dritte Maßnahme ist, dass die Planung und Errichtung des neuen Feuerwehrgebäudes, worüber 2023 schon keine Kostenschätzung vorlag, erst einmal 2024/25 nicht weiterzuverfolgen. Vorplanungsleistungen wurden bereits in der Höhe von 20.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Allerdings sind auch hier Baukosten bei den derzeitigen Baupreisen bis ca. 250.000 € zu erwarten.
Ob diese drei Maßnahmen haushaltspolitische Steuerungsmaßnahmen sind, kann man wirklich bezweifeln, denn sie dienen gänzlich nur dazu, den Haushalt genehmigungsfrei vom Landkreis LUP zu machen und die finanzpolitischen Probleme auf die Folgejahre zu verschieben.
Aufgrund der aktuellen Daten aus den fortgeschriebenen Rechnungsergebnissen ist es jedoch möglich, dass Barnin sich einen Verlust bei den Erschließungskosten zum Baugebiet „AM DORFANGER“ und den Verkäufen aus den Grundstücken leisten kann. Überdies wäre die Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses bis zu 250.000 € sogar möglich. Allerdings ist auch in den kommenden Jahren mit steigenden Ausgaben (Personalausgaben, Amts- und Kreisumlage und Baupreisen und Bewirtschaftungskosten) zu rechnen.
Jedoch, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, müsste dann zwingend ab dem 31.12.2026 bis 2029 ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet werden, um die Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Umfangreiche harte Sparmaßnahmen und Konsolidierungen wären die Folge, da keine Rücklagen und liquide Mittel mehr vorhanden sind. Es wäre schwierig, mittelfristig finanzielle Mittel für eine energetische Sanierung und eine klimafreundliche Wärmeversorgung in der Zukunft zu mobilisieren und zu investieren.
Kommentar/Resümee

Steuererhöhungen, keine Rücklagen, Schulden und finanzielle Ungewissheit über die Zukunft der Gemeinde ab 2026 werden das sein, was aus einer gefühlten 20-jährigen SPD-Dominanz in Barnin übrigbleibt.
Wie kann der Bürgermeister (Siegfried Zimmermann – SPD) von den noch fehlenden Jahresabschlüssen von 2020 bis 2023 entlastet werden, wenn er nach der Wahl nicht mehr in seinem Amt bestätigt wird? Wer übernimmt dann die Verantwortung für die zurückliegenden geprüften Vorgänge und die noch verbleibenden liquiden Mittel der Jahresabschlüsse? Seit Jahren existieren keine Konzepte, für notwendige mittel- und langfristige Maßnahmen zur energetischen Sanierung oder zur klimafreundlichen Wärmeversorgung in Barnin zu ergreifen.
Was auch immer man mit dieser Aussage zur Gewerbesteuer („um bestehende Unternehmen zu erhalten oder neue zu gewinnen“) erklären will und welche Ansiedlungen von Unternehmenszentralen hier im Ort Barnin erwartet werden, ist unklar! So wurde 2024 der niedrigste Gewerbesteuersatz im Amtsbereich Crivitz in der Gemeinde Plate (348 %) festgestellt und der höchste in der Gemeinde Langen Brütz (400 %). Die Finanzierung der Erschließung des Baugebietes erfolgt durch spekulative Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken an Interessenten im Jahr 2024/25 sowie die Erwartung, dass die Kosten für die geplante bauliche Erschließung der Grundstücke nicht erneut zunehmen werden. Für den Verkauf der Grundstücke ist ein gezieltes Marketing erforderlich, was nicht vorhanden ist.
Die Errichtung des neuen Feuerwehrgebäudes ist nur mit einem Antrag auf SBZ (Sonderbedarfszuweisung) möglich, jedoch müssen die Jahresabschlüsse der Haushalte von 2020 bis 2022 vorliegen. Das ist jedoch nicht der Fall! Die drastische Anhebung der Steuersätze ist nicht geeignet, die bevorstehenden finanziellen Schwierigkeiten zu lösen. Diese Handhabung ist zu einseitig und erschwert zudem die Lebensbedingungen der Bevölkerung im ländlichen Raum.
Selbstverständlich ist die CDU-Fraktion als stärkste Oppositionskraft nicht unbeteiligt an diesen ganzen Angelegenheiten. Besonders in der gegenwärtigen Legislaturperiode (2019 bis 2024) ist sie plötzlich aus dem politischen Kontext verschwunden, weil sie ein harmonisches und leidenschaftliches Miteinander mit der SPD geführten Gemeinde pflegte. Die CDU-Fraktion hat viele richtungsweisende Beschlüsse mit der SPD getroffen, die zu diesem Desaster geführt haben. Es fehlte der CDU-Fraktion an Mut und Ausdauer in dieser Legislaturperiode, um eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie geriet immer wieder in innere Konflikte, da sie selbst einen Funktionsträger in der Gemeindevertretung stellt (1. Bürgermeister Herr Stephan Stange -CDU). Es wurde sofort jede Form von Opposition abgelehnt, da sie das harmonische Miteinander mit der sozialdemokratischen Gemeinschaft nicht gefährden wollte. Jetzt ist das Ergebnis in schriftlicher Form verfügbar und es wird für die CDU-Fraktion eine Herausforderung darstellen, die Wahlversprechen der Kandidaten bis Mai 2024 zu erläutern und zu welchen Zielen sie sich entwickeln werden! Wohin soll die Reise gehen, oder?
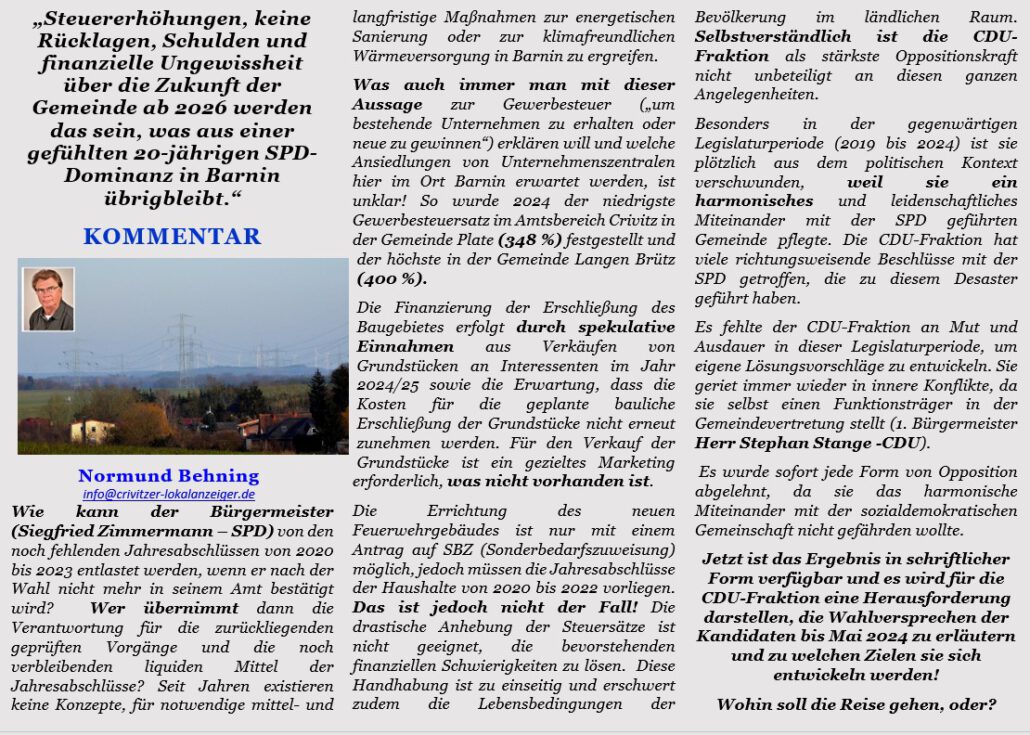
14.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./341[163(38-22)]/CLA-178/16-2024
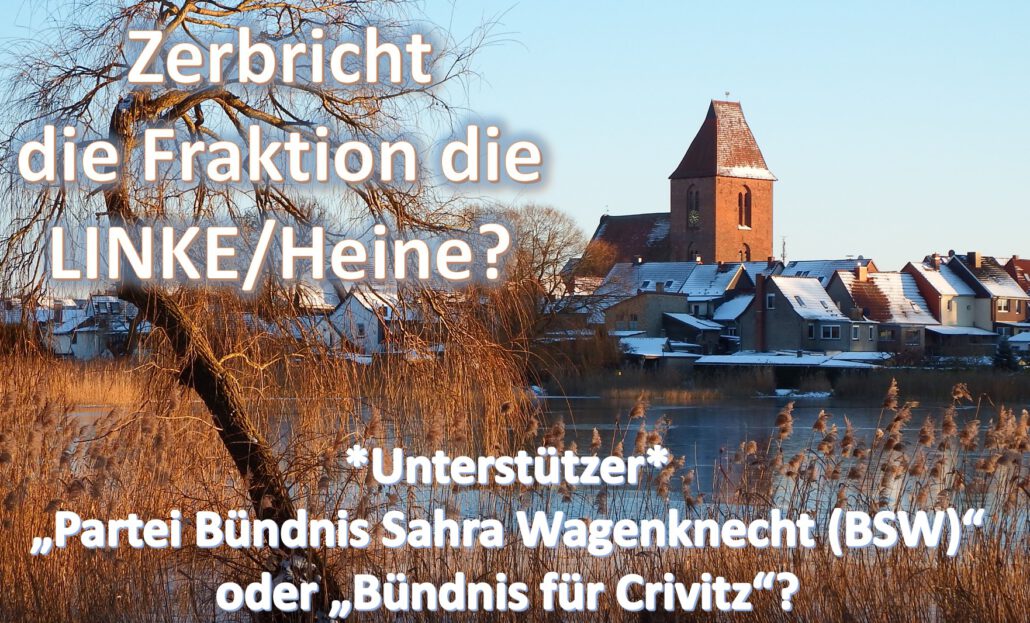
Ist es ein Zweckbündnis in der Fraktion die LINKE/ Heine gewesen, dass seine Hingabe verloren hat, oder handelt es sich um ein politisches Kalkül vor dem Wahltag?
Es sieht so aus, als ob die politische Zweisamkeit seit dem Jahr 2019, die in einer Fraktionsbildung (die LINKE/Heine) zwischen Herrn Hans-Jürgen Heine (Einzelbewerber) und Herrn Alexander Gamm, als dem einzigen Vertreter der Linkspartei im Stadtparlament von Crivitz, allmählich zerbröckelt vor dem Wahltermin! Könnte es nur eine politische Strategie, die nach der Wahl im Juni 2024 umgesetzt werden soll, um sich dann erneut zu treffen und wieder eine alte Verbundenheit aufleben zu lassen? Um schließlich in einem neuen Zweckbündnis zu enden, bis zur nächsten Wahl.
Der eine, der für die LINKE seit 2014 im Stadtparlament sitzt und der andere, der früher 2014 für die SPD kandidierte und danach 2019 als Einzelkandidat sich dann mit der Linken neu verbunden fühlte. War es eine Leidenschaft oder eher ein Zweck gewesen, der die Entscheidung beeinflusst hat? Es war eher eine Leidenschaft, die als Aktivität im Sitzungsverhalten und die Diskussionsstatements in den Sitzungen und die Diskussionen der Fraktion in den vergangenen fünf Jahren zu beobachten war. Ein Zweckbündnis bestand nur in der Funktionsträgerverteilung: Der eine wurde Bauausschussleiter und Fraktionsvorsitzender, der andere wurde zum Umweltausschussleiter und zweiter Bürgermeister ernannt, so konnten beide von den finanziellen Funktionszulagen profitieren. Natürlich nur, wenn die Wählergruppe der CWG – Crivitz dies zuließ und sie in das Funktionsträgeramt wählte .
Zusätzlich zu den Funktionsbezügen erhalten Abgeordnete bei Anwesenheit im Jahr abgabenfreie Entschädigungen:
Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine, Alexander Gamm (Fraktion die LINKE/Heine: Erhält: Entschädigungen als Fraktionsvorsitzender und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + mindestens in zwei Ausschüssen bzw. als Vors. des Ausschusses+ Fraktionssitzungen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen Vors.-Bauausschuss +⌀7 Sitzungen Hauptausschuss p. a.] Entschädigung: 1.440 € Fraktionsvorsitzender+280 € Stadtvertretersitzung +660 € Vors. Bauausschuss+ 280 € Hauptausschuss+ 280 € Fraktionssitzungen = Gesamt: ca. 2.940 € (p. a.)
2.BÜ Hans-Jürgen Heine – Fraktion die LINKE/Heine Entschädigungen als 1. Bürgermeister und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung sowie als Vors. des Ausschusses [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen pro Jahr (p. a.)]. Entschädigung: 3.000 €+1.220 €= Gesamt: ca. 4.220 € (p. a.)
Fraktionsvorsitzender der Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG – Crivitz) Andreas Rüß: Erhält: Entschädigungen als Fraktionsvorsitzender und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + mindestens in zwei Ausschüssen+ Fraktionssitzungen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen Umweltausschuss + ⌀7 Sitzungen Hauptausschuss p. a.] Entschädigung: 1.440 € Fraktionsvorsitzender+280 € Stadtvertretersitzung+440 € Umweltausschuss+ 280 € Hauptausschuss+ 280 € Fraktionssitzungen) = Gesamt: ca. 2.720 €(p. a.)
Plötzlich kommt es nach fünf Jahren zu einer Veränderung im Verhalten der beiden Verantwortlichen, dieses Mal sogar vollkommen unerwartet vor einer Kommunalwahl. Der eine Alexander Gamm ist nun als Fraktionsvorsitzender und Bauausschussleiter für die Partei Die Linke im Stadtparlament Crivitz tätig und verherrlichte Russland, wie es die SVZ beschrieb (SVZ am: 08.04.2022). Er schwärmt aber seit einigen Monaten in Facebook (auch als Paul Hermann unterwegs) von Bündnis, Sahra Wagenknecht und verhöhnt seinen eigenen Parteivorsitzenden in seinen Tweets. Es scheint, als würde er sich für den BSW als Unterstützer einsetzen, so deutlich sind seine Inhalte in seinem Gezwitscher zu erkennen.
Der andere, Hans-Jürgen Heine, ist als Umweltausschussleiter und zweiter Bürgermeister tätig und initiiert daraufhin eine neue Wählergruppe „Bündnis für Crivitz“ vor ca. acht Wochen. Das Bündnis wirbt mit dem neuen Slogan, dass sie eine starke „ALTERNATIVE“ zu den bestehenden kommunalen Kräften entwickeln will und sie möchten nicht „IRGENDWELCHEN PARTEIEN“ das Miteinander und Vorwärtskommen in Crivitz überlassen.

Das Bündnis nimmt an, dass hierfür ausschließlich tatkräftige Personen benötigt werden, denen man vertrauen kann. Es klingt fast so, wie es einmal der Fraktionsvorsitzende (Andreas Rüß) der Wählergruppe CWG – Crivitz verkündete. „MACHEN statt MOSERN“, was bereits vieles auf ein neues Miteinander nicht nur ahnen lässt, sondern bald auch sicherlich Wirklichkeit werden wird, als sogenannter starker Gegenpol für Mehrheiten gegenüber den etablierten Parteien.
Wenn man das Zusammenspiel in den Sitzungen der beiden Fraktionsmitglieder die letzten Wochen so beobachtet, ist es eher ein kühler, wohlwollender Umgang miteinander. Von Herzlichkeit und Kommunikation ist da nur noch wenig zu spüren. Es handelt sich um ein Zweckbündnis, das bis zum Ende bestehen wird. Könnte es sein, dass es etwas beschädigt worden ist?
Wohl kaum, denn die finanziellen Funktionszulagen wird man vor der Kommunalwahl nicht auf Spiel setzen wollen. Es scheint eher so, als ob es sich um ein abgestimmtes politisches Vorgehen handelt, um dann einige Tage nach der Wahl erneut zusammenzuarbeiten, um erneut als Funktionsträger gewählt zu werden. Die Kommuniqué Politik in Crivitz ist eine famose Welt!
Es ist bemerkenswert, dass diejenigen, die sich im „Bündnis für Crivitz“ zusammengefunden haben, zu 40 % in und aus Parteien stammen sowie teilweise noch in kommunaler Verantwortung standen und stehen. Dennoch ruft das Bündnis indessen zu mehr Miteinander gegen die Parteien auf, obwohl „Sie“ selbst maßgeblich zum finanziellen Desaster im Stadthaushalt der vergangenen Jahre bis 2024 beigetragen haben.
Ob die Wähler dies tatsächlich auch so interpretieren werden, hängt von den Handlungen der Protagonisten in den vergangenen fünf Jahren ihrer Tätigkeit im Stadtparlament ab!
Kommentar/Resümee
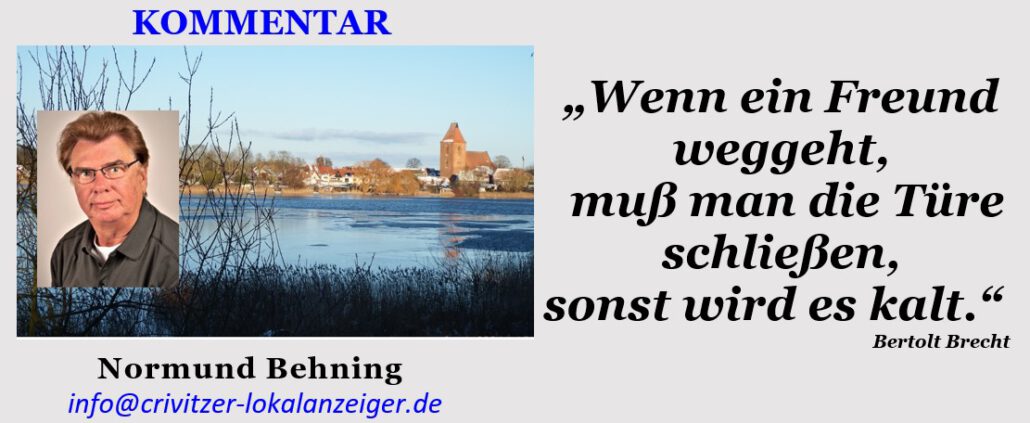
„Wenn ein Freund weggeht, muß man die Türe schließen, sonst wird es kalt.“ Bertolt Brecht.
Jedes Mal, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Wähler nach fünf Jahren zu einer Kommunalwahl zu gewinnen, ist es für manche Protagonisten ein besonderes Schauspiel. Egal, ob man nun aus der Partei DIE LINKE stammte oder aus der SPD oder der FDP und sich dann in die „Schill Partei“ verirrte und dann wieder in der FDP landete. Alles versammelt sich 2024 indessen in sogenannten „BÜNDNISSEN“.
Manche Protagonisten können einfach nicht loslassen. Sie setzen ihr ganzes Engagement ein, um die Kontrolle oder Einflussnahme zu erlangen oder Netzwerke zu übernehmen, um möglicherweise zusätzliche Mittel zu erlangen, als eigentlich notwendig. Es geht schlichtweg wieder einmal nur um Posten, Geld und Aufträge. Es ist stets von Bedeutung, dass man sich für die Nachwelt ein Zeichen setzt. Ob es sich soeben um Gedenksteine im Stadtpark und im ARBORETUM oder um einen Caravanstellplatz oder einen Radweg mitten durch die City handelt, oder ob es sich um eine Anlage zum Karbonisieren im Stadtgebiet betrifft.
Dieses Mal soll es also ein „Kriegerdenkmal vom 3.12.1921“ sein.

Es scheint, als ob die Zeit, um diesem Thema nachzugehen, nach Ansicht des Bündnisses für Crivitz geradezu reif ist, natürlich ohne Hinterfragungen und ganz für die Kunst und Historie.

Es wäre sicherlich hilfreicher und nützlicher, zuerst sich um die Erhaltung und Modernisierung der Gedenkstätten „Todesmarsch nach Schwerin“ und seiner „26 Stelen“ zu widmen.



Vielleicht wäre das als Wählergruppe in der heutigen aktuellen internationalen und europäischen Situation sinnvoller, als sich dafür einzusetzen, ein „Kriegerdenkmal“ von 1921 zum ersten Pilotprojekt im Kommunalwahlkampf 2024 zu machen.
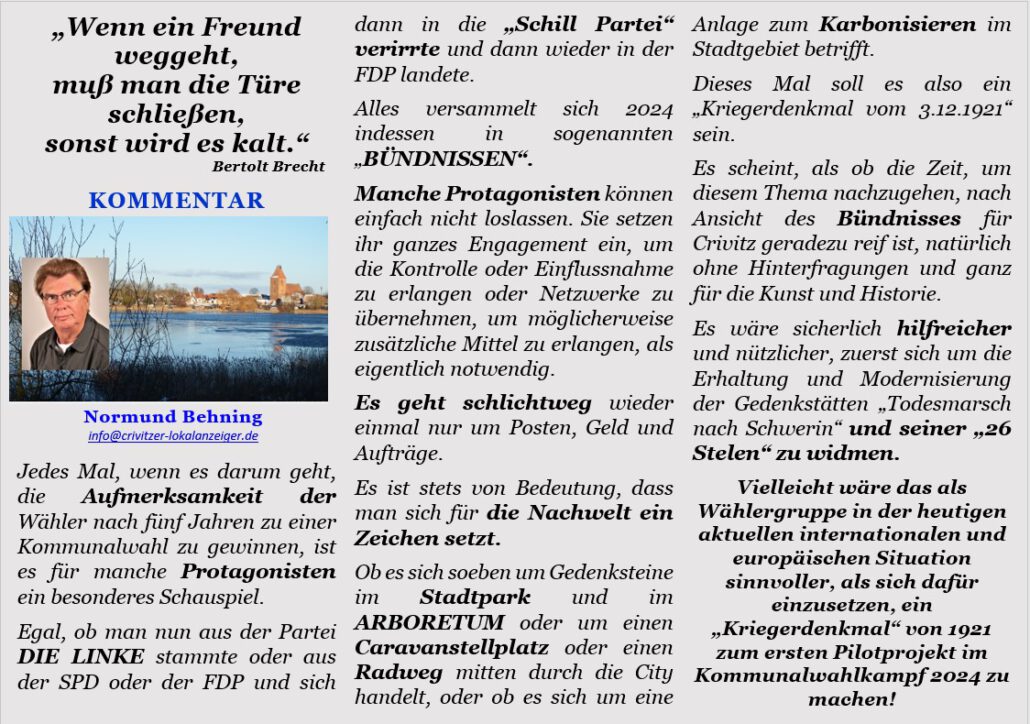
12.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./340[163(38-22)]/CLA-177/15-2024

Die Dinge sind wie meistens etwas komplizierter!
Der Haushaltsplan für die Gemeinde Bülow wurde bis zum letzten Augenblick des Monats Februar 2024 von der Amtsverwaltung Crivitz berechnet und ist nun in der Endfassung. Viele Positionen wurden hin und her geschoben, sodass die Beschlüsse im Haushaltsplan 2024 noch über die Kommunalwahl hinaus bis zum 31. Dezember 2024 funktionsfähig sein können. Aber auch noch in der Zukunft?
Bis zum 22. Februar 2022, dem Zeitpunkt, an dem der Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen wurde, waren bei der Gemeinde lediglich Jahresabschlüsse bis 2016 vorhanden. Innerhalb von 24 Monaten erhielt sie plötzlich und unerwartet sechs Jahresabschlüsse, davon allein 4 im Jahr 2023. Der letzte Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde ihr am 05.12.2023 zugestellt, erst ab diesem Zeitpunkt waren sämtliche aktuellen Daten verfügbar. Die Gemeinde ist wie die Gemeinden Leezen, Cambs, Friedrichsruhe und Raben Steinfeld im Amtsbereich auf dem aktuellsten Stand. Es ist jetzt möglich, eine realistische Finanzanalyse für die Gegenwart und die Zukunft zu erstellen. Erst jetzt sind die Salden in den einzelnen Ergebnis- und Finanzhaushalten der zurückliegenden Jahre abgewogen und die tatsächlichen Vorträge bzw. Nachträge für eine reale Haushaltsplanung 2024 ersichtlich.
Der demografische Wandel macht sich auch in Bülow bemerkbar, denn es leben nur noch 328 Einwohner in Bülow. So ist es bedauerlich, dass mehr Menschen sterben und wegziehen, als geboren und zugezogen wird in der Gemeinde. So sind 52,13 % (171) der Einwohner der Gemeinde älter als 50 Jahre und lediglich 22 % (72) in einem Alter bis 25 Jahre.
Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein Defizit von -1.900 € auf und im Finanzhaushalt 2024 besteht ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -102.700 € sowie ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -174.500 €. Trotz steigender Schlüsselzuweisungen vom Land MV (2020= 204.826,16 € bis 2024= 288.200 €) und steigender Steuereinnahmen (von 2020= 147.939,22 € bis 2024 =170.100 €) gelingt es der Gemeindevertretung nicht, ihre Kosten zu bewältigen.
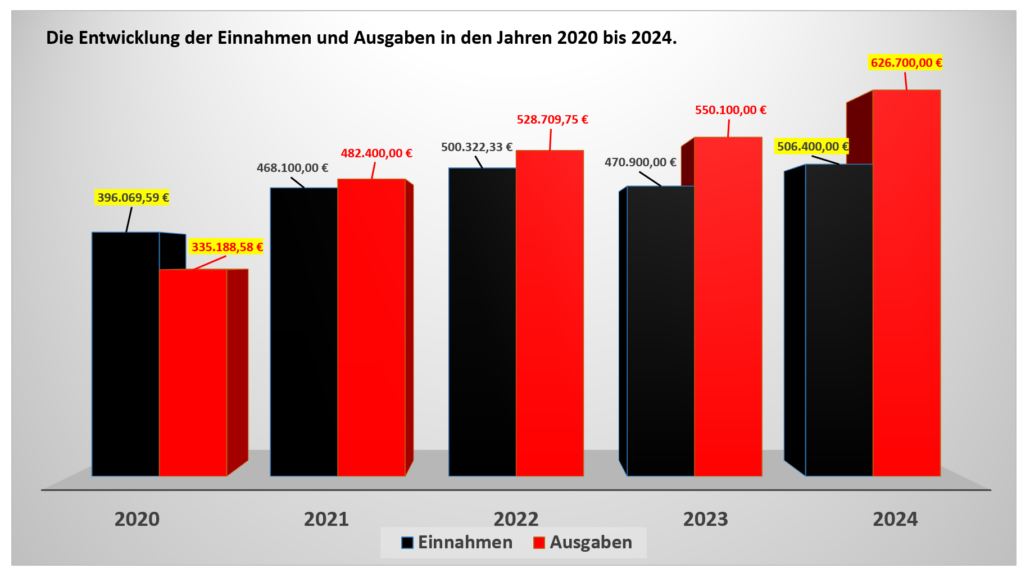
So ist zwar die Summe aller Erträge (von 2020= 396.069,59 € bis 2024 = 506.400 €) gestiegen, aber gleichzeitig haben sich die Ausgaben (von 2020= 335.188,58 € bis 2024= 626.700 €) nahezu verdoppelt.
Die höheren Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, die Umlagen an das Amt Crivitz und den Landkreis LUP, die Personalausgaben und Kostenerstattungen an Gemeindeverbände belasten insgesamt den Haushalt. Trotzdem investiert die Gemeinde etwa 349.900 € in die Anschaffung eines neuen Bauhoffahrzeugs, eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr, die Erneuerung des Gehwegs entlang der Ortsdurchfahrt Prestin und den Ausbau des Verbindungswegs zwischen Speuss und Kladrum. Durch diese Maßnahme entsteht eine Differenz in der Investitionstätigkeit in Höhe von -174.500 € im Finanzhaushalt.
Die jüngsten negativen Jahresergebnisse von 2023= -37.950,20 € und der Planung im Haushalts 2024= -120.300 € kann diese Differenz nur noch aus der allgemeinen, zweckgebundenen Kapitalrücklage und den übrigen Mitteln aus den Ergebnisvorträgen letztmalig ausgeglichen werden. Diese Mittel aus den Rücklagen sind ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr für einen zukünftigen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt verfügbar. Die zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt aktuell nur noch 77,24 € und die allgemeine Kapitalrücklage hat nur noch einen Bestand von 23,14 €.
Die Differenzbeträge für die jahresbezogenen laufenden Ein- und Auszahlungen und der Haushaltsvorjahre können im Finanzhaushalt 2024 letztmalig nur noch einmal eine positive Summe in der Höhe von 7.325,06 € bis zum 31.12.2024 ausgewiesen werden. Dieser Saldo wird bis 2027 auf einen negativen Betrag von -177.974,94 € bei einem gleichen Ausgabenverhalten anwachsen.
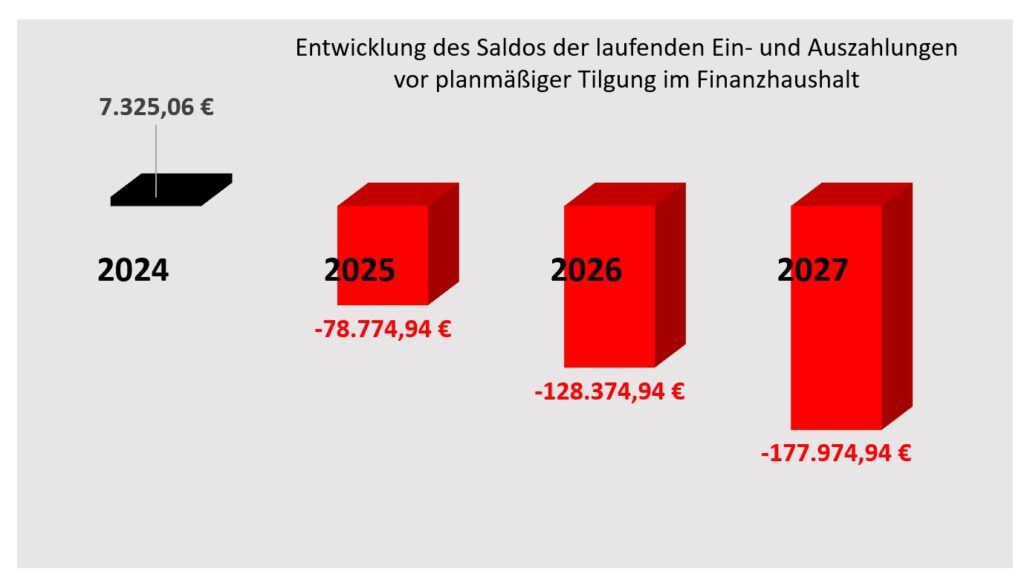
Somit kann der Finanzhaushalt ab 01.01.2025 bis 2027 nicht mehr ausgeglichen werden.
Die Verwendung der letzten liquiden Mittel, die ab dem 31.12.2024 nur noch 217.078,73 € betragen, kann hier ebenfalls keine Abhilfe mehr schaffen. Das Eigenkapital der Gemeinde Bülow betrug in der Eröffnungsbilanz aus dem Jahre 2012 noch 637.890,20 €. Durch die negativen Jahresergebnisse und die Entnahmen aus den letzten Rücklagen beträgt das Eigenkapital am 31.12.2024 nur noch 555.323,82 €. Bis zum Jahresende 2027 wird das Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz auf etwa 370.723,82 € reduziert sein.
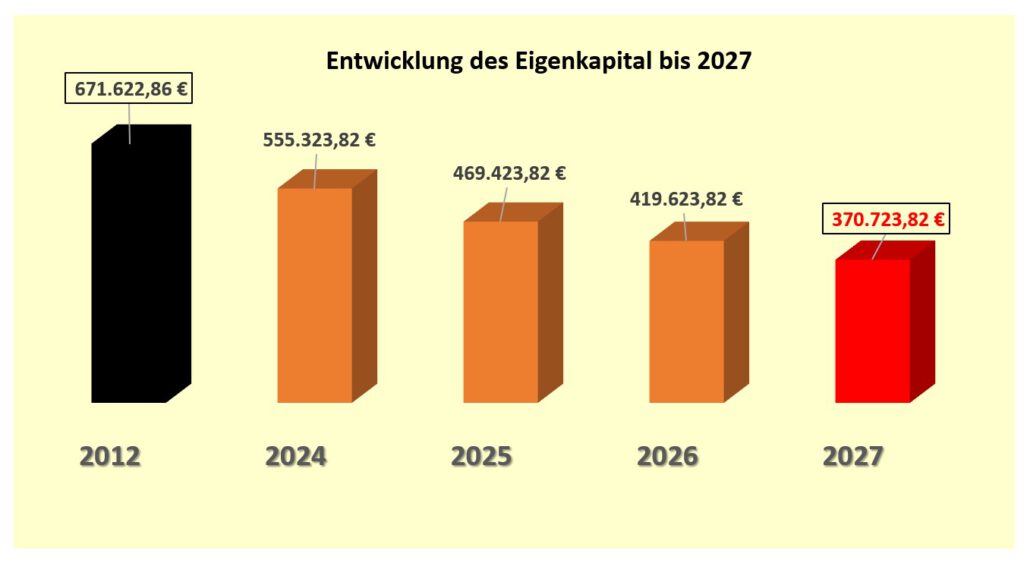
Die Gemeinde Bülow belegt den 15. Platz unter den 17 Gemeinden im Amtsbereich Crivitz, was die Höhe der liquiden Mittel bis zum 31. Dezember 2024 betrifft. Dahinter liegen nur noch die Gemeinden Langen Brütz und die Stadt Crivitz, die noch weniger Kassenbestände haben.
Das erhaltene Zertifikat einer „gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit“ der Haushaltsführung in der Gemeinde Bülow vom Amt für Finanzen des Amtes Crivitz ist realistisch und stellt die derzeitige Situation vollkommen zutreffend dar. Dieses Resultat einer Haushaltsführung, die mit einem Minus von 70 Punkten (Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen -Rubikon) einhergeht, ist das schlechteste Ergebnis im gesamten Amtsbereich des Amtes Crivitz im Jahr 2024.
Es zeigt sich nun, dass die tatsächliche Lage für die Zukunft deutlich schlechter ist als angenommen!
Kommentar/Resümee
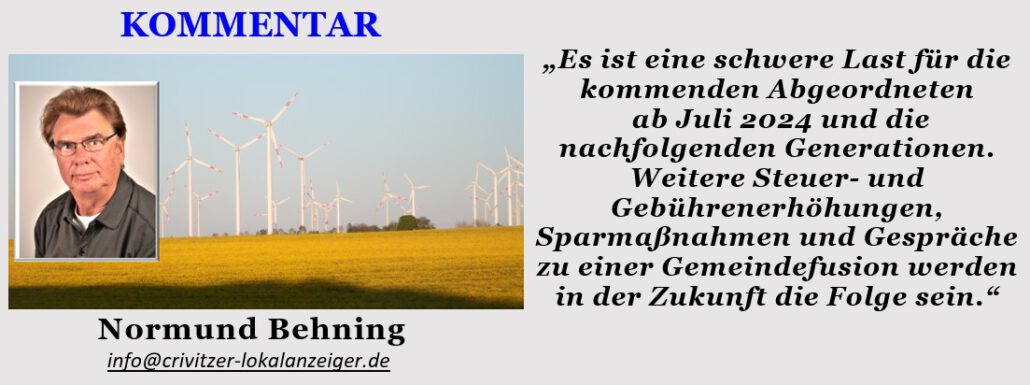
Es ist eine schwere Last für die kommenden Abgeordneten ab Juli 2024 und die nachfolgenden Generationen. Weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen, Sparmaßnahmen und Gespräche zu einer Gemeindefusion werden in der Zukunft die Folge sein.
Ab dem 31.12.2025 wird ein Haushaltssicherungskonzept unvermeidbar sein, wenn man den aktuellen finanzpolitischen Kurs beibehält. Als erste Maßnahme, um haushaltspolitisch gegenzusteuern, beabsichtigt die Gemeinde Bülow, erneut die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer zu erhöhen. Die Hebesätze für die Grundsteuer (A) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen betragen jetzt 350 %. Für die Grundstücke (Grundsteuer B) beträgt der Wert 440 % und für die Gewerbesteuer 390 %. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt in MV (Grundsteuer A=335 %, Grundsteuer B=392 % und der Gewerbesteuer=348 %) liegt die Gemeinde Bülow erheblich über den Hebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden.
Diese drastische Erhöhung der Steuern über den Durchschnitt kann keine Antwort auf die anstehenden finanziellen Probleme sein. Die Handhabung ist zu einseitig und vereinfacht zudem nicht die Lebensbedingungen der Bevölkerung im ländlichen Raum. Ein Kassensturz und eine über den Tellerrand hinausschauende Sichtweise sind notwendig, um andere Einnahmequellen zu generieren, wenn man weiterhin als Gemeinde bestehen möchte. Eine ernsthafte Sparsamkeit in den nächsten Jahren wird notwendig sein, um als Gemeinde seine Eigenständigkeit bewahren zu können.
Daher ist es notwendig, dass die anhaltenden negativen Finanzbedingungen in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden, damit die Verantwortung für die kommende Generation mit den Herausforderungen der Dekarbonisierung einhergehen kann. Aufgrund einer langfristigen Finanzplanung und Finanzpolitik bis 2030 kann sich die Kommune einer Debatte über eine mögliche Gemeindefusion nicht mehr verschließen.
Die wesentliche Aufgabe der zukünftigen Parlamentarier in fünf Monaten sollte darin bestehen, sich sofort nach Ihrer Ernennung mit dem Haushaltsentwurf 2025 auseinanderzusetzen und ein neues finanzpolitisches Konzept bis 2030 zu erarbeiten.
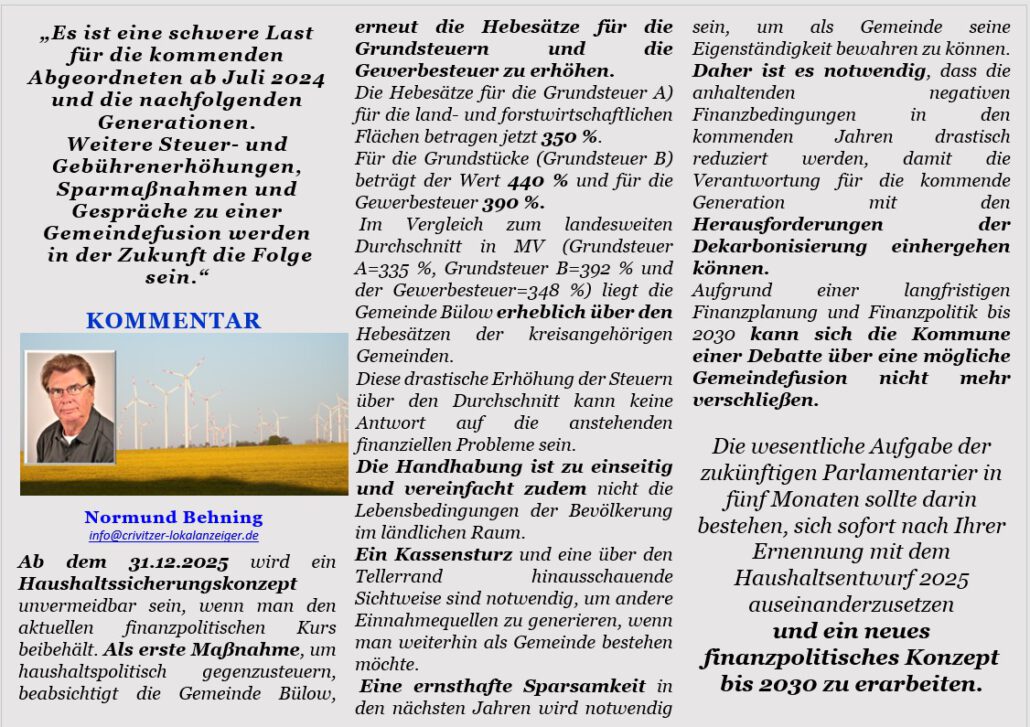
09.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./339[163(38-22)]/CLA-176/14-2024

Wo befindet er sich derzeit? Ist das Geld für die Finanzierung nicht mehr verfügbar?
Was ist ein Bürgerhaushalt?
Im Allgemeinen beschränkt sich das Mitspracherecht der Bürger hierbei auf Teile des Investitionshaushalts (ein bestimmtes Projekt). Ein derartiger Haushalt darf allerdings keinesfalls als Form direktdemokratischer Mitsprache fehlinterpretiert werden. Die Impulse seitens der Bürger haben vielmehr den Charakter wertvoller Informationen für den Entscheidungsfindungsprozess der Abgeordneten in der Stadtvertretung. Die letztinstanzliche Entscheidung über den Haushalt obliegt weiterhin den demokratisch legitimierten Parlamentariern. Es geht stets darum, etwas „Zusätzliches (Geldvorrat) zu verteilen.“ Gibt es in Crivitz noch weitere finanzielle Mittel, die in der Zukunft 2025/26 verteilt werden können?
Auf Wunsch der Bürgermeisterin (Britta Brusch-Gamm) und der CWG – Crivitz sowie die Linke/Heine wurde die Idee eines Bürgerhaushaltes nur auf der Sitzung des Hauptausschusses am 11.10.2021 einmalig beraten. Bereits 14 Tage später, auf der folgenden Stadtvertretersitzung am 25. Oktober 2021, wurde die Einführung eines Bürgerhaushaltes für 2022 durch die Mehrheitsfraktionen CWG-Crivitz +die LINKE/Heine beschlossen. Die Stadt Bützow war damals und heute das Vorbild für das Projekt, so erklärte es die Bürgermeisterin. (Ein Schelm, wer da einen geschichtlichen Zusammenhang vermutet, ACHTSAMKEIT im Charme des Momentes).
Nach der ersten Sitzung im Hauptausschuss im Jahr 2021 passierte zunächst gar nichts. Fast 24 Monate später fand wieder eine Sitzung des Hauptausschusses statt. Die Beteiligten aus Bützow wurden gezielt eingeladen, gemeinsam mit der Bürgermeisterin die Variante der Einführung eines Bürgerhaushaltes zu präsentieren. Plötzlich erkannte man, dass die Vorgänge nicht so verlaufen könnten, wie es geplant waren. Es war erforderlich, eine Satzung zu erstellen, um die Umsetzung zu gewährleisten. Dieses Problem stellte erneut 2023 eine Herausforderung dar. Im November 2023 wurde ein Entwurf für eine Satzung besprochen. Alle waren begeistert von ihm.
Der Entwurf sah vor, dass die Laufzeit zunächst auf fünf Jahre begrenzt ist, aber sie kann jederzeit verlängert werden. Die Stadt Crivitz soll ein eigenes Budget für die Einwohner der Stadt Crivitz einrichten, das mindestens 15.000,00 € jährlich betragen soll. Es soll jedem Einwohner von Crivitz freistehen, Vorschläge zur Abstimmung schriftlich und elektronisch einzureichen bis zum 30.04. des Jahres. Der vollständige Name, die Anschrift und das Geburtsdatum müssen angegeben werden. Nach Ablauf des 30.04. wird eine Prüfung durch die Amtsverwaltung auf Zuständigkeit und Kosten durchgeführt.
Die Prüfung des Vorhabens bzw. des Vorschlags erfolgt anhand der folgenden Punkte:
1. Es muss – konkret, umsetzbar und in der Zuständigkeit der Stadt liegen;
2. Es sollen – keine hohen und ständigen Folgekosten nach sich ziehen;
3. Es dürfen – keine Doppelförderung und max. 10.000 € je Vorschlag und,
4. Es muss-der Allgemeinheit zugutekommen und nicht gegen geltendes Recht verstoßen.
Im Anschluss daran sollen alle Einwohner (ab 12. Jahre!) über die eingereichten Vorschläge in einer öffentlichen Veranstaltung oder auch online abstimmen. Angeblich soll das Resultat der Abstimmung bindend für die Abgeordneten sein.
Die Vorschläge, die in das Bürgerbudget aufgenommen wurden, sollen zeitnah, spätestens jedoch im Folgejahr, umgesetzt werden. Der Aufwand, der hier beschrieben wird, ist schon sehr hoch, wenn man bedenkt, dass für die Erstellung/Druck von Handzetteln zur Information für die Bürger mindestens 5.000,00 € an Kosten anfallen. Zumindest in der Musterstadt Bützow musste man diese Erfahrung machen. Mindestens eine Vollzeitkraft ist erforderlich, um die Vorbereitung und Prüfung über das gesamte Jahr hinweg durchzuführen. Die genaue Höhe des Aufwands ist bisher nicht abzuschätzen, aber auf jeden Fall kann das Amt Crivitz diese Dienstleistung nicht noch zusätzlich erbringen. Dies wurde klar und deutlich bescheinigt.
Das ist erneut eine Probieraktion, nur mit der Folge, dass damit eine weitere Vollzeitstelle im Bürgerhaus geschaffen werden soll und dabei Kosten entstehen, die aus Steuergeldern finanziert werden. Seit Beginn der Haushaltsverhandlungen Anfang November 2023 wurde über dieses Projekt erneut geschwiegen.
Versprechen, beschlossen, gebrochen und wieder vergessen!
Kommentar/Resümee
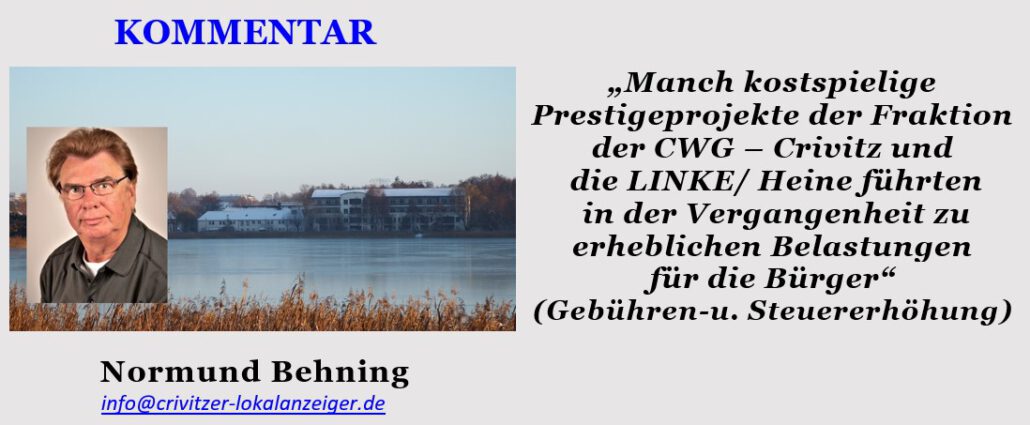
„Manch kostspielige Prestigeprojekte der Fraktion der CWG – Crivitz und die LINKE/ Heine führten in der Vergangenheit zu erheblichen Belastungen für die Bürger (Gebühren-u. Steuererhöhung).“
Es ist vorgesehen, ein separates Budget für 15.000,00 € einzurichten, doch die Vorschläge der Bürger sollten realisierbar sein und nicht über 10.000,00 € an Kosten verursachen. Es scheint, als ob diese Idee lediglich im Rahmen eines kurzen Wahlkampfes zur Geltung gebracht werden soll, um die Aufmerksamkeit der Wähler zu erlangen.
Auch aus den Ortsteilen kommen sicherlich noch einige Hinweise, da diese indessen einmal durch ihre beschränkte Einwohnerzahl in der Minderheit sind und eigene Vorhaben nur schwer erfolgreich durch die Abstimmung bringen werden. Es könnte auch interessant sein, ob die Daten über Personen wie Namen und Geburtsdatum gesammelt und ausgewertet werden dürfen. Da diese Informationen in der Lage sind, bestimmte Verhaltens- und Analysemuster sowie Analysen an jeder beliebigen Stelle zu platzieren und zu verwenden.
In dieser Wahlperiode wird sich nichts mehr ändern. Der Status quo bleibt unverändert. Daher wird die Abstimmung über die Vorschläge und deren Umsetzung frühestens im Juli oder August 2024 möglich sein, wo wir dann eine neue Stadtvertretung haben werden.
Die ganze Planung für den jährlichen Bürgerhaushalt steht allerdings unter dem „Damoklesschwert“, dass eine Genehmigung des Haushaltsplans im jeweiligen Jahr durch den Kreis LUP „nicht“ erforderlich ist und kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Andernfalls wird es für den Bürgerhaushalt nur noch 0,00 € geben.
Welches Schauspiel ist das denn? Eine Show bzw. Schaufenster kann nicht größer sein!
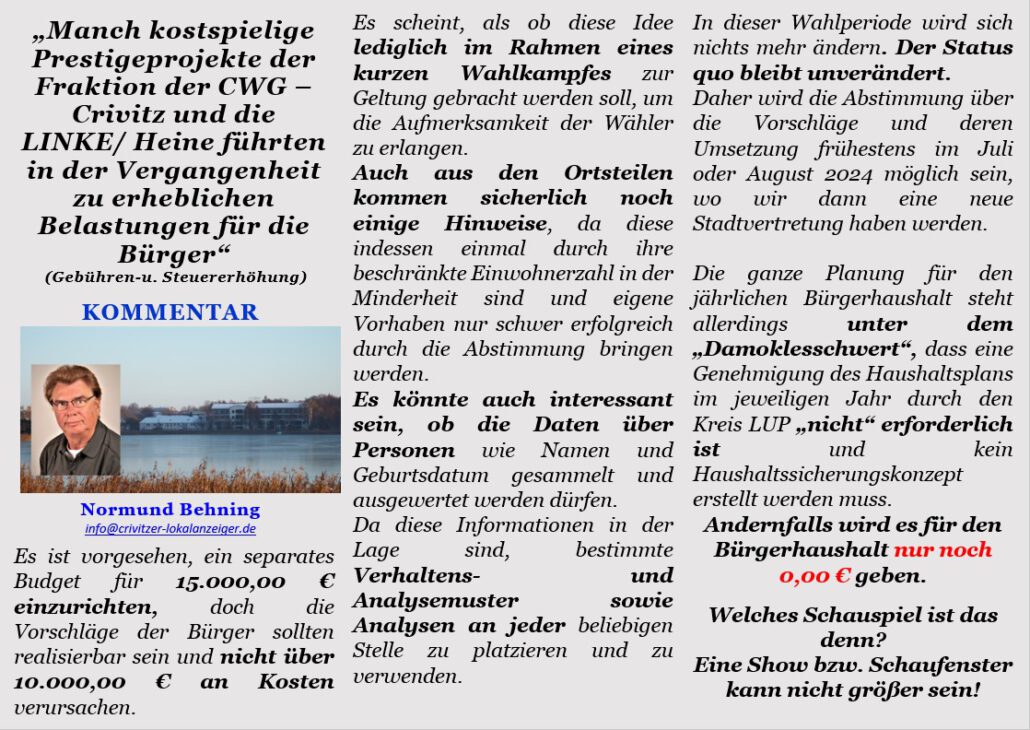
07.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./338[163(38-22)]/CLA-175/13-2024
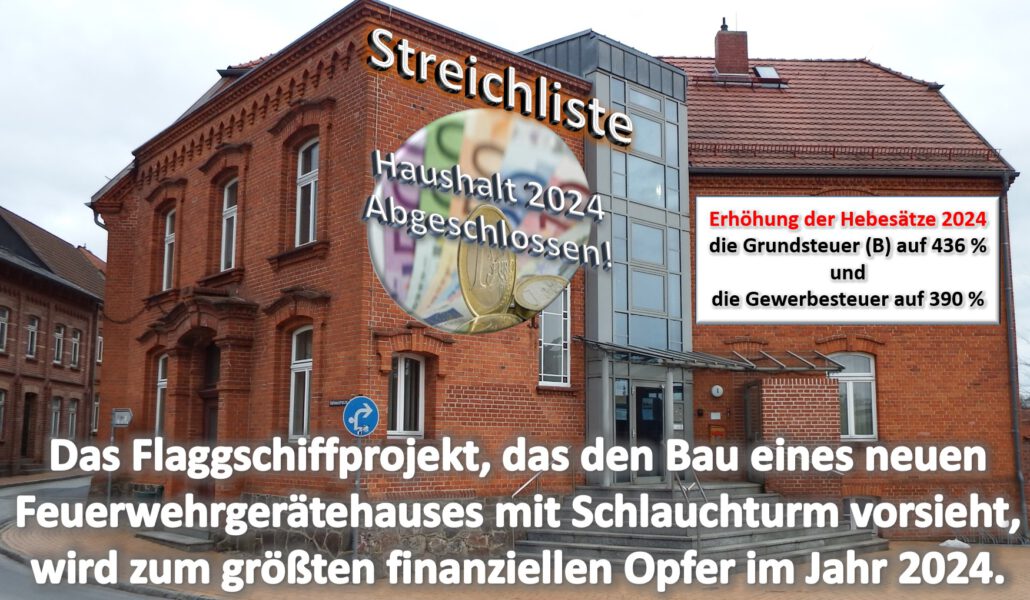
Das Flaggschiffprojekt im Wahlkampf der Fraktionen von CWG + die LINKE / Heine wird 2024 zum Investitionsopfer.
Die Unzulänglichkeiten bei der Planung und der abschließenden Kostenverteilung bei dem Projekt zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen für Investitionen und Förderungen im Haushalt 2024 nicht berücksichtigt werden können.
Dadurch wird aber der Finanzhaushalt der Stadt Crivitz im Haushalt 2024 gerettet und benötigt keine Genehmigung durch den Landkreis und ein Haushaltssicherungskonzept. Es verbleiben aber trotzdem nur noch 125.000,00 € an liquiden Mitteln am 31.12.2024, was die Finanzierung des Projektes durch einen Eigenanteil (445.000,00 €), obwohl eine Förderung erfolgen wird, erheblich erschwert, wenn nicht sogar um Jahre verzögert. Neue Kreditaufnahmen und die Erhöhung der Schulden werden die Folge sein. Daher entschied man sich für eine sofortige Steuererhöhungen in der Grund- und Gewerbesteuer, die ab dem Jahr 2024 einen zusätzlichen Ertrag von etwa 47.000,00 € pro Jahr bringen werden.
Wie konnte es dazu kommen? Hier der Ablauf:
Die Stadtvertretung hat im November 2022 überraschend und ohne vorherige Debatte in den Ausschüssen eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Crivitz für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen und stellte die notwendigen Mittel zur Verfügung. Aus akuter Platzproblematik plante die Stadt Crivitz, das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Crivitz zu erweitern, um 6 Stellplätze für MTW, diverse Anhänger und Geräte sowie zwei Lager-/Werkstatträume und einen Schlauchturm aufzunehmen. Für das Vorhaben musste ein Sonderbedarfszuweisungsantrag bis zum 30.11.2022 beim zuständigen Ministerium eingereicht werden. Zu diesem Zeitpunkt lagen lediglich eine Baukostenschätzung vom Oktober 2022 vor, die besagte, dass die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ca. 786.000 € und der Schlauchturm noch einmal 131.000 € kosten werden. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 917.000,00 €.
Es dauerte bis zum 16. November 2023, bis Herr Sebastian Zapf (Sachbearbeiter im Bauamt des Amtes Crivitz – Gebäude, Liegenschaften und Hochbau) im Bauausschuss der Stadt Crivitz erschien und über den aktuellen Stand der Planung berichtete. Er sagte noch vollmundig, dass der Antrag auf Sonderzuweisung für das Vorhaben fristgerecht gestellt wurde und die Planungen in der Ausführung sich befinden. Nach seinem Kenntnisstand wird derzeit an einem Bodengutachten gearbeitet und die Ergebnisse sollen dann in den Bauantrag eingearbeitet werden. Er gehe davon aus, dass der Bauantrag bis zum Januar 2024 gestellt wird und anschließend bearbeitet werden kann. In der Gesamtbetrachtung wurde festgestellt, dass alles in Ordnung ist und alles perfekt funktioniert.
Es sollte jedoch anders kommen!
Im Januar 2024 wurde eine Kriesensitzung abgehalten, in der über den Haushalt 2024 debattiert wurde. Es wurden einzelne Ausgaben gestrichen und verschoben, damit das große Projekt noch im Wahlkampf 2024 beginnen kann. Als dann in der letzten Hauptausschusssitzung Ende Januar 2024 eigentlich der Haushalt nur noch pro Forma beschlossen werden sollte, platzte das gesamte Vorhaben schließlich.
Aus Sicht des Amtes für Finanzen sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, um die Auszahlungen für Investitionen und Förderungen im Haushalt 2024 zu verwenden. Da bis jetzt kein Bauplan und detaillierte Berechnungs- und Erläuterungen zu diesem Projekt vorhanden sind, was eine Bewertung dieses Projektes somit unmöglich macht.
Leider hat das Amt für Finanzen an dieser Stelle vollkommen recht, da die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik bereits am 9. November 2023 in Kraft getreten ist. Und diese Verordnung besagt: „Nach § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik dürfen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind.“
Und besonders wichtig ist dabei zu beachten: „Insoweit liegt eine Veranschlagungsreife von Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich erst mit dem Abschluss der Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung (entspricht der Leistungsphase 3 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI – für Objekt- und Fachplanung), bei einer vorgesehenen Einwerbung von Investitionszuweisungen ggf. auch erst mit Abschluss der Genehmigungsplanung (entspricht der Leistungsphase 4 nach HOAI) vor.“ Da nun die beiden Phasen seit 14 Monaten nicht erreicht wurden, ist das Projekt 2024 nicht als Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen zulässig. Auch eine Baugenehmigungserteilung wird voraussichtlich ca. 470 Tage in Anspruch nehmen, sodass erst im Haushalt 2025 mit Fördermitteln gerechnet werden kann und das Projekt bis 2026/27 wahrscheinlich dauern wird.
Das Kuriose daran ist und erhitzt jetzt alle Gemüter, dass diese neuen haushaltsrechtlichen und -wirtschaftlichen Hinweise zur Haushaltsplanung 2024 vom Ministerium seit November 2023 im Amt für Finanzen bekannt sind. Bereits während der Sitzung des Finanzausschusses des Amtsausschusses am 15.11.2023 wurde darauf hingewiesen und es wurde festgehalten, dass es lediglich die Kommunen betrifft.
Jedoch, weshalb bis heute noch kein Bauantrag mit einer exakten Kostenverteilung nach 14 Monaten im Umlauf ist, bleibt wie immer ein Rätsel im Verborgenen im Amt Crivitz!
Kommentar/Resümee
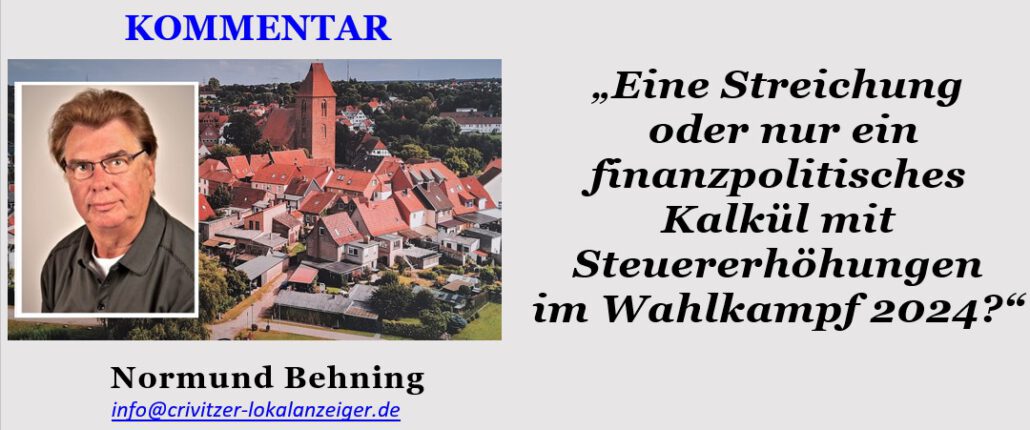
Eine Streichung oder nur ein finanzpolitisches Kalkül mit Steuererhöhungen im Wahlkampf 2024?
Das Ziel war es, ein weiteres Monument für den Wahlkampf 2024 zu errichten, doch indessen werden nach ca. 400 Tagen endlich alle Unwägbarkeiten sichtbar. Es wird vermutet, dass die Kommunikation zwischen den Fachbereichen und den Ausschüssen in der Stadt Crivitz mangelhaft war. Nun wurden jedoch wie gewohnt die Sünden identifiziert und die Schuldzuweisungen durchgeführt, wobei zahlreiche persönliche Gespräche angekündigt wurden.
Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion die LINKE/Heine, Herr Alexander Gamm kündigte an, mit dem Amt für Finanzen im Amt Crivitz eine Aussprache führen zu wollen. Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion CWG- Crivitz, Herrn Andreas Rüß, hatte sich offensichtlich deutlich aus dieser Debatte zurückgezogen, wohl wissend, dass die Haushaltsführung damit im Wahlkampfjahr 2024 durch diese Kürzungen gerettet wurde. Stattdessen wurde eine sofortige Steuererhöhung beschlossen.
Auch die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm nahm die Situation sehr gelassen auf, da sie gleichzeitig Amtsausschussvorsitzende im Amt Crivitz ist. Ihr Hauptaugenmerk lag auf dem Beschluss zu den Steuererhöhungen.
In gewohnter Manier glänzte die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) mit einer vollständigen Abwesenheit. Die Vertreter der CDU-Fraktion im Bauausschuss (Frau Beate Werner und Herr Jens Reinke) waren in den vergangenen etwa ca. 21 Monaten im Hauptausschuss nie komplett vertreten, wenn überhaupt, dann nur teilweise oder gar nicht. Man darf gespannt sein, wie die Darsteller der CWG – Crivitz und der LINKE/ Heine und der CDU sich inzwischen neu erfinden werden.
Es reicht vollkommen aus, lediglich den Notruf zu wählen oder das Schiff zu verlassen!
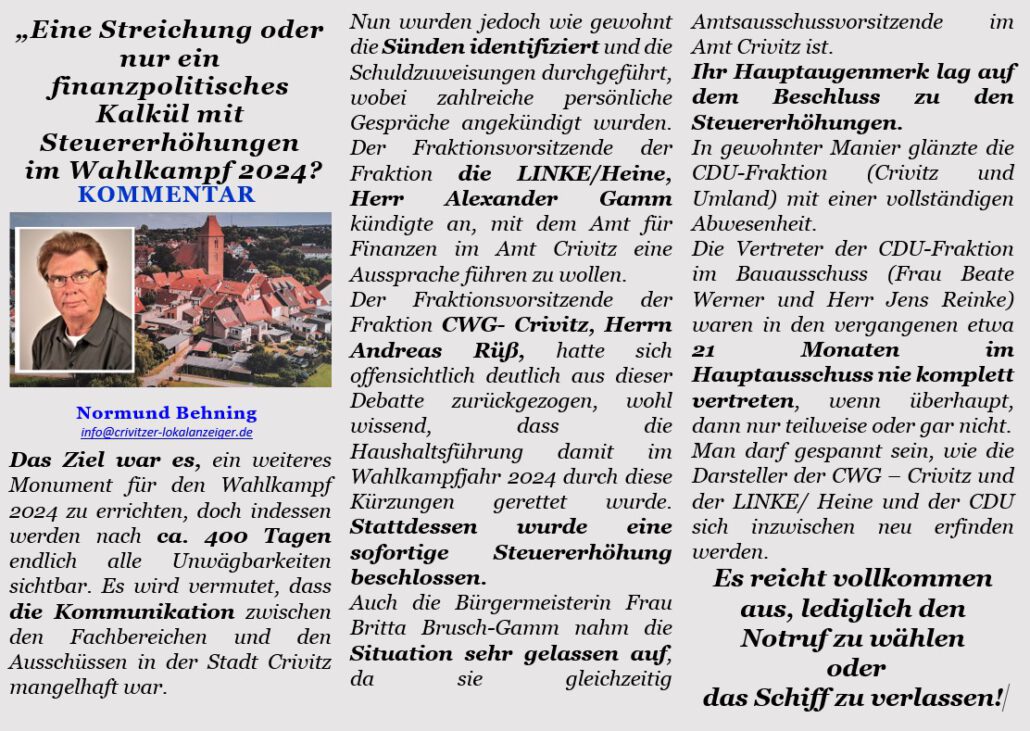
04.Febr.-2024/P-headli.-cont.-red./337[163(38-22)]/CLA-174/12-2024
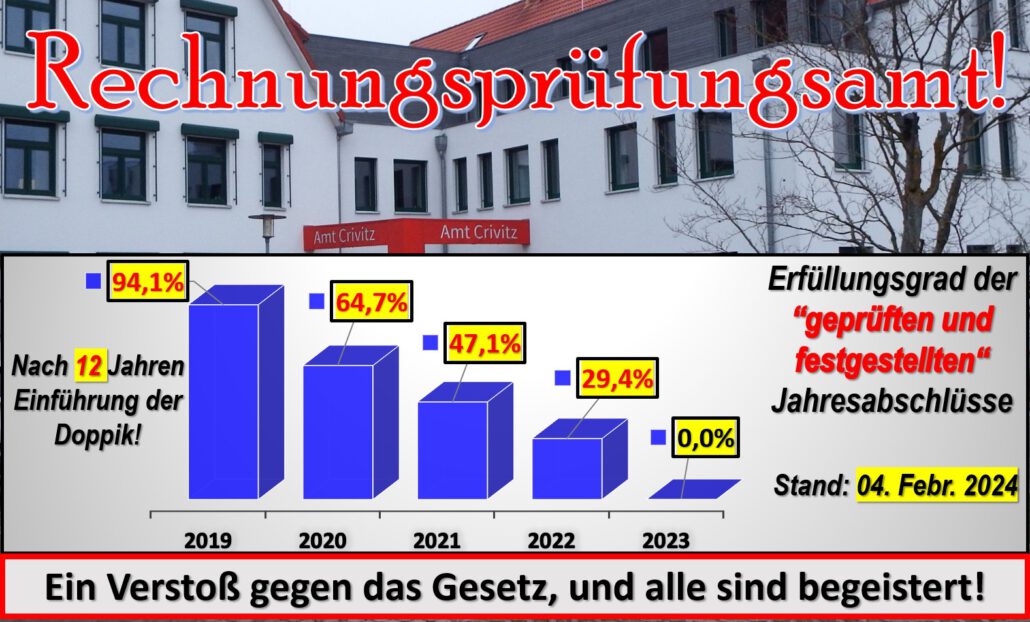
Sicherlich liegt es im Fokus der Rechtsaufsicht in LUP und des Landesrechnungshofes MV, sich im Bereich von Amt Crivitz genauer umzuschauen!
Die Priorisierung der Prüfungen für die Jahresabschlüsse ist die neue Devise oder besser gesagt das Schlüsselwort für das Jahr 2023/24 und wird von der Amtsvorsteherin Frau Iris Brincker vom Amt Crivitz praktiziert. Wegen Anträgen von einzelnen Kommunen auf Sonderbedarfszuweisungen (SBZ) für Investitionen wurde die Reihenfolge der Prüfungen für die Jahresabschlüsse (2019–2023) geändert. Begründung: „Wir werden die Reihenfolge der Prüfungen an die Antragstellungen der Gemeinden für SBZ anpassen, da für das Auswahlverfahren 2024 der Jahresabschluss 2021 erforderlich ist, um den vollen Fördersatz bewilligt zu bekommen.“(Protokoll Juli 2023) Der Amts- und Hauptausschuss empfahl, dass die weiteren Berichte zur Rechenschaftslegung der Amtsvorsteherin bis zum Januar 2024 eigentlich dem Protokoll als Anhang öffentlich einsehbar sein sollten, allerdings bleiben sie wie bisher streng geheim. Dies stellt keine Neuheit dar, da die gesamte Informationspolitik, insbesondere im Hinblick auf heikle Themen, bereits seit August 2023 nicht mehr so strikt durchgeführt wird wie zuvor.
Die Kommunen Leezen, Bülow, Cambs, Friedrichsruhe und Raben Steinfeld haben bereits ihre Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 festgestellt und bekannt gemacht.
Die Gemeinden Suckow und Banzkow sowie die Stadt Crivitz haben ihre Jahresabschlüsse bis 2021 bestätigt.
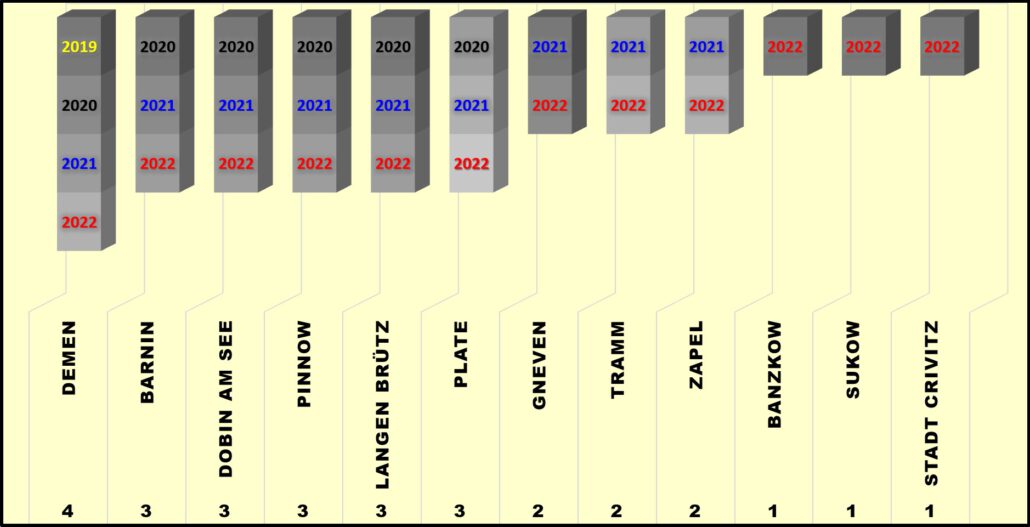
Demnach ist die Mehrheit (9) der insgesamt 17 Kommunen im Amtsbereich Crivitz aus dem Raster des sogenannten Priorisierungsprozesses herausgefallen.
Die Gemeinde Demen, deren letztgültiger Jahresabschluss aus dem Jahr 2018 stammt, ist am schlimmsten betroffen. Wie glaubwürdig soll der aktuelle Haushaltsplan für Demen, der für das Jahr 2024 vorgesehen ist, wenn lediglich Jahresabschlüsse für das Jahr 2018 festgestellt und veröffentlicht wurden? Die Daten in diesem Haushaltsplan 2024 basieren hauptsächlich auf fortgeschriebenen Rechnungsergebnissen oder kumulierten Ergebnisvorträgen sowie auf angenommenen Planungsdaten bis 2026. Wieso wird diese Vorgehensweise schon seit Jahren geduldet?
Zumal in der Planung für das Jahr 2024 der Ergebnishaushalt der Gemeinde Demen ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen aufweist von (-) 481.300 €. Ebenfalls im Planjahr 2024 wird ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht um 525.800 €. Es kommt noch ein Saldo aus den Investitionstätigkeiten und einen Saldo aus den durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen hinzu. Dadurch sinken die liquiden Mittel der Kommune von 1.411.465 € auf nur noch 704.965 € bis zum 31.12.2024. Dies führt letztlich zu einem Rückgang des Eigenkapitals um 474.978 €.
Es fehlen seit dem 01.01.2024 noch ca. 28 *aufgestellte*, *geprüfte* und *festgestellte*Jahresabschlüsse seit 2018 für die Kommunen. Bis zum 31.05.2024 müssen weitere 17 Jahresabschlüsse des Jahres 2023 *aufgestellt* sein, wie es die Kommunalverfassung M-V vorsieht.
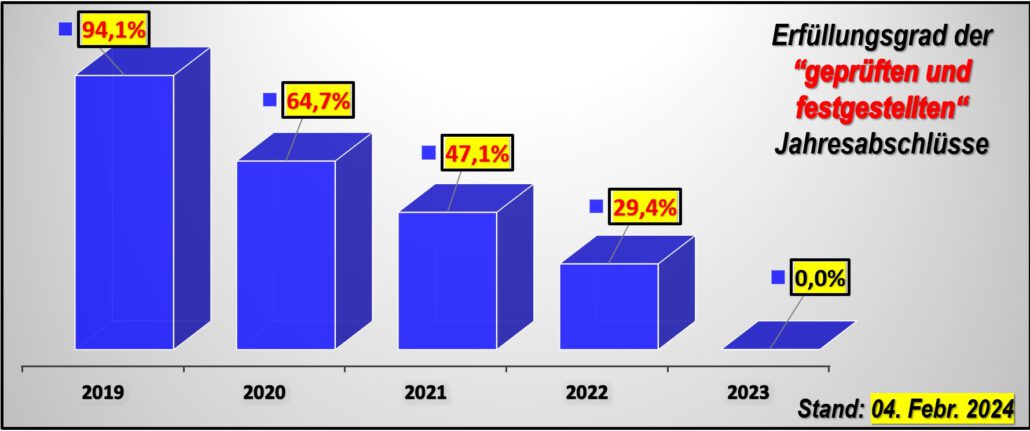
Dies führt zu 45 fehlenden Jahresabschlüssen der Gemeinden für eine genaue Haushaltsplanung 2024/25 und der Darstellung der Finanzplanung bis zum Jahr 2026. Sind die amtsangehörigen Gemeinden weiterhin bereit, die Handhabung der Verwaltung des Amtes, insbesondere des Rechnungsprüfungsamtes, auch 125 Tage vor der Kommunalwahl 2024 zu akzeptieren?
Etwa 24 % der Gemeinden des Amtes Crivitz haben (Stand 05.02.2024) noch keine gültige Haushaltssatzung für das Jahr 2024 und befinden sich derzeit in einer vorläufigen Haushaltsführung, auch als Interims- oder Übergangswirtschaft bzw. Nothaushaltsrecht bezeichnet. Die meisten Gemeinden (ca. 76 %) des Amtes Crivitz haben aber ihre Haushaltspläne für das Jahr 2024 trotz fehlender Jahresabschlüsse verabschiedet im Dezember 2023 und Januar 2024.
Aber, etwa 35 % der Gemeinden im Amtsbereich haben ihre Haushaltspläne 2024 bereits im Februar 2023 beschlossen, obwohl sie danach noch viele Jahresabschlüsse aus früheren Jahren bis Dezember 2023 erhalten haben. Das sind die Gemeinden Zapel, Raben Steinfeld, Suckow, Tramm, Langen Brütz und Gneven. Wie belastbar diese Pläne derzeit noch sind, ist bis zum 31.12.2024 tatsächlich nicht zu beurteilen. In diesen Kommunen muss man sich wirklich sehr sicher sein, dass die nachfolgenden Abgeordneten die Haushaltsführung ohne Sorge übernehmen können. Wer entlastet dann die Bürgermeister für geprüfte und Jahre zurückliegende Jahresabschlüsse, wenn sie nicht mehr im Amt sind nach der Wahl? Wer übernimmt dann die Verantwortung für die zurückliegenden geprüften Vorgänge und die noch verbleibenden liquiden Mittel der Jahresabschlüsse?
Gemäß Kommunalverfassung MV § 60 (4) ist der Jahresabschluss innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres „aufzustellen“. Die Vertretung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres „zu beschließen“. Auch wenn die Kommunen für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 von einer gesetzlich getragenen Fristverlängerung Gebrauch machen konnten, hätten diese spätestens bis zum 31. Dezember 2021 oder 31. Dezember 2022 festgestellt sein müssen.
Seit der Einführung der Doppik 2012, die eine nachhaltige Steuerung der Haushaltswirtschaft anstrebt, ist es dem Amt Crivitz in seiner zehnjährigen Geschichte bisher nicht gelungen, dieses Element im Amtsbereich bei den Gemeinden umfassend zur Wirkung kommen zu lassen. Wird dieser Verstoß weiterhin ungehindert fortgesetzt?
Kommentar/Resümee
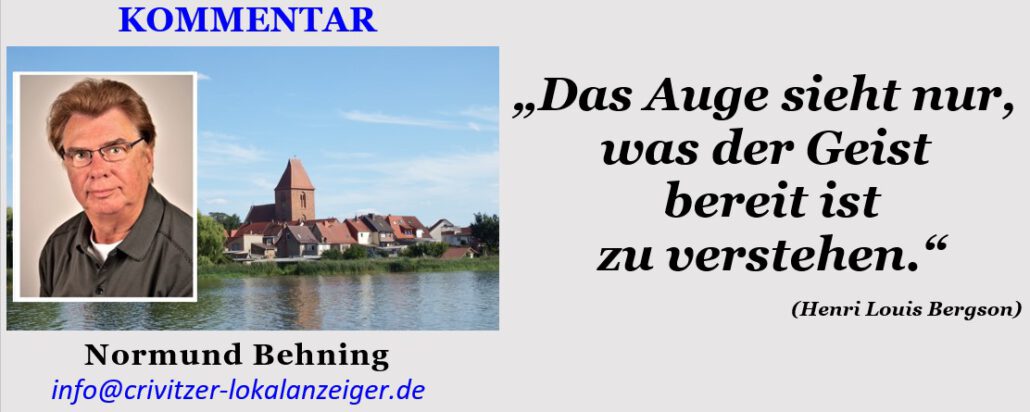
„Das Auge sieht nur, was der Geist bereit ist zu verstehen.“(Henri Louis Bergson)
Nur ein aktueller Jahresabschluss nach dem Gesetz ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit und den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune für die Haushaltsplanungen der Folgejahre zu erkennen. Der Jahresabschluss soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft nachweisen. Über Jahre fehlende Jahresabschlüsse sind keine FORMALIE, sondern ein Verstoß gegen gesetzlich normierte Haushaltsgrundsätze und lassen Zweifel an der geordneten Haushaltswirtschaft der betreffenden Kommunen aufkommen. Die Verwendung eingesetzter Steuermittel wird ohne aktuelle Jahresabschlüsse nicht transparent nachgewiesen.
Ehrlicherweise wird jeder, der seine Steuererklärung nicht fristgerecht abgibt, mit Sanktionen und Zinszahlungen belegt. Wenn ein Unternehmen seine Pflicht nicht und nicht rechtzeitig erfüllt, seine Jahresabschlüsse zu erstellen und offenzulegen, führt das Finanzamt ein Ordnungsgeldverfahren gegen das Unternehmen. Zusätzlich überprüfen Finanzämter, Banken und Lieferanten das Ergebnis, das die Kreditwürdigkeit des Unternehmens bewertet und als Grundlage für die Steuererklärung und die Gewinnverwendung dient.
Die Kommunen, die Steuergelder verwalten, sollen angeblich über Jahre hinweg ihre Jahresabschlüsse verzögern können. Auch der Landesrechnungshof des Landes MV hat diese Handhabung mehrfach angemahnt. Die gesetzlichen Regelungen und Fristen zum Einreichen der Jahresabschlüsse sind vom Gesetzgeber eigentlich eindeutig, mit Stichtagen vorgeschrieben und werden seit Jahren nicht eingehalten.
Werden nun endlich alle Aufsichtsbehörden die notwendigen Maßnahmen ergreifen?
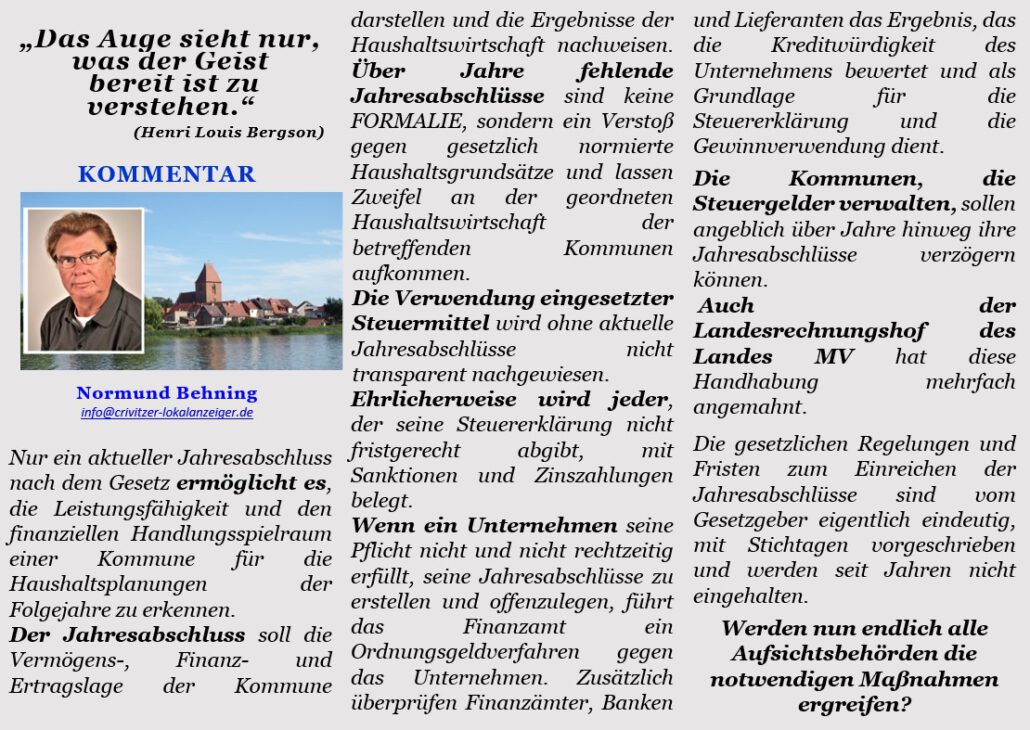
30.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./336[163(38-22)]/CLA-173/11-2024

Im Rahmen der ersten öffentlichen Sitzung des Senioren- und Behindertenbeirates SBB, die im März 2023 abgehalten wurde, wurde das Projekt „City-Bus in Crivitz“ präsentiert. Es handelte sich um eine kleine Inszenierung, ähnlich wie bei einer Pressekonferenz oder einem Auftritt zu einer Werbeveranstaltung. Auf den Sitzflächen waren zuvor gedruckte Prospekte und Handzettel für einen City-Bus zu sehen.
Sicherlich musste das alles so sein, denn es waren eine Bürgerin, zweimal die Presse (CLA + SVZ), ein Vorstandsmitglied der Volkssolidarität Ortsverband Crivitz (Herr Alexander Gamm), zwei Abgeordnete der CWG – Crivitz Fraktion sowie eine Angestellte aus dem Bürgerhaus gekommen. Das war alles, was an Besuchern gekommen war. Gleiches gilt für die darauffolgenden Events! Es folgten weitere Phasen des Projekts und Ausgaben, bis schließlich am 4. September 2023 endgültig feststand, dass die Finanzierung des Projekts gestoppt werden musste. Begründung: Die Nutzung des Busangebotes durch die Bürger ist seit Monaten eher mäßig zu bewerten. Seit dem Sommer übernahm die Stadt die Kosten für den Ausfall. Erst überschaubar und danach war es kostentechnisch nicht mehr zu bewältigen. Die Einstellung des Projekts wurde beschlossen. Nun wird das Geld für einen Imagefilm eingesetzt, inklusive aller notwendigen Begleitpersonen und zahlreicher Akteure. Also ist die Mission gescheitert.
Dann kam den Mehrheitsfraktionen, die CWG – Crivitz und die LINK/Heine plötzlich eine Idee, weil eine Neuwahl 2024 bevorstand, die Hauptsatzung für den SBB erneut nach ca. 11 Monaten zu ändern. Es war vorgesehen, dass die Amtszeit des SBB nicht mehr der Amtszeit der Stadtvertretung entspricht, sondern ab dem Zeitpunkt der Bestellung für etwa fünf Jahre. Diese Regelung würde bedeuten, dass der SBB ab diesem Zeitpunkt keine Neuwahl durchführen müsse.
Die Beschlüsse hierzu wurden bereits im November auf der Stadtvertretung mit der Mehrheit von CWG +Linke /Heine massiv durchgefochten, ohne auf jegliche Diskussionen einzugehen oder erst in den Ausschüssen darüber zu beraten. Diese Methode ermöglicht es, seine engen und handverlesenen Vertrauten im SBB bis zum Jahr 2028 effektiv abzusichern (Postensicherung). Diese Neuregelung, welche bis jetzt nicht rechtskräftig ist, dürfte im Nachhinein mit Sicherheit zu weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen führen, aber bis dahin ist die Kommunalwahl vorbei und es könnten andere Verhältnisse in der Mehrheit bestehen.
Auf unerwartete Weise kam danach plötzlich von Frau Ursula Fritzsche (stellv. Vorsitzende SBB) die Idee noch vermutlich eben in der Weihnachtszeit, einen mobilen Pavillon für den SBB zu erwerben. Es wurde veranschlagt, dass dieser mobile Pavillon weit über 1300 € kosten wird. Also muss es sich um einen luxuriösen Pavillon handeln. Daher wurde im Verlauf der laufenden Haushaltsdebatte der Vorschlag an die Abgeordneten im Dezember 2023 übermittelt, umso einen Zuschuss für den Pavillon zu erhalten. Da man bedauerlicherweise nur ein eigenes Budget von 1000,00 € besitzt. Der Versuch blieb erfolglos.
Begründung: Da der SBB in Crivitz bereits ein festes Budget von 1000 € erhält und es ihm jährlich neu zugesagt wird, muss er mit diesem Budget auskommen. Es ist unmöglich, es ständig aufs Neue zu variieren, da es sich immer nur um einen kurzen Zeitraum handelt. Außerdem ist es eine Investition, und die kann nach der Satzung nicht als solche verauslagt werden. Dies wurde während der Diskussion im Umweltausschuss so verdeutlicht.
Was also tun, um diesen Pavillon zu erhalten, der über 1300 € kostet? Es war notwendig, ein Wunder zu erwirken! Das Wunder trat dann auch plötzlich ein. Zunächst wurde der SBB in die Budgetverhandlungen zum Haushalt der Stadt Crivitz eingebunden, was schon sehr ungewöhnlich ist, da hier Daten und Fakten in nicht öffentlichen Bereichen diskutiert werden, bei denen auch kein einfacher Bürger oder ein Pressevertreter anwesend sein darf.
Dann kam das Wunder!
Die geplante Maßnahme will man als eine Art investive Maßnahme betrachten, und die Stadt wolle nun einen Fördermittelantrag stellen, wonach dann ausreichend finanzielle Mittel fließen können, um den Haushalt 2024 nicht zu belasten. Die Bürgermeisterin Frau Brusch – Gamm hat das Vorhaben in der Sitzung des Hauptausschusses verkündet und es sofort durch die Fraktion der CWG und die LINKE/Heine beschließen lassen. Ohne zusätzliche Diskussionen oder Erläuterungen zu dem, warum diese Investition jetzt überhaupt durchgeführt werden muss. Es ist ebenso, wie es ist! Es ist eben Wahlkampfzeit!
So werden also Wunder wahr und es bleibt abzuwarten, wo der SBB überall mobil sein will im Jahr 2024?
Kommentar Resümee

„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“―Thomas von Aquin
Seit 2021 war die Gründung des SBB von Untätigkeit blockiert, lamentiert und es wäre durchaus möglich, es als eine Folge von Pleiten und Pannen zu bezeichnen. Die Frage, ab wann man nun als Senior gelte und mitarbeiten könnte, wurde bis heute nicht beantwortet! Abgesehen von der Mitteilung, dass 70 das neue 60 ist, war dies alles, was an Botschaften verkündet wurde.
An dieser Stelle muss man darauf hinweisen, dass der SBB bislang nicht viel in den Kommunalprozess eingegriffen hat, außer Gelder abzuverlangen. Wie er sich bei den Fragen zu Bauvorhaben oder Zuständigkeiten verhalten soll, ist bis dato nicht vollständig geklärt worden? Es ist ebenso denkbar, dass die Verantwortlichen des SBB bisher nicht genau wissen, an welchen Stellen und in welchem Umfang Maßnahmen ergriffen werden sollten oder können. Die Durchführung von Veranstaltungen zur Prävention von Schäden und zur Gesundheitsvorsorge und Sicherheit sollte den Fachleuten überlassen werden.
Auch die Vorstellungen zur Handhabung des Internets und der Handynutzung kommen von den Mehrheitsfraktionen und einer ehemaligen Kulturausschussvorsitzenden. Das kann man alles seit Jahren nachlesen! Weiteres Schaulaufen auf höherer Ebene ist nicht sinnvoll, da es für die Tätigkeit in Crivitz nicht von Nutzen wäre, abgesehen von der eigenen persönlichen Darstellung und kommunalpolitischen Karriere.
Was sollte ein Senioren- und Behindertenbeirat eigentlich machen?
– Der Senioren- und Behindertenbeirat sollte nicht nur Ideen und Erlebnisse schaffen, die Wohlbefinden, Lebensfreude und Geborgenheit bringen, sondern er sollte sich auch aktiv in die Handlungen und Beschlüsse der Stadt Crivitz einmischen. Kurz gesagt: Die Arbeit des SBB ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die alle kommunalen Ressorts wie Stadt-, Verkehrs-, Bau-, Kultur-, Finanz-, Natur- und Umwelt, Wirtschafts- und Freiraumplanung einbezieht. Nicht nur zu empfehlen, sondern auch praktische Lösungen anzubieten, ist gefragt. Nicht ausschließlich Events für das Schaufenster!
– Nachbarschaftliche Hilfenetze und Nachbarschaftsaktivitäten mit unterschiedlichsten Schwerpunkten anbieten.
– Straßen und Plätze müssen auch für mobilitäts- oder sinneseingeschränkte Menschen ohne Barrieren zugänglich gemacht werden. – Bauvorhaben mitbewerten und die Planungen nach den Belangen für Senioren- und Bürger mit Behinderungen ausrichten.
– Es ist wichtig, sich mehr um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zu kümmern und ein Netzwerk für Selbsthilfe aufzubauen.
– Sich für die Herstellung und den Ausbau barrierefreier öffentlicher Parkanlagen und Treppen einsetzen.
Der SBB sollte in Crivitz sich nicht als rein parteipolitisch oder konfessionell ausgerichtet erweisen, sondern als unabhängiges Organ für alle Senioren und Bürger mit Behinderungen agieren.
So sollte es sein!
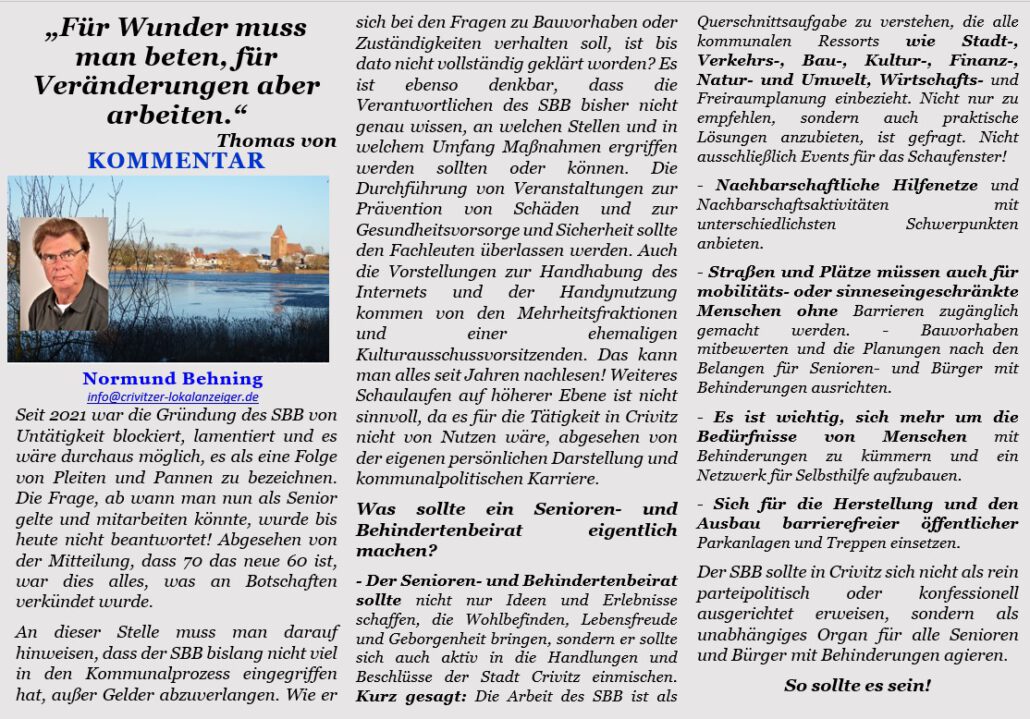
28.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./335[163(38-22)]/CLA-172/10-2024
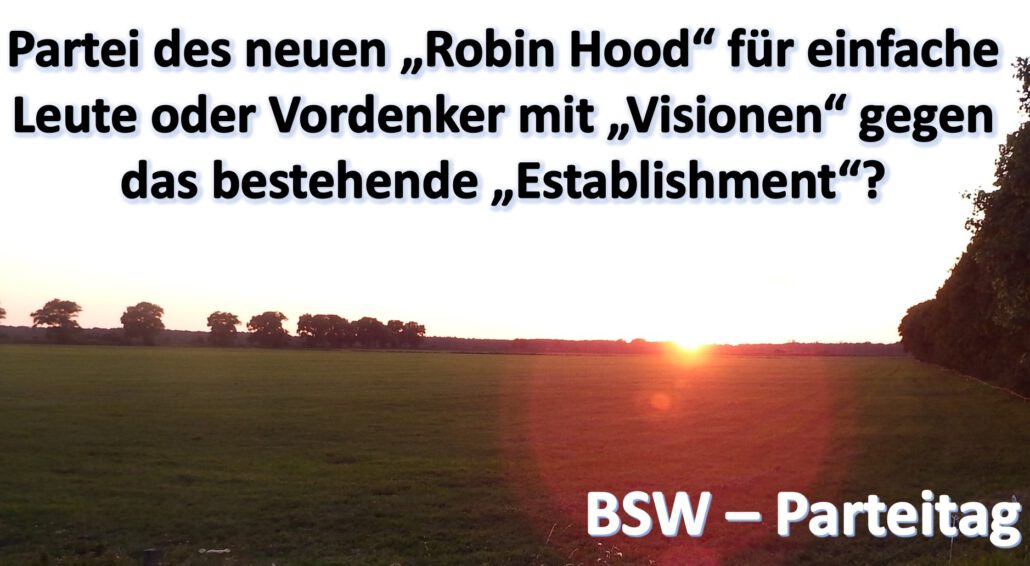
Es handelte sich um einen streng organisierten Parteitag, mit handverlesenen ca. 382 Mitgliedern, der in seiner Struktur dem Ostblock ähnelte, ähnlich dem, wie man es aus früheren Zeiten kannte. Eine überwiegende Anzahl von älteren Männern, die sich bereits im Vorfeld über die Kandidaten und die Verteilung der Positionen einig waren. Die Delegierten kamen aus allen Bundesländern. Mit 53 Mitgliedern gehörten die Mitglieder aus der Hauptstadt zu einer der größten Gruppen. Die größte Gruppe kam aus Nordrhein-Westfalen (73) und die kleinste aus Bremen (7). Es war klar ersichtlich, dass hier schon vorab eine gewisse Absprache bezüglich Positionen getroffen wurde, da niemand von den Delegierten Fragen jeglicher Art oder Gegengenreden an die Kandidaten äußerte.
Genauso erstaunlich war, dass ehemalige Referenten und Mitarbeiter von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, die sich unüblich aus der Fraktion verabschiedeten, plötzlich eine Position im erweiterten Vorstand der Partei einnehmen konnten. Die Wahl des Vorstands der Partei hat sich gelohnt: 17 der 22 Mitglieder sind Männer! Auch war es keinem der Anwesenden ein Anliegen, den bereits gefassten Beschluss über die Vorsitzenden und Stellvertreter sowie den Generalsekretär der Partei, am 08.01.2024, bei dem nur 40 Mitglieder anwesend waren, zu hinterfragen oder lediglich als Ergänzung noch einmal zur Abstimmung zustellen. Die Kandidaten für die Schiedskommission verzichteten sogar auf eine persönliche Vorstellung, da sie sich bereits in einem internen Dossier schriftlich vorgestellt hatten. Dies störte auch niemanden.
Außerdem verzichtete auch die Landeskoordinatorin Sabine Zimmermann für Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf eine persönliche Vorstellung ihrer Person, weil man alles schriftlich nachlesen konnte zu ihrer angeblichen Vita. Daher war ihr Fokus eher darauf gerichtet, sich um die Belange der Angestellten in Sachsen zu kümmern, in denen eine Firma Kürzungen im Personalbereich plant. Es ist möglich, dass die gebürtige Pasewalkerin mehr Interesse an Sachsen hat als an MV. Als ehemalige Gewerkschaftssekretärin des DGB auch in der Region Vogtland-Zwickau tätig sowie anschließender SPD-Mitgliedschaft, welche 2007 in die Partei Die LINKE mündete und erst kürzlich im Oktober 2023 endete. Also bekam sie sofort ein neues Format beim BSW seit dem 08.01.2024.
Es ist bemerkenswert, wie schnell man seine Ansichten wechseln kann und schließlich als glaubwürdig gilt vor allen anderen interessierten Unterstützern des BSW in MV. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, in MV Unterstützer für die BSW – Partei zu gewinnen und Strukturen im Land aufzubauen. Bisher existieren in MV keine überzeugenden Inhalte zu der anstehenden Politik oder Strukturen, doch in anderen Ländern ist die Entwicklung bereits deutlich fortgeschritten.
Es ist anzunehmen, dass sie sich intensiv mit sich selbst und ihrer Kandidatur auseinandersetzte, möglicherweise sogar mit einer äußerst genauen Überprüfung der Bewerber in MV. Wie bekannt, will die BSW-Partei neue Mitglieder genau durchleuchten. So soll es von Bedeutung sein, dass man sich kontrolliert entwickelt, auf Glücksritter, Karrieristen und Personen, die bestimmte Ansichten vertreten, verzichtet. Ist dies eine Abgrenzung oder Ausgrenzung von anderen?
Die Wertschätzung der Kandidaten ihren Mitgliedern gegenüber wurde auf dem Parteitag durch die Anrede in „Liebe Freunde und Freundinnen“ und „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ deutlich. Das letztere kam eher selten. Auch zu der Europapolitik war nur wenig zu hören, außer dass man die „normalen“ Bürgerinnen und Bürger nicht belasten möchte, aber die sogenannten Superreichen mehr zur Kasse bitten will. Es gab lediglich noch eine Vergangenheitsbewältigung von Fabio De Masi, dem Ex-Linken und ehemaligen Bundestagsabgeordneten in seiner Rolle bei der Aufklärung zum Cum-Ex-Skandal um Olaf Scholz.
So berichtete der Spiegel im Januar 2024: „BSW soll das bekommen, was auch Bundestagsfraktionen erhalten. Eine Entscheidung über den Status der Abgeordneten sei bereits in der nächsten Sitzungswoche des Bundestags möglich. Den Angaben zufolge läuft es für beide Gruppen darauf hinaus, dass sie den sogenannten Grundbetrag von derzeit 509.294 Euro pro Monat, der Fraktionen zusteht, zur Hälfte gezahlt bekommen. Außerdem sei eine Pauschalzahlung von monatlich 10.632 Euro für jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten im Gespräch, hieß es weiter. Der Betrag entspricht demnach dem, den auch die Bundestagsfraktionen erhalten. Zusätzlich ist ein Oppositionszuschlag vorgesehen. *Wie für die Fraktionen dürfte er *bei 15 Prozent auf den Grundbetrag beziehungsweise zehn Prozent auf den Pro-Kopf-Betrag liegen. Überschlägig ergäbe sich daraus eine Summe von knapp fünf Millionen Euro, die aus dem Bundesetat an die Gruppe von Wagenknecht fließen könnte.“
So war zu hören von Frau Wagenknecht, dass sie Ihr geschaffenes Bündnis auffordert, zur „Partei des Miteinanders“, mit mehr Toleranz und Respekt zu werden. Man wolle keine „Linke 2.0“ sein. Frau Wagenknecht hat schon immer gut ausgeteilt, aber es ist trotzdem kurios, dass nach innen in der Partei eine Harmonie herrschen soll und nach außen kann man anständig austeilen!
Wäre es nicht denkbar, dass es sich lediglich um eine LINKE 1.5 handelt?
Kommentar/Resümee
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Helmut Schmidt
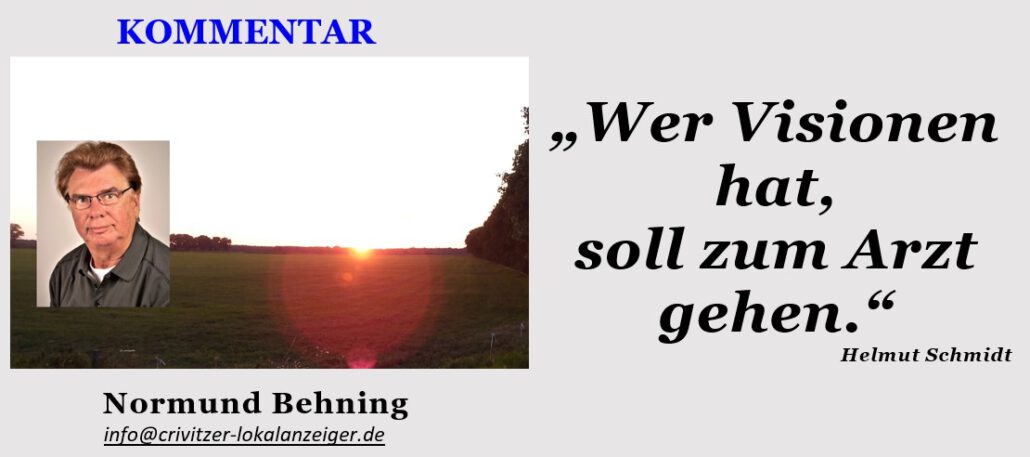
Der Politik wird ja gerne ein gewisser Realitätsverlust unterstellt. Man sollte sich die Frage stellen: Welche Realität ist denn gemeint? Viele der Politikenden oder wie man heute gendergerecht sagt, haben nie einen Betrieb oder auch nur eine richtige Arbeitsstelle von innen betrachtet, geschweige denn innegehabt. Dass insofern die politischen Vorstellungen und Ideen nicht immer, um es freundlich zu sagen, wirtschaftskompatibel sind, liegt auf der Hand.
Bei den überwiegenden Reden der Kandidaten zur Europawahl und des Vorstands und anderer hatte man den Eindruck, dass es sich um Sammelsurium der Mitglieder handelte. Zum Teilen aus überwiegenden von ehemaligen frustrierten Mitgliedern der Partei die LINKE, irritierte Grüne und genervte SPD-Anhänger sowie enttäuschte Gewerkschaftler bestehend. Auch wenn jetzt noch viele Spenden aus dem Westen von MV kommen, so werden diese Gelder wohl hauptsächlich für Büros der Partei, Kosten für die Organisation und gut bezahltes Personal ausgegeben werden.
Es ist zu erwarten, dass sich die Wähler in den kommenden Wochen in Mecklenburg-Vorpommern mit allen Akteuren der kommunalen Ebene auseinandersetzen werden, um zu sehen, wer sich plötzlich bei der „BSW-“ Partei wiederfindet.
Vor allem, welche Lösungsansätze sie zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben bereithalten.
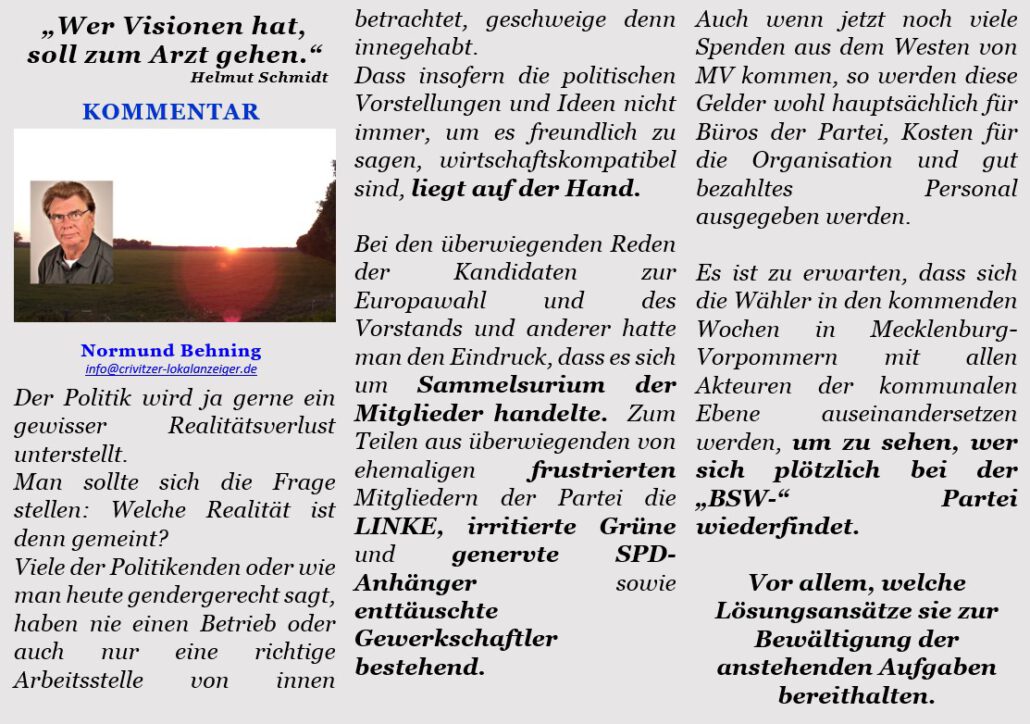
26.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./334[163(38-22)]/CLA-171/09-2024
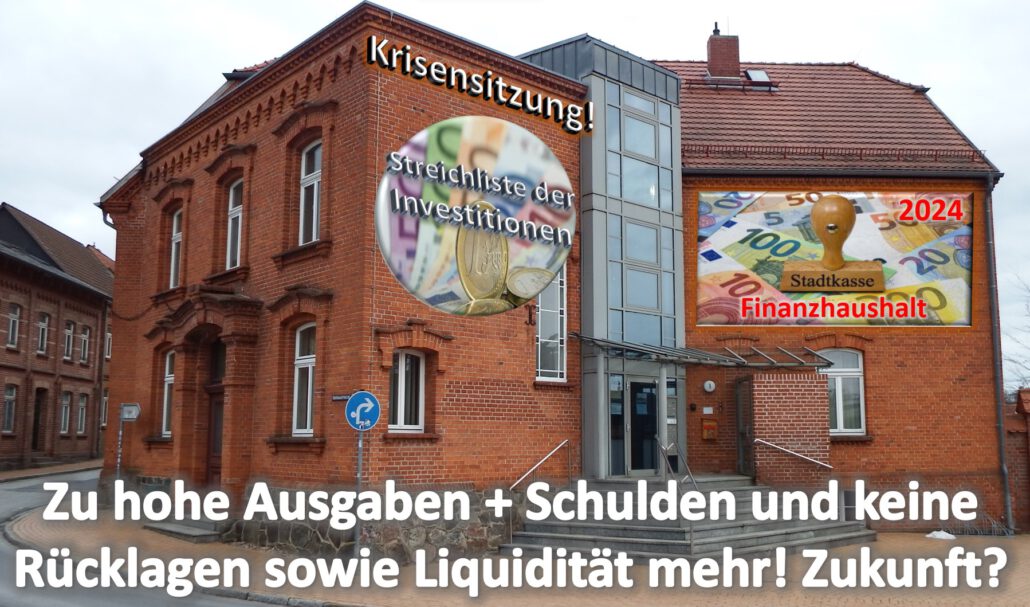
Die Priorisierung der Investitionen ist die neue Devise oder besser gesagt das Schlüsselwort 2024 als eine neue Bezeichnung einer Streichliste im Finanzhaushalt 2024 in Crivitz.
Die Mehrheitsfraktionen DIE LINKE/Heine und die Fraktion CWG – Crivitz haben die Opposition verspätet in diesem Jahr eingeladen, um über den Finanzhaushalt des Jahres 2024 zu sprechen. Der frühzeitige harmonische Aufruf zur Auseinandersetzung mit der Opposition zu einer sogenannten Streichliste besteht darin, dass die Kommunalwahlen in etwa 4 Monaten stattfinden werden. Also wollen die Mehrheitsfraktionen der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine die CDU-Opposition Crivitz und Umland mit ins Boot holen, um nicht selbst als Sündenbock für eine verschwenderische Finanzstrategie der letzten Jahre im Wahlkampf 2024 ins Visier zu geraten.
Denn bis dato besitzt Crivitz lediglich einen vorläufigen Haushalt für das Jahr 2024, der eigentliche Haushaltsentwurf wird erst Ende Februar erwartet, welcher jedoch vermutlich keine positiven Aussichten für die Jahre 2025/26 mit sich bringt. Wie jedes Jahr sprudeln die Steuereinnahmen und sind die Ermächtigungen der bereits beschlossenen Investitionen und die Wünsche für noch höhere Ausgaben größer als die vorhandene Liquidität. Allein die Tatsache, dass keinerlei Rücklagen mehr vorhanden sind, führt dazu, dass lediglich noch die liquiden Mittel bis zum 31.12.2024 reichen, das dürfte auf jeden Fall für Unruhe sorgen. Während bundesweit die Preise steigen, Kaufkraftverluste deutlich werden, höhere Tarifabschlüsse, Lieferengpässe und die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen die Investitionstätigkeit belasten, befindet sich die Stadt Crivitz auf einem gänzlich anderen Kurs!
Aufgrund der bereits erteilten Ermächtigungen für Investitionen der letzten Jahre sind die Ausgaben bei Weitem höher als die noch vorhandenen liquiden Mittel. So liegen bereits jetzt die Pläne für geplante Investitionen in der Größenordnung bis etwa 3,6 Mio. € vor, auch aus den Vorjahren. Die vorhandenen liquiden Mittel decken im Haushalt 2024 bislang nicht einmal die Hälfte der Investitionssumme. Die Planungen für den stadteigenen ebenerdigen Umbau des Marktplatzes und die Erschließung eines neuen Eigenheimgebiets für das sog. Vogelviertel mit einer eigens errichteten Erschließungsstraße über die Bahnlinie werden weitere Investitionen in Millionenhöhe mit sich bringen in den Jahren 2025/26.
Also ergeben sich nur zwei Möglichkeiten: Entweder Aufnahme von weiteren Krediten und Gebühren- und Steuererhöhungen oder eine massive Streichung von Investitionen 2024, weil die Ausgaben zu hoch sind und die Liquidität nicht reicht. Nur so kann die Stadt Crivitz im Jahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept NOCH umgehen, welches der Genehmigung durch den Landkreis bedarf.
In der Regel wird man vor den Kommunalwahlen 2024 das kleinere Übel wählen und einfach Investitionen in die nächsten Jahre verschieben, um sein finanzpolitisches Ansehen zu retten. Durch diese Maßnahme wird jedoch die finanzielle Situation nicht verbessert, sondern im Gegenteil nur noch die Lage verschlechtert. Da die Ausgaben für Personal und Betriebskosten für die städtischen Gebäude sowie für den Bauhof und die Reinigung ebenfalls dramatisch gestiegen sind. Bis eines Tages finanzpolitisch nichts mehr geht, im Jahr 2025/26!
So stehen zur Auswahl für die Streichliste der Investitionen im Jahr 2024:
-die Erweiterung des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses mit ca. 1,2 Mio. €,
-die Erneuerung des Sportplatzes der Grundschule mit ca. 0,55 Mio. €,
-die 2. Ausfahrt für das Gewerbegebiet mit ca. 0,2 Mio. €
-die Deckensanierung der Straße in der Gewerbeallee mit ca. 0,3 Mio. €,
-der 3. Abschnitt Ortsdurchfahrt 321 mit ca. 0,4 Mio. €,
-der Umbau Parkplatz (alter Sparmarkt) ca. 0,12 Mio. €
-die Sanierung des Kreativhauses mit ca. 0,25 Mio. €,
-die weitere Vergrößerung des Hortgebäudes mit ca. 0,5 Mio. € und
Die Regenentwässerung mit ca. 0,13 Mio. €.
Es handelt sich lediglich um eine kleine Auswahl, unabhängig von den zahlreichen Planungs- und Untersuchungskosten für die Lindenallee und die Trammer Straße (Vogelviertel). Im Wesentlichen geht es vorrangig dabei, mit einer Gesichtswahrung für CWG/ die LINKE/Heine und die CDU-Fraktion durch einen Kompromiss (in einer Streichliste) aus dieser Situation herauszukommen bis zur Kommunalwahl im Juni 2024.
Kommentar/Resümee
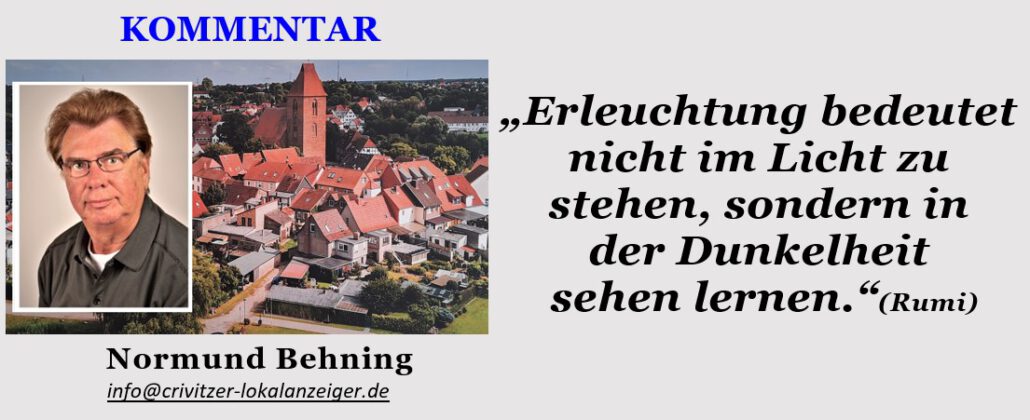
„Erleuchtung bedeutet nicht im Licht zu stehen, sondern in der Dunkelheit sehen lernen.“(Rumi)
Es werden unruhige und schwere finanzielle Zeiten ab 31.12.2024 eintreten!
Crivitz hat kein Einnahmeproblem, sondern ein desaströses Ausgabeproblem. Es ist egal, welche Kürzungen im Finanzhaushalt 2024 nun vorgenommen werden und ob es zu Verschiebungen von Investitionen in die kommenden Jahre 2025/26 kommt, da die finanziellen Ressourcen der Stadt Crivitz erschöpft sind. Es gibt nur eine einzige Lösung, um eine Katastrophe ab dem 01.01.2025 zu verhindern, nämlich die Planung des Haushaltes grundlegend zu verändern und die finanziellen Ressourcen dafür einzusetzen.
Die Fraktion der CWG und die LINKE werden nun gezwungen sein, ihre misslungenen Sparbemühungen als einen Erfolg der finanziellen Lage zu rechtfertigen und als notwendige Investitionen zur Weiterentwicklung der Stadt Crivitz zu präsentieren.
Die mehrheitsführenden Fraktionen der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine haben die Ausgaben in jeder Hinsicht mit großer Begeisterung vorangetrieben. Die CDU – Fraktion Crivitz und Umland hat in der Vergangenheit, wegen des friedlichen Zusammenlebens, diese Belange geduldet und durch eine unzureichende Intervention als größte Oppositionskraft mitgetragen.
So, dass die finanzielle Lage so ist, wie sie jetzt ist, und das wird sicherlich auch der Wähler in Crivitz erkannt haben. In der zukünftigen Entwicklung ist es wichtig zu erkennen, dass alle drei Akteure dazu beigetragen haben. Dies ist das Dilemma, das die nächsten Abgeordneten und Parteien ab dem 09. Juni 2024 ausbaden müssen. Wir sind gespannt, wie die Darsteller der CWG – Crivitz und die LINKE/ Heine und der CDU sich inzwischen neu erfinden und präsentieren werden.
Ansonsten muss man nur noch SOS-funken oder von Bord gehen!
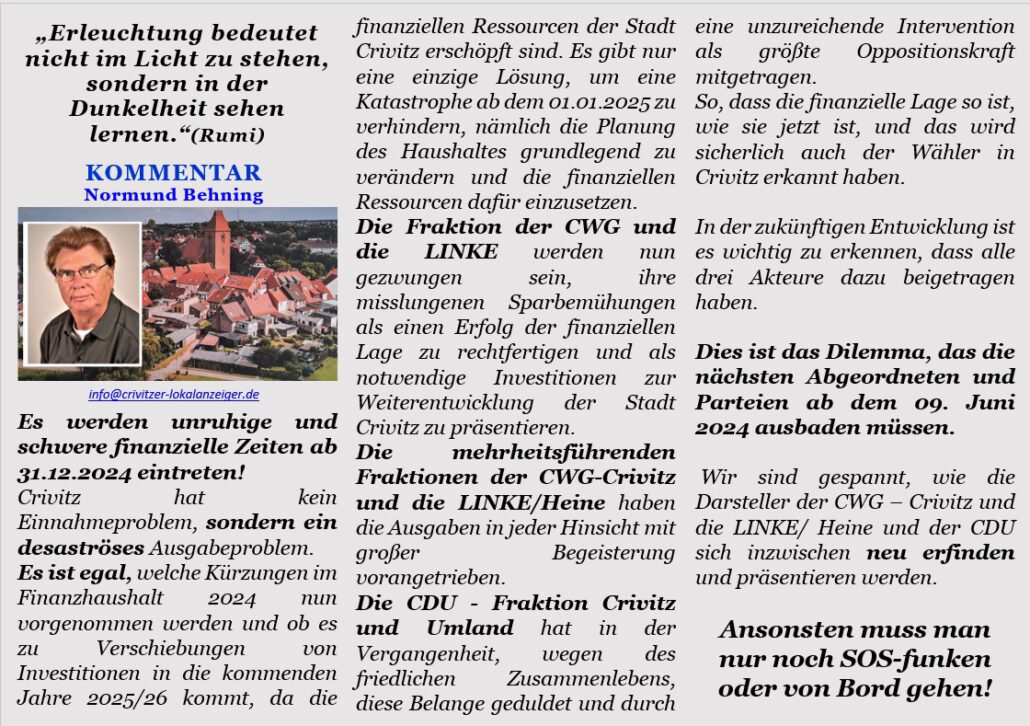
24.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./333[163(38-22)]/CLA-170/08-2024

Die Fraktionen, der CWG-Crivitz und die LINKE/Heine haben nach 70 Monaten eine neue Dauer für das Parken in einzelnen Straßen beschlossen. Die Mehrheitsfraktionen der CWG und die Linke/Heine im Bauausschuss haben dabei eine 180 Grad Drehung seit März 2018 beim Thema Parkzeiten im Januar 2024 vorgenommen.
Es war eine schnelle und sehr selbstbezogene Diskussion im Januar 2024 im Bauausschuss, welcher nur einen Tagesordnungspunkt hatte (Beratung zu Parkzeiten in der Stadt Crivitz). Daher fokussierten einige Abgeordnete ihre eigene Rolle ausschließlich auf ihre eigene Notwendigkeit, ohne dabei den Blick über den Tellerrand zu schweifen und das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Es gab eine mangelnde Vorbereitung und schlechte Ortskenntnisse einzelner Teilnehmer. In einer Zeit von vier Minuten und 40 Sekunden wurde die Beratung über Parkzeiten in der Stadt Crivitz in den insgesamt 11 Minuten der öffentlichen Sitzung abgehandelt (180 € für den Steuerzahler als Sitzungsgeld für 11 Minuten!)
Die Sitzung war gerade mal so beschlussfähig, da vier von sieben Abgeordneten nur anwesend waren. In gewohnter Manier glänzte die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) mit einer vollständigen Abwesenheit. Die Vertreter der CDU-Fraktion im Bauausschuss (Frau Beate Werner und Herr Henryk Krüger) waren in den vergangenen etwa 20 Monaten im Bauausschuss nie komplett vertreten, wenn überhaupt, dann nur teilweise oder gar nicht.
Warum ist das Thema Parkzeiten von einzelnen Straßen in dieser Sitzung im Januar 2024 auf der Tagesordnung und nicht bereits früher? Man teilte mit, dass ein angebliches Bürgerschreiben mit einigen Unternehmern Wünschen vorliegt und daher eine Entscheidung getroffen werden müsse. Es war merkwürdig, dass nur der Chef vom Bauausschuss (Herr Alexander Gamm) den Inhalt des Anwohnerschreibens bis zum Zeitpunkt dieser Sitzung kannte. Bis dahin haben weder die anderen Abgeordneten noch die Öffentlichkeit davon Kenntnis bekommen. Es ist erstaunlich, dass keine öffentliche Beschlussvorlage erarbeitet wurde, obwohl bereits klar war, was zu beschließen war. So viel Geheimnisvolles steckte also in der Neujahrssitzung des Bauausschusses im Jahr 2024?
Wie gewohnt wurde das Schreiben von dem Vorsitzenden in rätselhaften Fragmenten und Halbsätzen präsentiert, wobei besonders die Dauer des Parkens auf der Großen Straße, Parchimer Straße und dem Marktplatz hervorgehoben wurde. Die Dauer des Parkens in diesen Bereichen sollte auf zwei Stunden erhöht oder bestätigt werden. Einige Teilnehmer der Sitzung gaben an, dass ihre persönliche Lage es nur erfordert, eine halbe Stunde am Markt zu parken und sie keine längeren Wartezeiten beim Friseur hätten, doch letztlich wurde eine Mehrheit für diese Erhöhungen gefunden.
Das Parken in der Fritz-Reuter-Straße sollte nun angeblich von links nach rechts verlagert werden, um ein fehlerfreies Herausfahren zu ermöglichen. Auch in der Eichholzstraße wolle man ein versetztes Parken einfach mal so ausprobieren, einfach mal so von links nach rechts rüber legen.
Und so lautete auch der Tenor in der lediglich fünfminütigen Diskussion: Einfach mal so ausprobieren, so formulierte es der Vorsitzende und schon war auch der Beschluss gleichsam bereits gefasst. Es gab keine speziellen Gründe, Analysen oder Untersuchungen, keine Studien oder Fachämterbefragung, keine Befragungen oder Umfragen der Bürger, lediglich ein mysteriöses Anwohnerschreiben veranlasste die Mehrheit der Fraktionen CWG – Crivitz und die Linke / Heine dazu, eine 180 Grad-Drehung in Ihren Ansichten vorzunehmen.
Es ist allgemein öffentlich seit 12 oder 16 Monaten bekannt, dass Anträge von Einzelunternehmern zur Verlängerung des Parkens in der Parchimer Straße vorliegen. Ebenso wurde bereits im März 2023 die Parksituation in der Parchimer Str. diskutiert, in einer Anwohner-versammlung. Jedoch fand keine Debatte über die Parkplatzsituation in der gesamten Parchimer Straße statt, stattdessen lediglich in einzelnen Bereichen zur Parkdauer. Die Frage, welche Auswirkungen der plötzliche Wechsel der Ansichten der Mehrheitsfraktionen auf das plötzliche Anwohnerschreiben für die jüngsten Beschlüsse hatten, bleibt für die aktuelle Situation weiterhin offen. Es ist durchaus möglich, dass man alle anstehenden Aufgaben, aus der Vergangenheit noch rasch erledigt vor der Wahl, um dann ausschließlich erstklassige Ergebnisse als Mehrheitsfraktion von CWG-Crivitz und die LINKE /Heine präsentieren zu können!
Das Versprechen der Erarbeitung eines Parkraum- und Verkehrskonzept für die Stadt Crivitz bleibt auch nach wie vor nach 32 Monaten nur ein „VERSPRECHER“ der Mehrheitsfraktionen in der Stadtvertretung. Möglicherweise wird das Parkraum- und Verkehrskonzept im Flyer für die kommende Wahl als ein erneutes Versprechen einer Partei oder Wählergemeinschaft präsentiert. In der Stadt Crivitz ist dies sicherlich nicht mehr auszuschließen. Es ist letztlich eine Sache der Glaubwürdigkeit und der Haltung.
Kommentar/Resümee
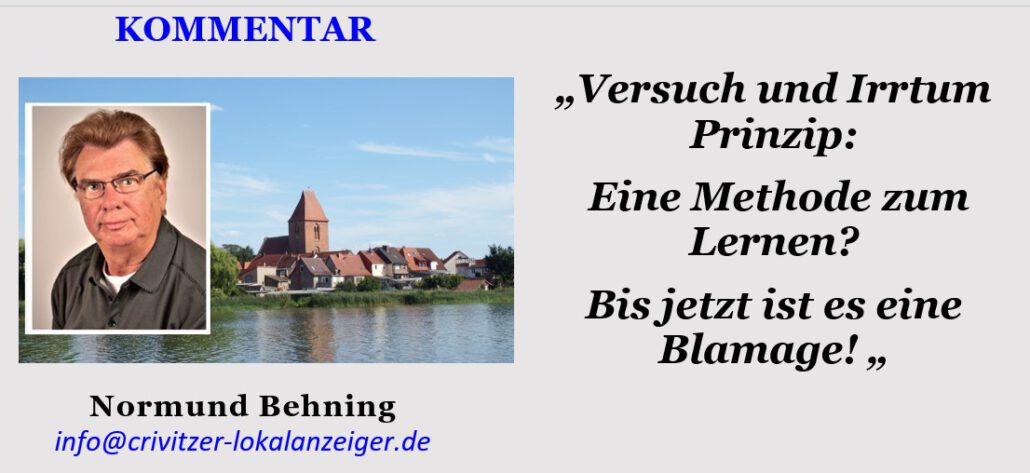
Versuch und Irrtum Prinzip: Eine Methode zum Lernen? Bis jetzt ist es eine Blamage!
Einfach mal so, aus der kurzen Hand beschließen, ohne genaue Analyse. Ein angebliches Anwohnerschreiben, welches mutmaßlich etwa vier Monate vor den Kommunalwahlen verfasst wird, führt dazu, dass man plötzlich seine Ansichten und Beschlüsse nach fast 6 Jahren seit dem letzten Beschluss revidiert, was alles schon sehr ungewöhnlich ist.
In der Großen Straße in der Höhe der Bushaltestelle vor einer Kurve ist es unverständlich, dass man in einem unübersichtlichen verkehrstechnischen Bereich bei vorbeirasenden Pkw und gegenüberliegenden packenden Pkw weiterhin zwei Stunden parken kann. Der Beschluss der Parkdauer an diesem Standort aus dem Jahr 2018 war sehr umstritten. Der Bauausschuss war grundsätzlich gegen eine Parkdauer von 2 Stunden, plädierte jedoch für eine Parkdauer von 0,5 Stunden aufgrund der verkehrstechnischen Lage. Die Fraktion der CWG – Crivitz und die LINKE lehnten den Vorschlag damals vehement ab. Es ist anzunehmen, dass die Errichtung dieser Parktaschen mit zwei Stunden Parkzeit vor dieser Kurve und der Nutzung des Warenhauses auf der gegenüberliegenden Seite eng miteinander verbunden ist. Man kann dort übrigens auch mit 50 Km/h um die Kurve sausen! Es besteht Einigkeit unter befragten Bürgern, dass sich diese Parkflächen des Öfteren zu dauerhaften Dauerparkflächen entwickelt haben. Dies wird sich nun auch nicht innerhalb der kommenden vier Monate mehr ändern!
Auch zukünftig sollte die Innenstadt weiterhin gut mit dem Auto erreichbar sein und Besuchern, Beschäftigten und Anwohnern ausreichend Parkmöglichkeiten geboten werden. Das Ziel eines Parkraumkonzepts besteht darin, einen Ausgleich zwischen Parknutzung und den konkurrierenden verkehrlichen und städtebaulichen Ansprüchen herzustellen.
Aus diesem Grund sollten im Rahmen eines Parkraumkonzepts integrierte Handlungsansätze und Lösungsvorschläge entwickelt werden, um die bedarfsgerechte und wirksame Steuerung des ruhenden Verkehrs in Crivitz zu ermöglichen.
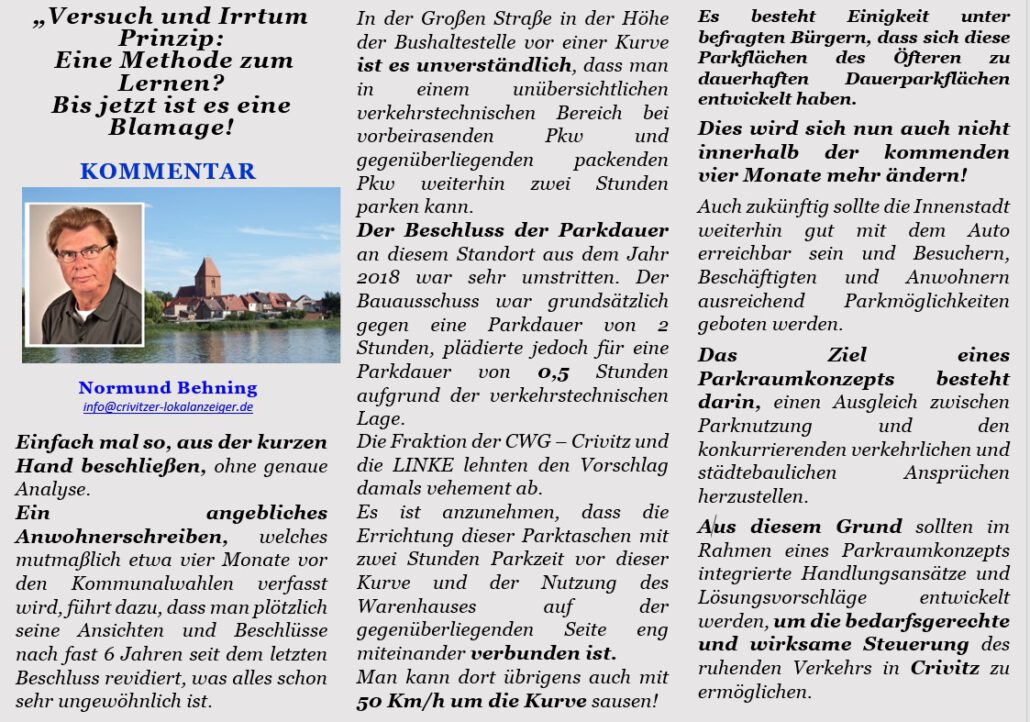
22.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./332[163(38-22)]/CLA-169/07-2024
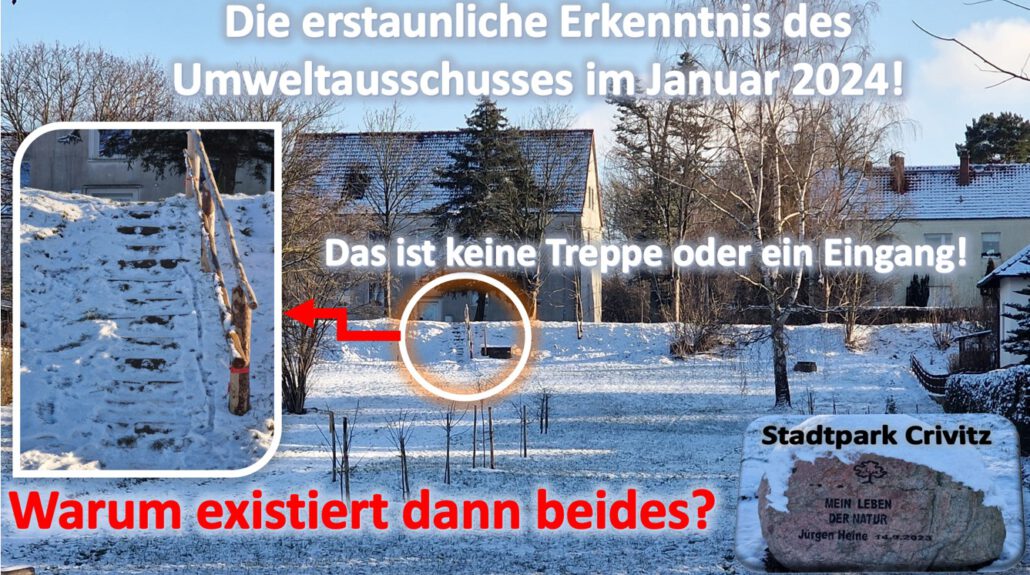
Es wurde von einem Mitglied des Seniorenbeirats und einem CWG-Mitglied (sachkundiger Einwohner) im Umweltausschuss gefragt, ob es möglich wäre, die Treppe für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen. Der Vorsitzende des Umweltausschusses Herr Hans -Jürgen Heine (Fraktion die LINKE/HEINE) zeigte großes Unverständnis für diese Angelegenheit, und es herrschte eine heftige Gewitterstimmung auf die Fragenden.
Der anwesende Fraktionsvorsitzende der CWG -Crivitz Fraktion, Herr Andreas Rüß, zeigte sich äußerst ungehalten bezüglich dieser Fragestellungen und nahm keinerlei Anteil daran, in diese Diskussion auch nur eine Rückmeldung zu geben. Wahrscheinlich war er dem Argumentationsgroll des Vorsitzenden nicht gewachsen und kannte sowohl die Sachlage nicht, die man einst versprochen und beschlossen hatte vor drei Jahren, als auch die, die man bis heute nicht einhält.
Der Vorsitzende des Umweltausschusses hat festgestellt, dass es keine Treppe zur Straße der Freundschaft gibt und auch kein Zugang zu diesem Bereich vorhanden ist. Des Weiteren wäre ein Denken in Richtung eines barrierefreien Ausbaus an dieser Stelle unangebracht, da dies ohnehin nicht geplant war und man leugnete jegliche Überlegungen, darüber überhaupt nachzudenken. Der Haupteingang befindet sich am Rabahnweg und wurde im vergangenen Jahr 2023 so festgelegt. Zudem würde es sich als kostspielig erweisen, an dieser Stelle eine Treppe für Senioren und Kinderwagentreppe zu planen, da das Thema ohnehin von Tisch ist. Schluss aus und fertig.
Als man den Vorsitzenden an seine eigene Beschlusslage aus dem Jahr 2021 erinnerte und die der Stadtvertretung zu diesem Thema, bestritt er, dass es hierzu überhaupt eine Entscheidung gab. Es ist erstaunlich, wie schnell aus einem Versprechen ein VERSPRECHER geworden ist, wie es die Fraktion DIE LINKE/Heine getan hat. Es war ein gigantischer Auftritt für den Beginn des Vergessens, da Herr Hans-Jürgen Heine gleichzeitig 2. Bürgermeister der Stadt Crivitz ist!
Er empfand es als viel wesentlicher und bedeutsamer, über die Einhaltung der Stadtparkordnung und die Baumpatenschaften zu diskutieren, wie sie im Arboretum üblich sind, als über die Treppe zu lamentieren.
Die CDU-Fraktion (Crivitz und Umland) hat sich in Bezug auf die Treppe und den Zugang in der Diskussion sehr kleinlaut verhalten, wohlweislich weil sie den Grundsatzbeschluss vor drei Jahren mitgetragen hatte, weil sie das gute Miteinander schätzte. Es ist ihr nicht gelungen, die Vorgaben zur Umsetzung des Beschlusses vollständig einzufordern, obwohl sie aktiv involviert und aktiv beteiligt war. Ihr Veto war nur zu hören, als sie die üblichen Rechtschreibfehler im vorherigen Protokoll rügte. Dies ist ihr Metier seit Jahren im Umweltausschuss. Mehr kann man auch nicht von dieser Fraktion verlangen!
Es ist selbstverständlich für Außenstehende unverständlich, dass das Ganze in dem Protokoll des Umweltausschusses wieder nicht enthalten sein wird, da der Vorsitzende seit Jahren die Protokolle selbst verfasst. Gleichzeitig leitet er die Versammlung, spricht überwiegend zu Diskussionsthemen, sodass meistens die Aussagekraft dieser Dokumente sehr, sehr einseitig geprägt und dargestellt wird, eben fast aus einem Gedächtnis.
Zur Erinnerung:
Der Umweltausschuss machte sich das Projekt „Stadtpark“ zu eigen, ab dem 15.06.2020, nach dem Rückzug von Frau Anna Schade aus der Kommunalpolitik. Seitdem ist es die Leidenschaft neben dem ARBORETUM vom Umweltausschussvorsitzenden (Herrn Hans – Jürgen Heine). Nach einer Besichtigung am 17.08.2021 wurde am 25.10.2021 sofort ein Grundsatzbeschluss in der Stadtvertretung Crivitz durchgefochten, mit einem finanziellen Budget für 2022 in Höhe von etwa 25.000,00 €. Eine Beräumung, Fällung, Fräsung und 4-Parkflächen für ca. 10.000 EUR sollten innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden. Auch die Aufstellung von Mobiliar, Pollern, Mülleimern und *VIER* – Bänken sollte vorgenommen werden.
Als besonders wichtig wurde der Bau einer Treppenanlage (Blockstufen) mit einseitigem Geländer und Kinderwagenführung für ca. 10.000,00 € zur Friedensstraße erachtet. Die finanziellen Mittel wurden aus dem Konto für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtung sowie aus dem Bereich öffentliche Grün, Landschaftsbau bereitgestellt. Es wurde klar und eindeutig damals festgestellt, dass „die Fläche ist mittig durch einen Weg geteilt, der für Fußgänger als Verbindungsweg zwischen Rabahnweg und der Friedensstraße genutzt wird“.
Jetzt heißt es, das war alles nicht so gemeint und viel zu teuer!
Kommentar/Resümee
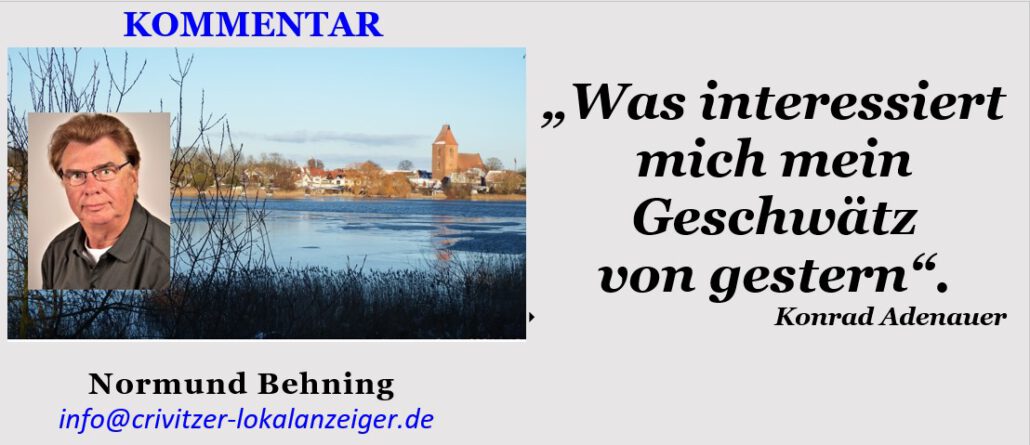
„Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.“ Konrad Adenauer
Der Stadtpark von Crivitz, „ein Ort für Bewegung und für frische Luft“? Die Begegnung sollte jedoch nur von einer Seite erfolgen, denn die andere Seite ist nicht zulässig. Also, ist das nun eine Begegnung oder eher ein Treffpunkt?
Unfassbar, aber wahr! Eine geplante Treppe mit einem einseitigen Geländer und Kinderwagenführung wird nicht mehr gebaut. Es war ursprünglich vorgesehen, dass die Treppe verkehrssicher gestaltet wird. Dies war auch eine Forderung innerhalb der Stadtvertretung. Es wurde keine Rücksicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen oder Senioren genommen, eigentlich eine Notwendigkeit! Für Rollstuhlfahrer aus der Neustadt beginnt indessen der Weg zum Parkeingang am Rabahnweg, um dort zum Ort der Begegnung (Stadtpark) zu kommen. Die Kinder sollen die Zuwegung durch die Gartenanlage nutzen und die Treppe meiden.
Sollte auch der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Crivitz diesem Vorhaben so zugestimmt haben und mittragen, wovon man sicherlich ausgehen, wäre dies sicherlich eine äußerst außergewöhnliche Vorgehensweise.
Der Verbindungsweg zwischen Rabahnweg und Friedensstraße wird jetzt als Mahnung verstanden, ihn nicht als Abkürzung zur Parchimer Straße oder umgekehrt zu verwenden. Es handelt sich um einen Witz, der mehr als nur lächerlich ist, aber eine Stadtparkordnung wurde bereits verkündet. Die Wähler werden diese Vorgehensweise bestimmt für die Zukunft in ihrem Gedächtnis behalten. Die Baukosten könnten auch aus den jährlich mehr als 28.000,00 € Aufwandsentschädigungen für Sitzungen oder aus den jährlichen 10.000 € Repräsentationskosten der politischen Gremien von den insgesamt 60.000 € Repräsentationskosten der Stadt – entnommen werden.
Also, bitte, das wäre doch realisierbar! Oder?
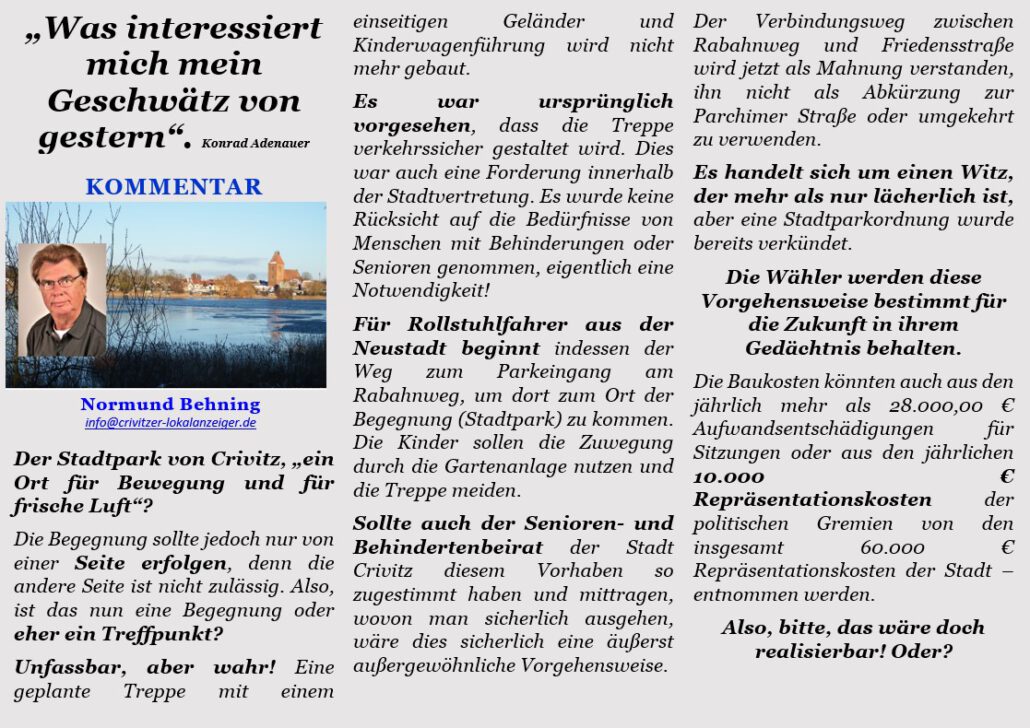
19.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./331[163(38-22)]/CLA-168/06-2024
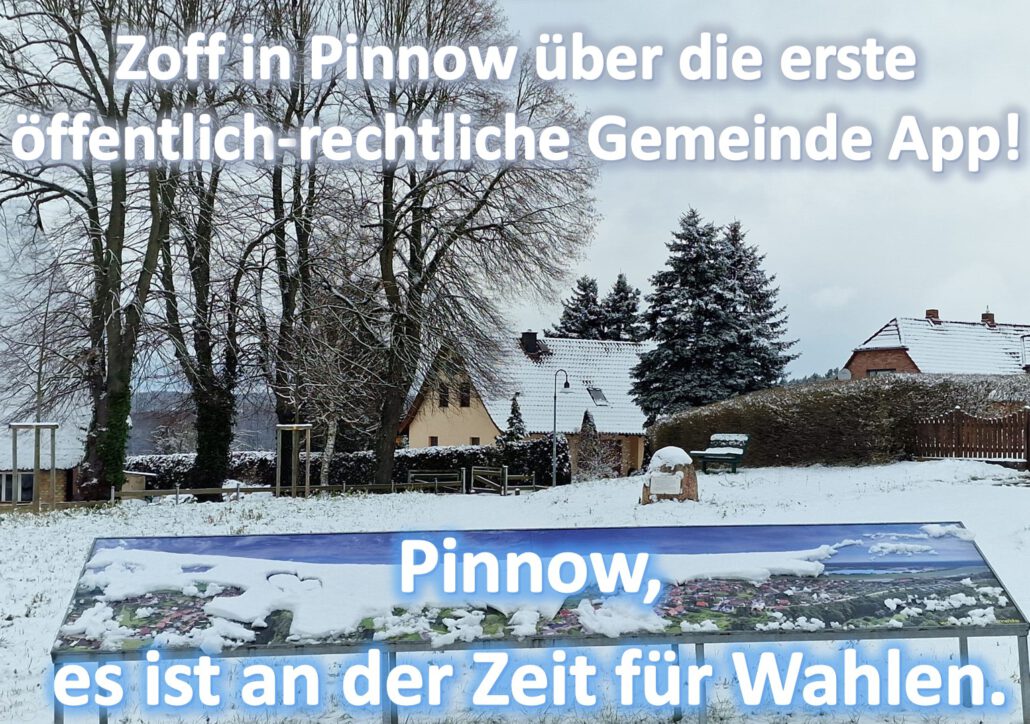
Eigentlich eine gänzlich harmlose und gewinnbringende Idee zur Entwicklung ländlicher Gebiete in einer Gemeinde, die etwa 2000 Einwohner zählt. Doch einige noch aktive Mandatsträger und frühere Kandidaten sehen plötzlich Rot und erzeugen eine politische und gesellschaftliche Atmosphäre und nutzen vorrangig zur Kommunikation die örtliche Lokalzeitung.
Fast schon amerikanische Verhältnisse in Pinnow vor der Kommunalwahl in ca. 19 Wochen! Ein neugewählter Präsident in der Exekutive und ein alter Kongress mit einem alt gewählten Senat und Repräsentantenhaus in der Legislative! Und die Lokalzeitung SVZ bildet die Plattform der Auseinandersetzung! So ungefähr könnte man die Situation in Pinnow beschreiben. Und es hört nicht auf!
Ein Fraktionsvorsitzender der CDU/WG-Aktive (Herr Klaus-Michael Glaser CDU) fühlt sich in seiner persönlichen Autorität verletzt. Es handelt sich nicht um das erste Mal. Ein Gemeindevertreter (Herr Volker Helms, Fraktion CDU/WG Aktive), der vermutlich sein Trauma um die gescheiterte Projektanfrage „XXL-Feriendorf“ noch immer nicht überwunden hat. Sowie seine Ehefrau (Frau Daniela Lemmer-Helms WG „Aktive Wählergemeinschaft Godern und Pinnow“), die als Bürgermeisterkandidatin 2021 in Pinnow kandidierte und sich indessen über soziale Medien neu positioniert. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben schon Wahlen verloren. Egal, ob Sie als CDU-Landratskandidat oder Bürgermeisterkandidat(in) in Erscheinung getreten sind oder ob als Ortsvorsteher in Godern Angst vor einem Verlust an Einfluss fürchten.
Nun haben sie sich zusammengeschlossen, um den neuen Bürgermeister und seine Herangehensweise an ein komplexes Thema zu kritisieren, das seit langer Zeit bekannt ist und an dem sie in unterschiedlicher Weise auch mitgewirkt haben. Und über alle ihre Ansichten und Empörungen berichtet die Lokalzeitung SVZ oder besser gesagt liefert sie die Plattform dafür, auf der man inzwischen kommuniziert und sich auseinandersetzt. Ist dies sinnvoll, um das Meinungsbild zu verbessern?
In Pinnow sind also inzwischen zwei Apps verfügbar, die sowohl privat als auch öffentlich nutzbar sind, was für eine enorme Bereicherung für die Einwohner dieser Gemeinde darstellt (eine private Pinnow-App und eine öffentlich-rechtliche Orts-APP der Gemeinde Pinnow).
Bei einer genaueren Recherche würde man feststellen, dass es bereits im Oktober 2021 eine Richtigstellung zu der privaten Pinnow App von Frau Daniela Lemmer-Helms im Zukunftsausschuss gegeben hat. „Es wird angefragt, wie die Inhalte auf der Gemeindehomepage und der privaten App miteinander in Beziehung stehen. Herr Klein stellt fest, dass die Gemeindehomepage die offizielle Plattform der Gemeinde ist. Die private App nimmt Themen aus der Gemeinde auf“(20.10.2021 – Einwohnerfragestunde-Sitzung des Zukunftsausschusses Pinnow 2050 der Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow). Schon damals wurde der Status der Medien klargestellt und wer von wem Informationen bezieht.
Aus gut informierten Quellen in Pinnow geht hervor, dass die Gemeindevertreter von Pinnow bereits am 10.10.2023 durch den Bürgermeister direkt schriftlich informiert wurden über den bevorstehenden Start einer offizielle Orts-APP für die Gemeinde Pinnow. Wie zu hören war, wurde bereits kurz nach dieser schriftlichen Information in der darauffolgenden Gemeindevertretersitzung darüber ebenfalls mit den Mandatsträgern gesprochen.
Dieses digitale und zukunftssichere Informationsangebot soll künftig die Internetseite entlasten und als direkte Kommunikation zwischen Bürgern und der Gemeinde dienen. Dadurch ist es dem Bürger möglich, direkt mit der Gemeindeverwaltung, ihren Ausschüssen, dem Bürgermeister, dem Medienbeauftragten und den Einrichtungen der Gemeinde in Kontakt zu treten. (Feuerwehr, Seniorenbeauftragte, KiJuB, Ortsvorsteher, Vereine, Senioren etc.). Durch die Teilnahme an einem Umfragemodul können sich alle Ortsbewohner aktiv in das Dorfleben einbringen. Sportvereine, Schulen, Kindergärten oder andere Gruppen können direkt mit der App verbunden werden. Dort können sie neue Inhalte selbst machen. Damit werden alle Inhalte im Ort an einer Stelle gebündelt. Die digitale Pinnwand, die in der Orts-App integriert ist, ersetzt das traditionelle „Schwarze Brett“. Zudem ist der Medienbeauftragte Herr Frank Czerwonka (Fraktion CDU/WG-Aktive) für alle technischen und textlichen Inhalte verantwortlich und an seiner Seite steht auch noch Frau Birger Bösel (Fraktion „Offene Liste Pinnow und Godern“) mit sicherem Auge.
Weshalb also nun diese Aufregung und Anschuldigungen und Fragen nach der Sinnhaftigkeit nach fast 3 MONATEN? Wenn man einmal über den Tellerrand hinaussieht, so könnte das Projekt Schule machen auch für andere Kommunen in der Region und sich auch für den Tourismus in Pinnow gut auswirken. Wer von den auf den Fuß getretenen Beteiligten hat sich bereits darüber schon einmal Gedanken gemacht, anstatt eine Konkurrenz zu erzeugen und über die Medien einen Konflikt zu provozieren? Nur, weil es sich um ein Wahljahr handelt!
„Wir als Aktive stehen für einen klaren, wertschätzenden und sinnvollen Umgang miteinander. Wir stehen nicht für Polemik, Meinungsmache und vor allem Hass, Neid und Missgunst. Bei Fragen sprecht uns an – dafür sind wir da. AKTIV bedeutet, bewusst unermüdlich handelnd.“ (Internetseite der Aktive Beitrag -23.02.2021“)
Nun, liebe Fraktion CDU/Aktive, sollten diese klaren Einschätzungen weiterhin im Jahr 2024 bestehen, wäre es sinnvoll, die Angelegenheit in einer direkten Kommunikation zu klären und die Sache zufriedenstellend im Interesse des Gemeinwohls zu lösen!
Der Bürgermeister Herr Günter Tiroux ist auf jeden Fall dazu bereit, wie es uns mitgeteilt wurde!
Kommentar/ Resümee
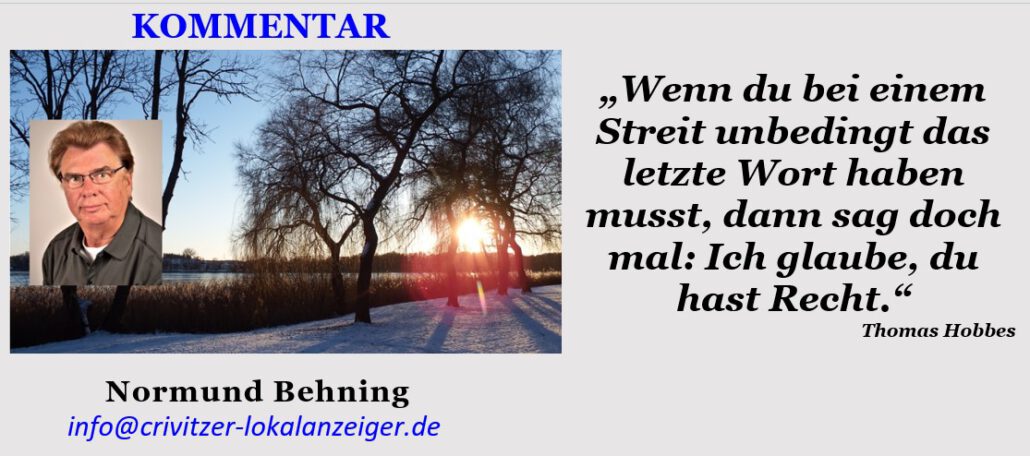
„Wenn du bei einem Streit unbedingt das letzte Wort haben musst, dann sag doch mal: Ich glaube, du hast Recht.“ Thomas Hobbes
Seit 2021 ist ein frisch gewählter Bürgermeister aktiv, der sich bemüht, die bestehenden Strukturen zu verbessern und neue Vorhaben zu realisieren. Für ihn ist es eine ständige Herausforderung, die persönlichen Befindlichkeiten der noch amtierenden Gremien und Abgeordneten aus dem Jahr 2019 zu analysieren. Ein Ausbruch des offenen Wahlkampfes für 2024 und die Profilierung bekannter Akteure über die Printmedien sind die Folgen.
Warum widmet sich eine engagierte Redakteurin der SVZ (Frau Katja Müller) nun plötzlich in Ihren Berichterstattungen so beharrlich seit 2024 der Gemeinde Pinnow? Plötzlich werden nach fast drei Monaten Fragen zur Sinnhaftigkeit einer App und deren Unstimmigkeiten gestellt, wobei die Differenzen eher vorrangig die Akteure der Gemeindevertreter selbst betreffen! Im Vergleich zu Ihrer Berichterstattung über Natur- und Tierschutz sowie Forstwesen ist Ihr Know-how in der kommunalen Verwaltungspraxis eher gering in Ihren Schilderungen. Ist es eine lokale Berichterstattung oder handelt es sich um eine eigenständige Positionierung einer Redakteurin, die gerade in den Verkaufsprozess ihrer Zeitung gerät? Wenn man aber beispielsweise in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen sollte und besondere Kontakte pflegt, könnte die Befangenheit eher die Ursache sein.
Es wäre sinnvoller, nicht über die Sinnhaftigkeit einer privaten App und einer öffentlich-rechtlichen Orts-App zu mutmaßen und nur Befindlichkeiten in lokalen Berichterstattungen zu präsentieren. Sondern vielmehr darüber nachzudenken, wie man die beiden Medien in der Gemeinde im Interesse des Gemeinwohls verknüpfen könnte! Diese Art von Beiträgen könnte in der Gemeinde Pinnow einen bedeutenden Beitrag zur Meinungsbildung leisten.
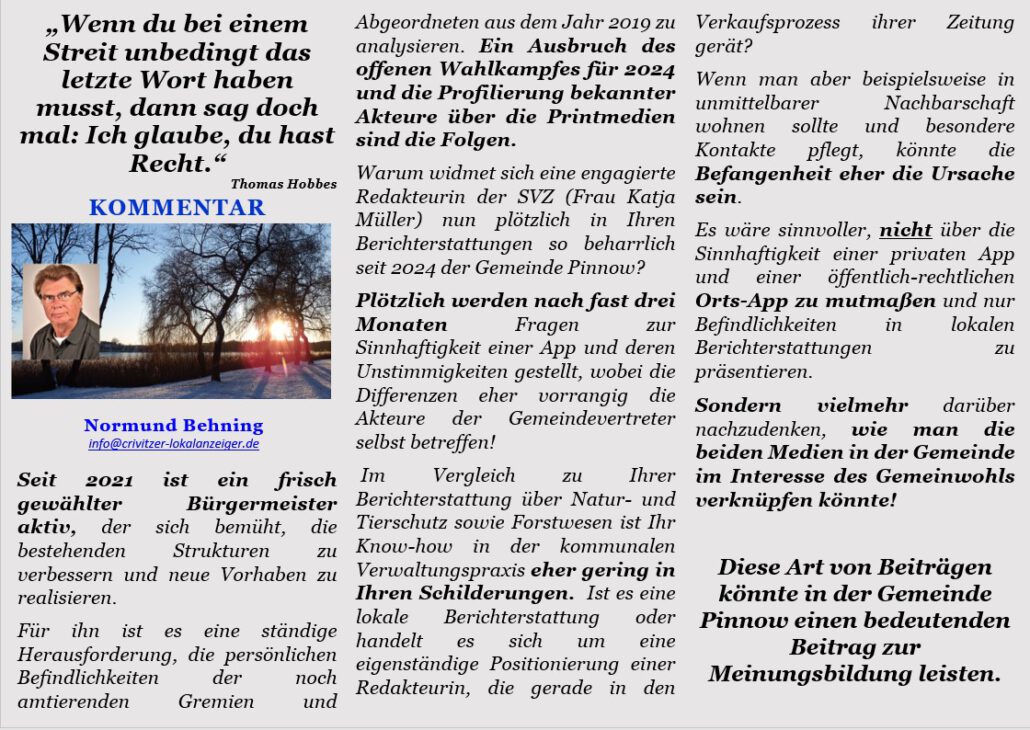
17.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./330[163(38-22)]/CLA-167/05-2024

Aufgrund des Stolperstarts Anfang 2022 und einer verzögerten Ausschreibung wurde die Entscheidung zur Einstellung im Hauptausschuss erst am 17.01.2022 getroffen und zuvor mit Mehrheit der Fraktion CWG-Crivitz und die LINKE/Heine durchgefochten.
Die CDU-Fraktion Crivitz und Umland hat sich wie gewohnt enthalten, soweit sie denn anwesend war. Wie gewohnt, beschritt sie den kürzesten Pfad der Konfrontation, um ein gutes Miteinander zu gewährleisten. Die Kernaussage dieser Entscheidung bestand darin, dass erst ab dem 12. Januar 2022 die Bewerbungsgespräche für das Citymanagement stattfinden sollten und dann die Bürgermeisterin Frau Brusch-Gamm per Order über diese Position entschieden hat. Die Einstellung sollte damals kurzfristig erfolgen Ende Januar und die Stunden sollten nachgeholt werden, so wie es in einer Diskussion empfohlen wurde.
Die Förderrichtlinie des Ministeriums besagt aber, dass die Befristung für das Citymanagement am 31.12.2023 endet.
Nun also wurde jetzt entschieden keine weitere Befristung, sondern das Auslaufen des Vertrages Anfang Februar 2024, weil angeblich keine Förderung mehr weitergeführt wird. Der Gedanke einer Verlängerung und Entfristung des Citymanagements durch die Stadt Crivitz ist indessen endgültig nach drei Monaten der Diskussion vom Tisch. Bereits im November 2023 zeichnete sich diese Entwicklung ab.
Da das Citymanagement der Stadt Crivitz im Oktober 2023 seine letzte persönliche Berichterstattung durchführte, auf der nur zwei eingeschränkte Themen angesprochen wurden, war klar, wohin die Reise geht. Ein Thema war, ob das Arbeitsverhältnis der Citymanagerin über den Februar 2024 hinaus verlängert werden kann oder sogar entfristet werden sollte. Außerdem wurde diskutiert, wie man künftige Stadtrundgänge in der Zukunft einordnen sollte. Das war alles, was annähernd oder vielleicht sogar einer eventuellen Rechenschaftslegung nahekommen könnte.
Die Citymanagerin Frau Marita Schulz konnte im November und Dezember 2023 aufgrund von Abwesenheit keine Berichterstattung durchführen. Deswegen übernahm die Bürgermeisterin die Verantwortung für die Rechenschaftslegung und berichtete über diese Dinge aus ihrer Sicht. Sie war hier wie gewohnt sehr spärlich mit konkreten Informationen und schilderte einige Details zur Aufstellung eines Tannenbaums sowie zu den historischen Stadtrundgängen. Im Monat Dezember 2023 wurde nur ein Termin für den Jahresempfang 2024 mitgeteilt. Das war alles, was so passierte in zwei Monate beim Citymanagement.
Nachdem nun endlich im Kulturausschuss nach drei Monaten die persönliche Berichterstattung der Citymanagerin (Frau Marita Schulz) am 09.01.2024 stattfinden sollte, wurde lediglich mitgeteilt, dass diese nun nicht mehr erforderlich ist, weil das Arbeitsverhältnis Anfang Februar 2024 beendet wird. Aufgrund des Auslaufs der Fördermittel.
Also wurde aus einer Rechenschaftslegung soeben die letzte Rede der Citymanagerin, die sich mit dem bevorstehenden Abschied befasste und von tiefer Wehmut und Traurigkeit geprägt war. Man merkte es ihr auch förmlich an. Sie berichtete, dass sie im Bürgerhaus viel gelernt habe, insbesondere den Umgang mit dem Computer, den sie sonst nirgendwo anders so intensiv kennengelernt hätte. Sie sei nun einmal aus einem fachfremden Beruf hineingewachsen. Außerdem betonte sie, dass es unmöglich sei, zu wissen, was alles im Bürgerhaus geleistet wird. Sie war selbst überrascht über die vielen Aufgaben, die man im Bürgerhaus zu bewältigen hatte. Sie weiß nicht, wie das Bürgerhausteam nun die vielen Aufgaben im Bürgerhaus bewältigen soll, wenn jetzt auch noch ihre Stunden fehlen. Und das war es auch schon in der Rede zum Abschied von ihr.
Im Rahmen der Stellenausschreibung wurden im Dez. 2021 plötzlich Änderungen im Aufgabenbereich vorgenommen!
1. Stärkung der innenstädtischen Entwicklung durch Schaffung von Besuchermagneten
2. Stabilisierung des Einzelhandels im Ortszentrum
3. Vernetzung von kulturellen, wirtschaftlichen Angeboten und deren gemeinsame Vermarktung (Events und Marketing)
4. Organisation der Stadtmesse
5. Mitarbeit an der Weiterentwicklung und Ausgestaltung des historischen Stadtrundgangs
6. Beteiligung an Workshops zur Innenstadtgestaltung
Was bleibt für die Zukunft?
Nun, das eigentliche Ziel des Citymanagement nach der Förderrichtlinie des Ministeriums war es: „Die Rückgewinnung der wirtschaftlichen Bedeutung der Grundzentren, die pandemiebedingt starke Einbußen zu verzeichnen hatten, zu ermöglichen“.
Nach einer anfänglichen „Wiederbelebung des Einzelhandels“ wurde aus dem Begriff nur noch geschrieben: „Stabilisierung des Einzelhandels“. Doch tatsächlich haben sich die Öffnungszeiten und die Anziehungskraft für viele Geschäfte und Besucher verringert. Die Diskussion über eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt war schnell beendet, ebenso wie die Entwicklung eines Konzepts zur Gestaltung eines Verkehrsraum- oder Parkraumkonzepts. Plötzlich war auch die Idee eines Workshops zu der Innenstadt verschwunden, und die Teilnahme daran war fortan nur noch ein Privileg für die Teilnehmer.
Die Workshops zum Thema Innenstadt Marktplatz sind seit 16 Monaten nicht mehr durchgeführt worden und haben sich auch für die nächsten zwei Jahre erledigt, da die Umgestaltung aus Eis gelegt wurde. (Haushaltsmittel?). Für einen Außenstehenden ist es schwierig, zu erkennen, wo die markanten Punkte sind, an denen der Qualitätssprung in Crivitz stattgefunden hat.
Welche Impulse für die innerstädtische Entwicklung sind denn nun geblieben für die Zukunft? Es ist uns nicht gelungen, sie zu entdecken, doch wir sind zuversichtlich, dass sie sie finden werden!
Kommentar/Resümee
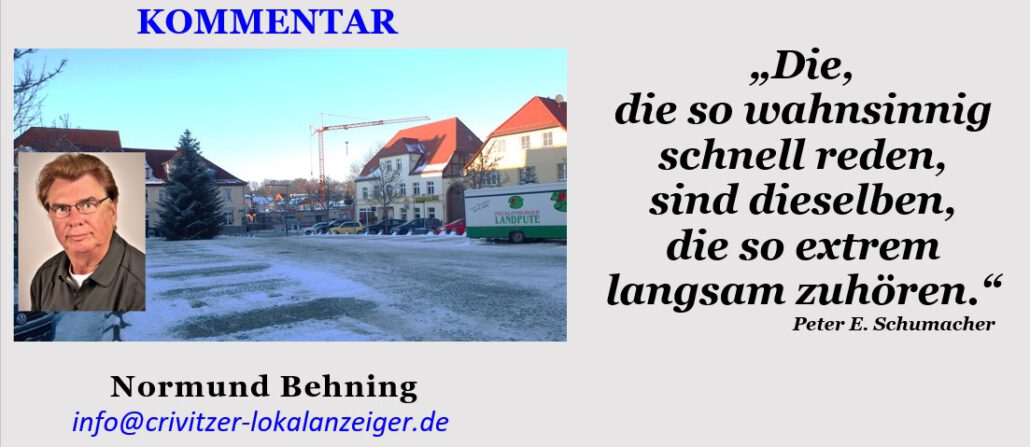
„Die, die so wahnsinnig schnell reden, sind dieselben, die so extrem langsam zuhören.“ Peter E. Schumacher
Alle Gesamtaspekte der tatsächlichen Tätigkeit in Crivitz deuten eher auf eine organisatorische Unterstützung für Veranstaltungen aller Art hin, wo die Bürgerhauskoordinatorin ohnehin die Oberhand in der Organisation zu haben scheint im sogenannten „Team – Bürgerhaus“. Der historische Rundgang wurde mit 5.000,00 € gefördert und von Bürgerhausteam mit dem Heimatverein ausgestaltet, sodass auch hier das Citymanagement vollständig entlastet wurde.
Die Entwicklung einer eigenen Marke für Crivitz oder die Erstellung eines Imagefilms für Crivitz waren auch keine zwingenden Aufgaben für das Citymanagement laut Themenstellung. Beim Thema „Investitionen“ für Unternehmen in der Zielbeschreibung für das Citymanagement in der Zukunft birgt Unsicherheiten und weckt Befürchtungen, die wahrscheinlich von der Stadt auch nicht erfüllt werden könnten.
Der Vorwahlkampf zur Kommunalwahl 2024 scheint den noch Gewählten einiges an Möglichkeiten zu bieten. Ob sie nun notwendig sind oder nicht, wie man es gerade benötigt oder nicht.
So stehen wir selbst enttäuscht da und sind betroffen. Der Vorhang ist zu und alle Fragen bleiben offen!
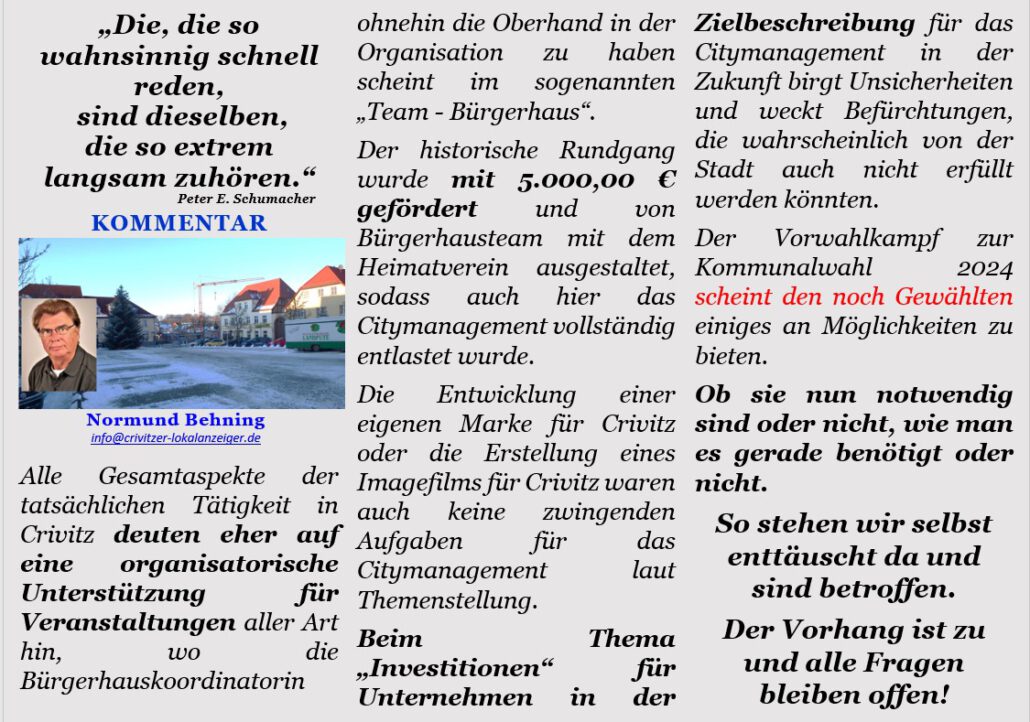
15.Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./329[163(38-22)]/CLA-166/04-2024

Die Erhöhung der Löhne durch das Tariftreuegesetz, die höheren Waren- und Betriebskosten sowie die Anpassung des Mehrwertsteuersatzes von 7% auf 19% sind die Hauptgründe der Preiserhöhungen für Speisen in Schulen und Kitas! Die Firma „Schwerin-Menü“, versorgt alle städtischen Kitas und Schulen in Crivitz und machte es sich in einer Art der Verkündung der Preissteigerung sehr einfach und erklärte sich u.a. über die Printmedien.
„Schwerin Menü weist in seinem Elternbrief darauf hin und benennt die Konsequenzen: Die von uns nicht beeinflussbaren, ungeplanten Mehrkosten müssen wir zum Erhalt unserer Liquidität auf unsere Kundenpreise mit einer Erhöhung von zwölf Prozent für die Erhebung des Höchststeuersatzes und ca. sechs Prozent für die Lohnerhöhung nach dem Tariftreuegesetz anteilig umlegen“(SVZ am 03.01.2023).
Das Tariftreuegesetz sieht vor, dass Aufträge von Land und Kommunen nur noch an Unternehmen vergeben werden dürfen, die ihren Mitarbeitern tarif- oder tarifähnliche Löhne zahlen. Öffentliche Aufträge sind zum Beispiel für Bauvorhaben und Reinigungsleistungen, an Sicherheitsdienste und Essenanbieter. In Bereichen, in denen keine Tarifverträge existieren, ist ein Mindestlohn von 13,50 € pro Stunde vorgesehen. Die Schwellenwerte für die Gesetzesanwendung für Bauleistungen liegen bei 100.000€, für die anderen Bereiche bei 50.000 €.
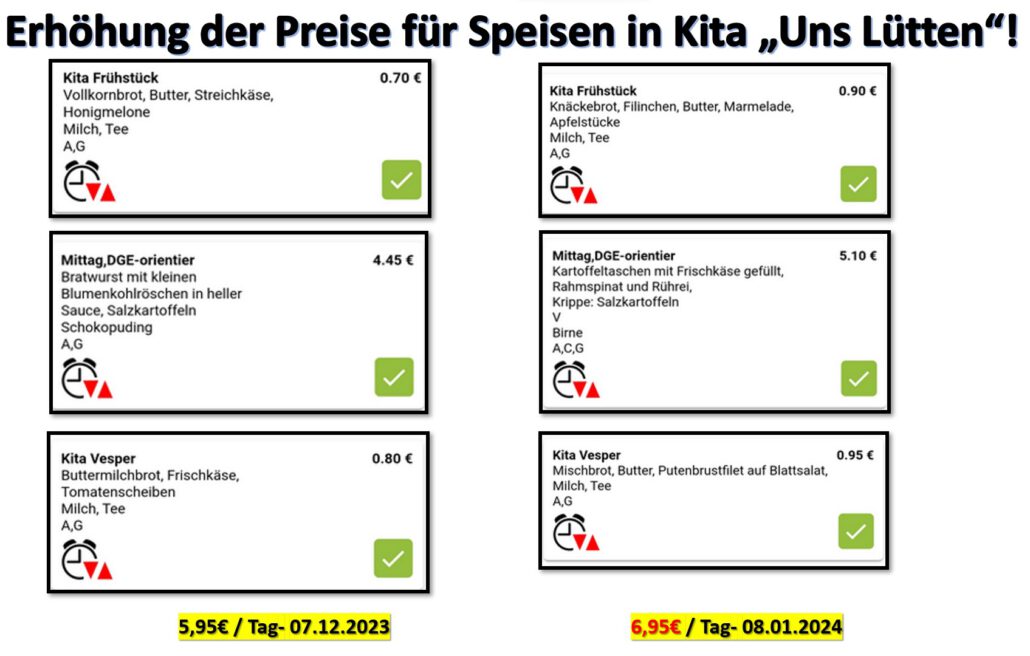
Ab dem 01.01.2024 haben die Ausgaben für Mahlzeiten in der Kita oder Kinderkrippe (Ganztagsbetreuung) einen Anstieg von ungefähr 1,00 € pro Tag verzeichnet.
Eine Ganztagsverpflegung pro KIND in der Kita!
Kita-Frühstück bis 31.12.2023 = 0,70 € – neu = ca. 0,90 €
Kita Mittag bis 31.12.2023 = 4,45 € – neu = ca. 5,10 €
Kita Vesper bis 31.12.2023 = 0,80 € – neu = ca. 0,95 €
Pro Tag – bis 31.12.2023= 5,95€ – neu ab 01.01.2024 = ca. 6,95 € (ca. 17 % Steigerung)
Es liegt in der Verantwortung der Schul- und Kita-Träger, eine Versorgung für die Schüler und Kinder anzubieten und sicherzustellen. Formal ist also in Crivitz die Stadtvertretung als Schul- und Kitaträger dafür verantwortlich. Die Preise werden dann von den Anbietern in ihren Verträgen mit dem Träger der Einrichtung festgelegt. Auch das Bildungsministerium in MV kennt die aktuelle Problematik, sieht sich jedoch nicht in der Pflicht.
Die Verträge mit der Fa. Schwerin Menü GmbH und der Stadt Crivitz wurden für den Zeitraum ab 01.08.2019, mit einer Option auf Verlängerung bis zum 31.07.2023, abgeschlossen. Seit ca. 50 Monaten gibt es im Bildungsausschuss so viel Ungereimtes und Verschleiertes zum Thema Schul- und Kita-Essen, wie schon lange nicht mehr. So informierte der Bildungsausschussvorsitzende Herr Jörg Wurlich (selbst Lehrer in der Grundschule in Crivitz) bereits im Dezember 2021 über Mängel in der Essensversorgung der Schüler, vordergründig in der qualitativen Versorgung. Er schilderte damals, dass die Qualität des Schulessens in der Grundschule sehr nachgelassen hat. Die vereinbarten Qualitätsstandards für das Büfettessen und die Problematik Einweg/Mehrweg wurden nicht eingehalten. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch das erste Mal ein Eingeständnis, dass man damals viel zu früh und voreilig die Verträge mit der Firma UWM in Demen gekündigt hatte. Eine zu späte Einsicht.
Bereits im Jahr 2022 hat das Unternehmen einen Antrag auf eine Preiserhöhung in der Essensversorgung an die Bürgermeisterin gestellt. Wegen gestiegener Preise bei Gas, Strom und Kraftstoff sowie der Lieferengpässe bei Lebensmitteln, dem Fachkräftemangel und den gestiegenen Lohn- und Produktionskosten. Der Antrag wurde ohne Kommentar von der Bürgermeisterin innerhalb von 10 Tagen sofort genehmigt. Erst im Nachgang wurden dann durch die Stadt Crivitz einige Gesprächstermine für die Einrichtungen vereinbart.
Schließlich wurde im März 2023 eine erneute Ausschreibung für das Essen in der Schule und Kita beschlossen. Das Ausschreibungs-verfahren sollte ab Mai 2023 beginnen. Aus dem angekündigten Ausschreibungsverfahren wurde im Juni 2023 ein sogenanntes „Interessenbekundungsverfahren“ gemacht, welches eigentlich eher im Immobiliensektor angesiedelt ist. Es wurde dann im Juni 2023 das sogenannte Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, in dem sich angeblich bis Juli 2023 niemand gemeldet hat, außer dem derzeitigen Anbieter „Schwerin Menü“. So wurde von der Stadtspitze kurzerhand der Vertrag mit diesem Unternehmen erneut verlängert.
Nach intensiver Recherche der Redaktion im Amtsbereich Crivitz und Landkreis LUP bei anderen Anbietern für Schul- und Kita-Essen 2023 wurde festgestellt, dass sie nicht über das Interessenbekundungsverfahren informiert wurden.
Seit fünf Jahren ist das Schul- und Kita-Essen ein Dauerbrenner, der von den Mehrheitsfraktionen der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und der Fraktion DIE LINKE/ Heine getragen wird. Die CDU-Fraktion Crivitz und Umland, die derzeit noch die stärkste Oppositionskraft in der Stadtvertretung stellt, beteiligte sich auch an diesem Hin und Her, ohne aber auch nur ansatzweise zu murren oder einzelne Verfahren zu hinterfragen.
Kommentar/Resümee
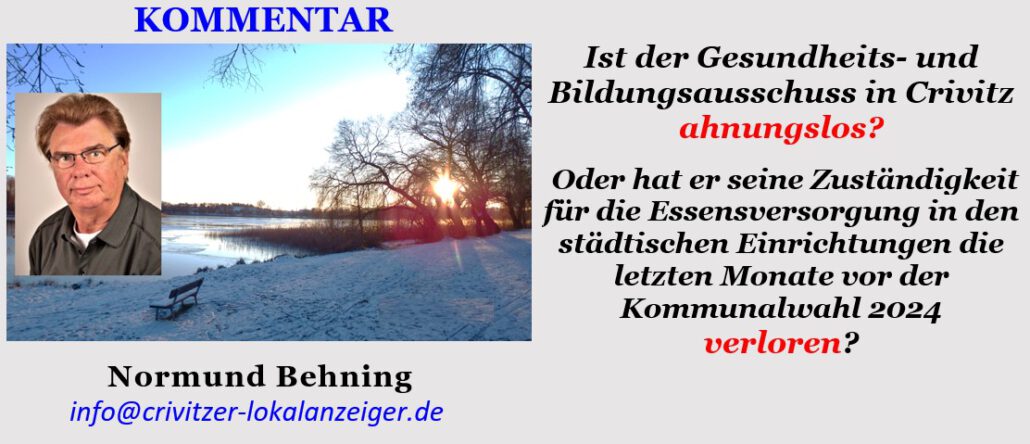
Die Stadt Crivitz ist der Schul- und Kitaträger und hat genügend Gremien geschaffen, wie z. B. die Essenskommissionen, die regelmäßig in den Ausschüssen der Stadt über ihre Arbeit berichten sollten, als Schnittstelle zwischen Essensanbieter und Einrichtung. Die Auswahl des Caterers erfolgt durch den Schulträger auf der Grundlage einer Ausschreibung. In MV ist ein einheitliches Vergabeverfahren mit gleichen Standards etabliert. Die Schulen und Kitas haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Auswahl der Anbieter zu beteiligen. Dies geschieht insbesondere durch die Essenskommissionen an jeder Einrichtung, in der Eltern, Erzieher, Lehrer und Schüler vertreten sind.
Es ist an der Zeit, die Essenskommission in der Kita neu zu aktivieren und zu wählen, da steigende Kosten auch eine entsprechende Qualität des Essenanbieters mit sich bringen müssen! Zu diesem Zweck müssen die Eltern auch ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Essensversorgers in jeder Einrichtung haben. Nach etwa fünf Jahren mit demselben Essenanbieter könnte ein Preisvergleich von Vorteil sein und empfohlen werden. Es ist angesichts der finanziellen Schwierigkeiten vieler Eltern notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob es sinnvoll wäre, das Schul- und Kitaessen von der Stadt Crivitz zu subventionieren.
Wieso trägt nicht die Stadt Crivitz die Kostensteigerung von 1,00 € pro Mahlzeit für die Eltern? Es besteht kein Zweifel, dass das Geld ausreichend vorhanden ist im Haushalt, um die Preissteigerungskosten für die Eltern zu tragen.
Die Preiserhöhung des Essens könnte zum Beispiel aus den Ausgabetöpfen – bei den jährlich mehr als 28.000,00 € Aufwandsentschädigungen für Sitzungen oder aus den jährlichen 10.000 € Repräsentationskosten der politischen Gremien von den insgesamt jährlichen 60.000 € Repräsentationskosten der Stadt – entnommen werden.
Also, bitte, das wäre doch realisierbar! Oder?

12. Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./328[163(38-22)]/CLA-165/03-2024
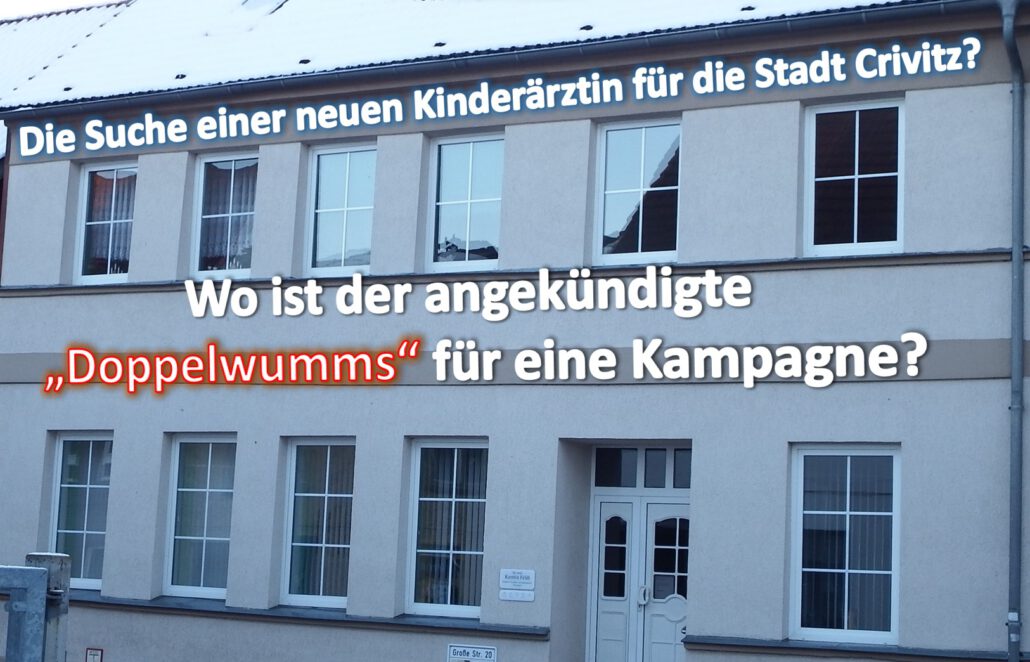
Frau Dr. Feldt, eine renommierte Kinderärztin, hat in den vergangenen Jahren wiederholt angekündigt, ihren Ruhestand anzutreten. Sie hat es wirklich verdient. In Crivitz hat sie Generationen von Kindern betreut, und sie verfügt über eine hervorragende Expertise auf ihrem Gebiet. Sie hatte immer ein hohes Einfühlungsvermögen und so mancher jungen Mutti geholfen, wenn es mal etwas schwieriger wurde. Kurz und knapp: Es bedeutet einen Verlust für Crivitz und seine Umgebung.
Es war kein plötzliches Ereignis, vielmehr wurde der Rückzug bereits im Voraus den Eltern mitgeteilt, lediglich der genaue Zeitpunkt war bislang nicht bekannt. Obwohl immer wieder diskutiert wurde, dass eine Nachfolge möglich ist. So gab es mehrere Bewerbungen, aber leider vergeblich. Vielleicht waren es auch die Standortfaktoren, die eine Rolle spielten.
Für den Crivitzer Schaukasten war die Nachricht über die Schließung der Kinderarztpraxis sicherlich etwas Neues, als er am 09. Nov. 2023 darüber in den sozialen Medien in einem Artikel berichtete. Die meisten Eltern wussten frühzeitig Bescheid und konnten sich umorientieren nach Schwerin und Parchim. Einige Eltern haben es geschafft, ihre Kinder zu anderen Ärzten in Crivitz zu bringen, doch die meisten von ihnen sind in andere Regionen und Städte gezogen. Natürlich ist damit ein höherer Aufwand für die Eltern jetzt verbunden und ein hohes Maß an Organisation, welches ihnen sehr viel abverlangt. Respekt vor jedem Elternteil, der das so organisieren kann.
Umso erstaunlicher ist, dass die Bürgermeisterin sich in den sozialen Medien sofort und unmittelbar meldete und verkündete: „Wir sind bereits im Gespräch mit dem Landkreis für eine Kampagne. Wir geben Euch Nachricht, sobald wir damit in die Offensive gehen, damit wir eine große Reichweite bekommen. Gebt uns noch ein paar wenige Tage.“ (Crivitzer Schaukasten 09.11.2023)
Die Veröffentlichung dieser Angelegenheit durch eine junge Redakteurin der SVZ (Nadja Hoffmann), die scheinbar auch im Internet unterwegs war und stets einen direkten Kontakt zu Entscheidern in Crivitz haben soll, wurde fünf Tage später aufgegriffen und gedruckt. Es war erstaunlich, dass sie lediglich den Text aus den sozialen Netzwerken und einige Rückmeldungen der Besucher wiedergab. Es gab jedoch kein konkretes Interview mit der Bürgermeisterin oder eine genaue Recherche zur Sachlage bei diesem Thema. Dies ist vermutlich auf den sogenannten „Bürgermeisterbonus“ in der Berichterstattung der Redaktion zurückzuführen.
Die Redakteurin hat lediglich berichtet, dass das Thema bei der Bürgermeisterin Betroffenheit ausgelöst hat und die Hoffnung besteht, eine Nachfolge zu finden. („ Auch Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm habe die Nachricht extrem betroffen gemacht……Die Hoffnung sei, so schnell wie möglich eine Nachfolge zu finden – SVZ vom 15.11.2023“).
Mehr wurde darüber nicht berichtet? Also, das war es auch zu diesem Thema. Kein Radiosender oder Fernsehen berichtete darüber, auch im Kreistag war dieses Thema nicht auf der Tagesordnung. Es scheint auch, als hätten weder der Gesundheitsausschuss noch der Kulturausschuss über dieses Thema gesprochen noch eine Debatte darüber geführt oder es wurde von der Stadtvertretung behandelt.
Aus dem angekündigten Zeitraum „ein paar wenige Tage“ sind tatsächlich 60 Tage geworden, ohne dass etwas passiert ist. Es gibt keine Kampagne oder eine große Offensive, stattdessen gibt es keine großen Töne bis zum Wahltermin.
Könnte es sein, dass dieses Thema wieder erneut in einem Wahlprogramm einer Partei oder Wählergruppe zur Kommunalwahl auftaucht?
Kommentar/ Resümee

Es ist bemerkenswert, wie viel Diskussionsstoff in den sozialen Netzwerken herrscht und von Mandatsträgern dort klare zeitliche Vorgaben und Versprechen ausgesprochen werden. In den eigentlichen kommunalen Ausschüssen wird nicht darüber gesprochen, wo Angelegenheiten für das allgemein Wohl eigentlich beraten und entschieden werden sollten.
Erst die Erwartungen schaffen und dann nicht liefern. Was ist das denn?
Trotz der Tatsache, dass die Belange und Hinweise der niedergelassenen Ärzte in Bezug auf kommunale Daseinsvorsorge von Bedeutung sind, scheinen sie hier nicht berücksichtigt zu werden. Es ist zu erwarten, dass das Thema in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, indem es effizienter auf einer Bühne präsentiert wird, um der eigene personellen Präsenz in der Öffentlichkeit zu demonstrieren und eine Wiederwahl zu ermöglichen.
Offenbar wartet die Bürgermeisterin auf die Fertigstellung des Imagefilms für die Stadt Crivitz (bis zu ca. 10.000,00 € aus Steuergeldern), welchen sie dann als große Offensive persönlich darstellen und präsentieren kann.
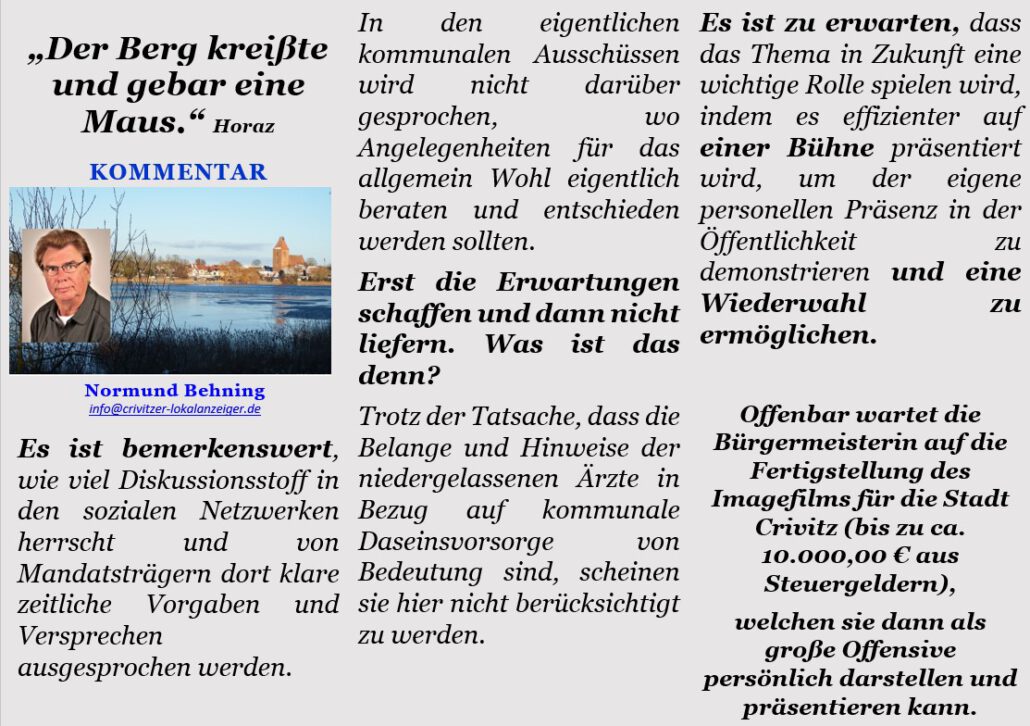
10. Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./327[163(38-22)]/CLA-164/02-2024
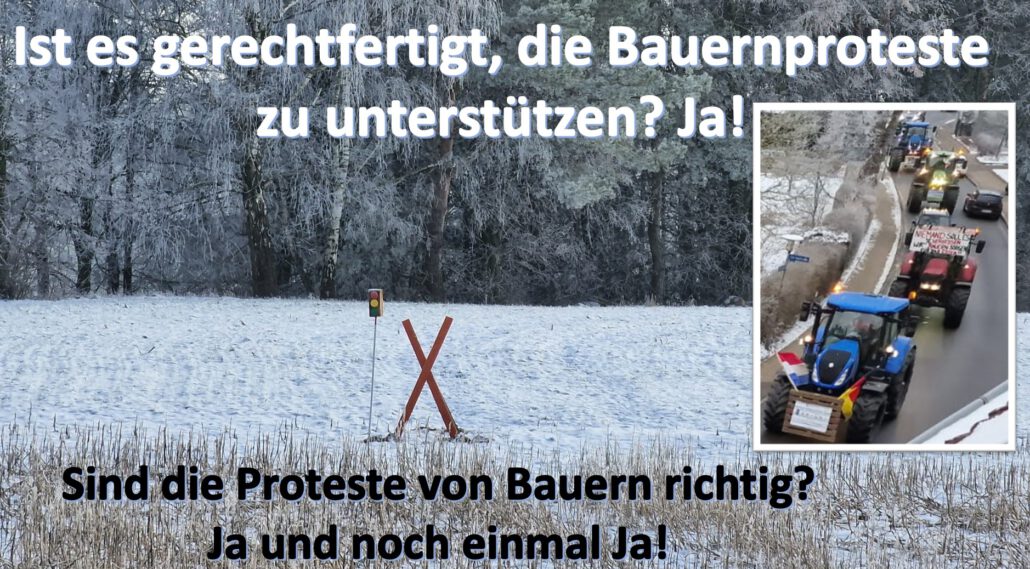
Weshalb sollte das Dienstwagenprivileg beibehalten werden, während der Landwirt nun jedoch für seinen Diesel mehr bezahlen muss? Warum erhalten Bundesbedienstete und Abgeordnete zusätzliche finanzielle Erhöhungen im Jahr 2024, ausgerechnet jene, die den Bauern soeben Auflagen bei Steuern erteilt haben?
Haben die Bauern auch eine Inflationsausgleichspauschale von 3.000 € erhalten? Natürlich ist das nicht der Fall, doch niemand stellt die Frage!
Ein Landwirt, der einen Betrieb zur Fütterung von Milchkühen errichtet, muss mindestens 30 Jahre lang Schulden machen, bevor alles bezahlt ist. Doch was ist mit den ständigen Änderungen und Verordnungen in Bezug auf die Tierhaltung oder den Milchpreis? Lohnt sich dann noch eine Investition in die Milchviehhaltung? Egal, ob es die Bank zur Förderung ist oder eine andere, die sich mit diesem Thema Landwirtschaft beschäftigt, sie vertreten ganz andere Interessen und Ansichten über Gewinn und Zinsen!
Wir dürfen hierbei nicht vergessen, „unsere Bauern sorgen für das ESSEN“. Sie sind in einem Wettbewerb, der sich mit anderen Ländern und anderen Nationen vergleicht.
Unsere Landwirte sind nicht zwangsläufig gegen die Energiewende. Sie betreiben Biogasanlagen, Windräder oder Photovoltaikanlagen. Im Gegensatz zu der „letzten Generation“ wünschen die Bauern nicht, den Bürgern ihre Sicht der Welt vorzugeben.
Die Forderungen der Landwirte sind klar formuliert:
• Rücknahme der schrittweisen Abschaffung der Dieselrückvergütung
• Keine Steuererhöhungen oder Auflagen, die sogar innereuropäisch zu Wettbewerbsnachteilen führen
• Importierte Waren müssen mindestens den deutschen Anforderungen an Umwelt-, Tierschutz- und Sozialstandards entsprechen. (Lieferkettengesetz)
• Klare 100% Herkunftskennzeichnung für alle landwirtschaftlichen Produkte, auch in verarbeiteten Lebensmitteln und Restaurants
Es geht nicht nur um Geld.
Es geht auch darum, einen Berufsstand und seine Arbeit für unsere Gesellschaft anzuerkennen und wertzuschätzen.
Unsere Bauern sind wichtige Leistungsträger in unserer Gesellschaft.
Kommentar/Resümee
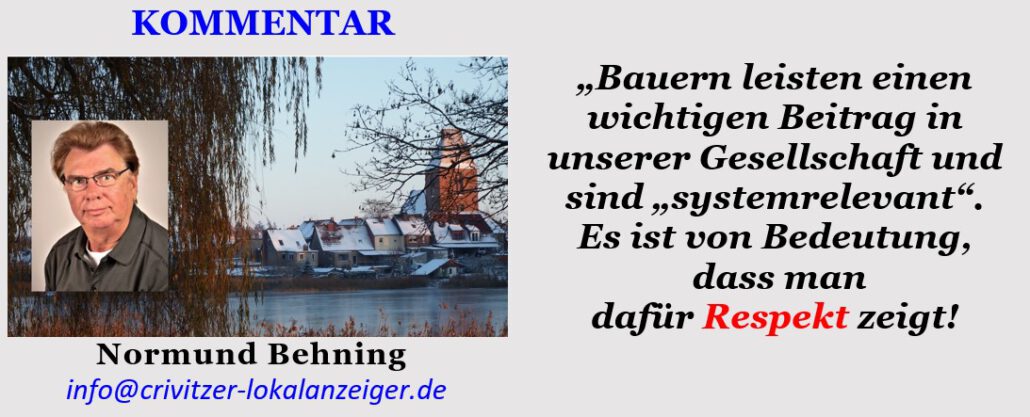
Bauern leisten einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft und sind „systemrelevant“. Es ist von Bedeutung, dass man dafür Respekt zeigt!
Ein Problem besteht darin, dass die ständigen neuen Veränderungen und Regeln für die Landwirtschaft, die Bauern unter Druck setzen sowie sie auf absehbare Zeit zusätzlich belasten. Die Gesellschaft profitierte von der ständigen Abwanderung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe. So hart es klingt, ist es auch.
Der technische Fortschritt zwingt sie dazu, sich zu entscheiden, ob sie wachsen oder untergehen sollen. Bauern sind gezwungen, ständig zu investieren, um überleben zu können. Für diesen Zweck ist es notwendig, dass der Staat ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Jedoch erhöhen diese Investitionen den Wert Ihrer Höfe. Viele wohlhabende Menschen in Deutschland bekommen jährlich Tausende Euro von der Politik, weil ihre Grundstücke teurer werden. Es ist notwendig, um die Landwirtschaft zu erhalten, jedoch ist einer der Hauptgründe, weshalb einige Beobachter die Proteste ablehnen.
In unserem Fall leben wir in einem ländlichen Gebiet und nicht in der Stadt, sondern sind bestens mit den Problemen und Leistungen der Landwirte vertraut.
Macht weiter! Wir unterstützen eure Forderungen!
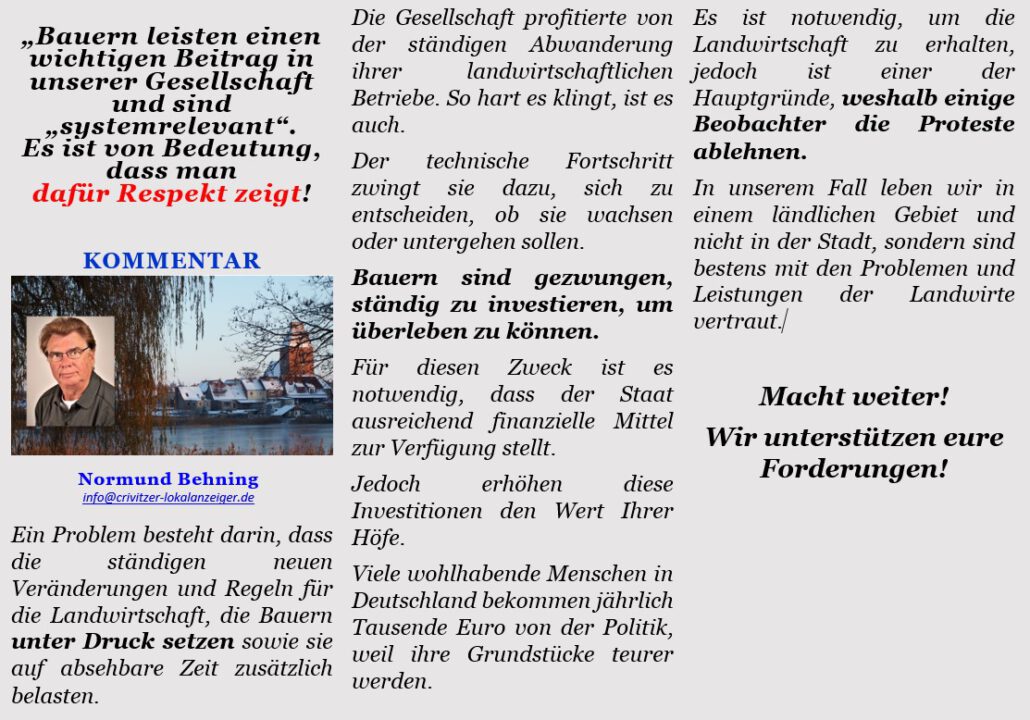
01. Jan.-2024/P-headli.-cont.-red./326[163(38-22)]/CLA-163/01-2024
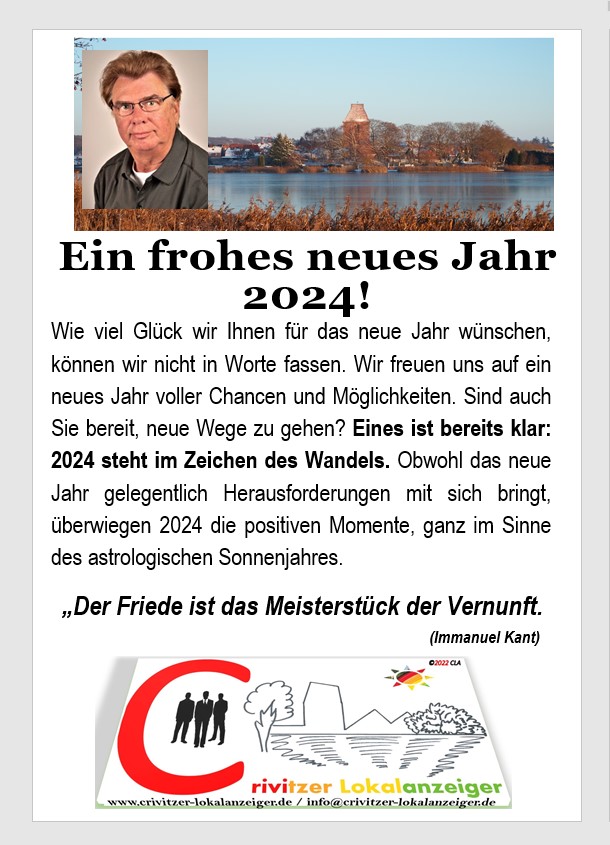
30.Dez.-2023/P-headli.-cont.-red./325[163(38-22)]/CLA-162/103-2023

Liebe Leser, ich hoffe, Sie hatten eine angenehm und besinnliche Weihnachtszeit.
Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Wir schauen gespannt auf das kommende Jahr und lassen die vergangene Zeit Revue passieren. Es war eine turbulente Zeit, das war kein Geheimnis. Insbesondere die neuen Vorschriften zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien eröffnen dem ungebremsten Wachstum in artenreichen Kultur- und Naturlandschaften Tür und Tor. Wir haben in diesem Jahr auch erkannt, wie wertvoll Frieden, Freiheit und Wohlstand sind, jedoch auch wie zerbrechlich sie sind.
Unsere Aktivitäten haben sich im Jahr 2023 auf mehr als 100 kommunale Themen aus der Region konzentriert und über 40 Veranstaltungen direkt besucht. Inzwischen haben sich auch Privatpersonen und Institutionen bei uns gemeldet und ersuchen um eine umfassende Berichterstattung über einige relevanten Themen. Auch kommunale Vertreter aus dem Amtsbereich schütten plötzlich Ihr Herz in unsere Redaktion aus, weil sie zu einem bestimmten Thema mehr Öffentlichkeit verlangen und bitten uns, genau zu diesem Thema zu recherchieren bzw. zu berichten.
Wir haben eine Vielzahl von engagierten und wertvollen Personen getroffen, die sich allesamt mit unterschiedlichen Aspekten auseinandersetzten und dabei überwiegend eine positive Resonanz hinterließen. Die Anzahl der Besucher unserer Internet- und Facebook-Seite zu einzelnen Themen konnte um ein Vielfaches erweitert werden.
Rückmeldungen von Lesern und Abonnenten unserer Webseiten sowie unzählige persönliche Gespräche haben uns in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Ideen beschert. Es wurde von ihnen vertreten, dass es nicht notwendig sei, unsere eigenen Selbstdarstellungen oder Festivitäten zu erstellen, wie es andere politische Gruppen und Gemeinschaften in Crivitz tun, sondern uns stattdessen auf kommunale Inhalte zu Themen zu konzentrieren in der Berichterstattung. Wir werden uns im Wahljahr 2024 an diese Regeln halten.
Unser tiefster Dank gilt Ihrer Treue und Ihre Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten. Dies stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Es ist für uns eine große Freude, zu sehen, dass unsere Leser uns weiterhin treu bleiben.
Daher haben wir im Jahr 2023 die Gelegenheit ergriffen, innovative Methoden zu entwickeln, bestehende Strukturen zu analysieren und unsere eigene Recherche und Themensammlung für das Wahljahr 2024 neu zu strukturieren. Lassen Sie sich von 2024 überraschen!
Wir gehen mit großer Zuversicht in das Jahr 2024 und wenn Sie uns dabei begleiten, ist das ein guter Anfang.
Ich grüße Sie sehr herzlich von Ihrem Lokalanzeiger-Team aus Crivitz.
22.Dez.-2023/P-headli.-cont.-red./324[163(38-22)]/CLA-161/102-2023
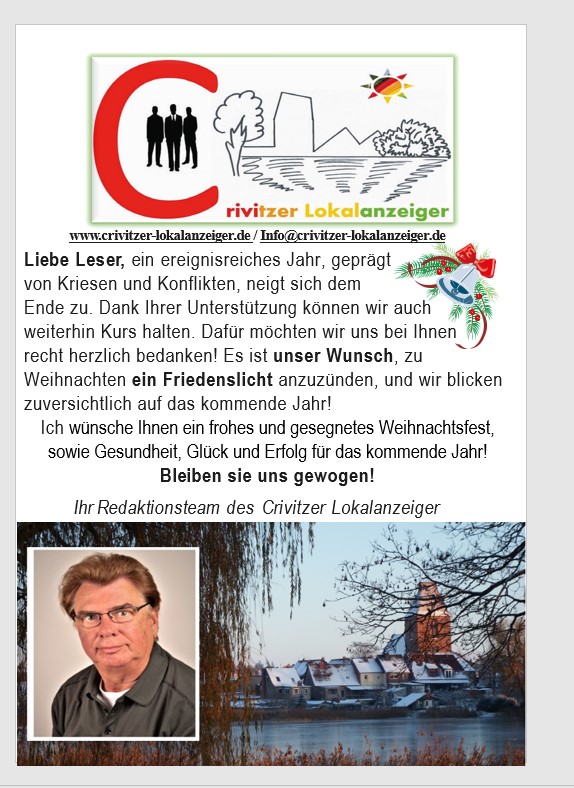
18.Dez.-2023/P-headli.-cont.-red./323[163(38-22)]/CLA-160/101-2023
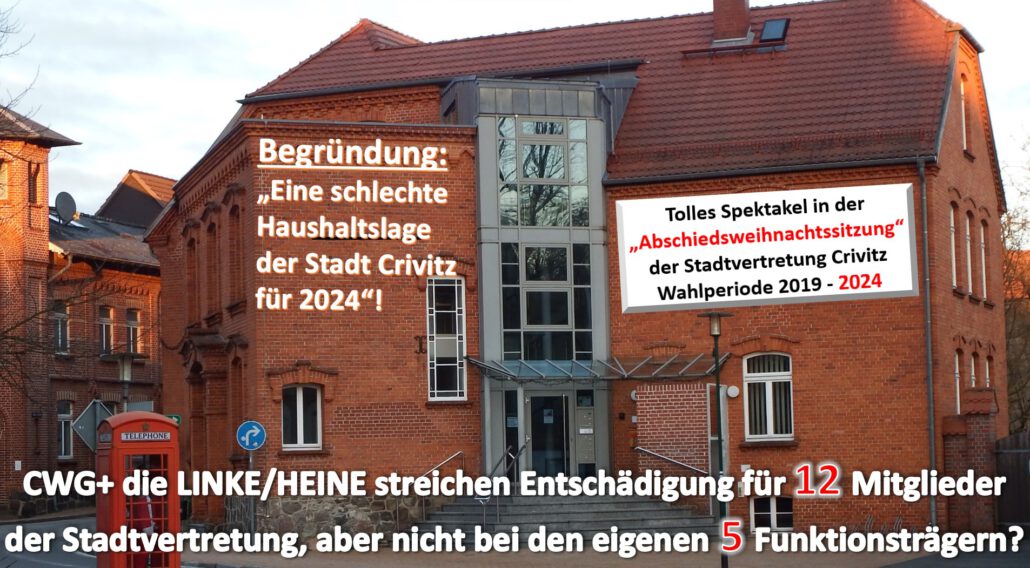
Wenn es um Geld geht, ist die Freundschaft auch bei Abgeordneten vorbei!
Die Mehrheit der Fraktionen in Crivitz (Wählergemeinschaft CWG-Crivitz und Die LINKE/Heine) reduziert für die Zukunft 600 € pro Jahr der Entschädigungen von zwei Dritteln der Mitglieder in der Stadtvertretung, nur bei Ihrem eigenen Funktionsträger nicht!
Ein symbolisches Verhalten von CWG +LINKE zum Wahlkampfauftakt bis Juni 2024 soll Millionen Euro an Ausgaben und die schlechte Haushaltslage gegenüber den Wählern für die kommenden Jahre rechtfertigen.
Ein grandioses Schauspiel, das seinesgleichen sucht.
Vor der Abstimmung über die neue Hauptsatzungsänderung, über die alle Ausschüsse beraten haben, zauberte die Bürgermeisterin in Vertretung des Fraktionsvorsitzenden Herrn Andreas Rüß eine unerwartete Tischvorlage hervor und überraschte alle Anwesenden. Aufgrund eines angeblichen Krankheitsstatus des Fraktionsvorsitzenden der CWG Herr Andreas Rüß brachte die Bürgermeisterin diese Tischvorlage nun persönlich in die Sitzung ein und verlas diese augenblicklich. Diese beinhaltete, dass der Sockelbeitrag (pauschale monatliche Entschädigung) für die meisten Abgeordneten abgeschafft werden sollte.
Die CWG – Crivitz begründete ihre Entscheidung mit einem zu erwartenden Haushaltsdefizit im Jahr 2024 und in den Folgejahren und forderte die Abgeordneten auf, mit gutem Beispiel voranzugehen bei der Kürzung von Entschädigungen. Es kam zu einer heftigen Debatte und die Mehrheitsfraktionen führten diesen Antrag samt Modifikationen durch, obwohl sie nie zuvor in den Ausschüssen über dieses Thema diskutiert hatten. So funktioniert die von allen so beschriebene Demokratie oder das Verständnis darüber in der Tourismusstadt „Crivitz“ von CWG +die LINKE.
Das Fatale an dieser neuen Regelung ist, dass alle Funktionsträger innerhalb der Stadtvertretung, die ausschließlich aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE/Heine + CWG kommen, davon nicht betroffen sind. Diese Funktionsträger haben keinerlei Absicht gezeigt, sich in irgendwelcher Form in der Diskussion zu diesem Thema zu äußern, soweit sie sich überhaupt einmal mal öffentlich äußern. Es wurde bei den Funktionsträgern keinerlei Akzeptanz für eine freiwillige Reduzierung ihrer eigenen Entschädigungen festgestellt. Dieses Husarenstück könnte auch zum Karneval im Volkshaus Crivitz verwendet werden unter dem Titel: Erst eine schlechte Haushaltslage als Funktionsträger für die kommenden Jahre verursachen und dann andere Mitglieder als Schuldige suchen und bei diesen Kürzungen herbeiführen! Mit dieser Maßnahme ist dann wieder alles in Ordnung.
Die Mitglieder der Gemeindevertretungen können, sofern sie keine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung derselben Vertretung empfangen, zusätzlich zum Sitzungsgeld einen monatlichen Sockelbetrag erhalten. Er ist eine pauschale monatliche Entschädigung (ein fester Betrag, der in gleicher Höhe gezahlt wird) unabhängig von Krankheit oder nicht Anwesenheit bei Sitzungen oder nicht Tätigkeit. So dürfen zurzeit bis 12/2024 noch folgende Höchstsätze nicht überschritten werden: bis 5 000 Einwohner ein Betrag von 50 € pro Monat. Eine neue Verordnung mit neuen und noch höheren Höchstsätzen ist bereits in MV für 03/2024 angekündigt worden, welche dann erst ab dem 01.01.2025 auch gezahlt werden könnte. Diese Pauschale Entschädigungen [Sockelbetrag monatlich 50,00 € + die Sitzungsgelder (pro Sitzung 40,00 €)] sind gemäß § 14 Absatz 4 EntschVO M-V steuerfrei! Wer nun genau diesen Sockelbeitrag erhält, bestimmt die jeweilige Gemeinde-, Stadtvertretung in Ihrer Hauptsatzung.
Möglicherweise war ein Auslöser für die Streichung von Entschädigungen in der Stadtvertretung durch die beiden Mehrheitsfraktionen, weil eine nachgerückte Abgeordnete (Frau Beate Werner) der CDU-Fraktion (Gemeindeverband Crivitz und Umland) bereits seit etwa 18 Monaten nicht mehr anwesend war. Sie hat bisher ca. 38 Sitzungen, in denen sie überall Mitglied ist, nicht besucht, aber dennoch hat sie Anspruch auf bisher etwa 900 € als Entschädigung durch den Sockelbetrag. Dies gilt auch für die Wählergemeinschaft CWG – Crivitz, wo ebenfalls eine Abgeordnete (Frau Susanne Döring) ca. 15 Monate fehlte, bevor sie sich in eine andere Gemeinde im Amtsbereich umgemeldet hatte.
In Crivitz bekommen laut Hauptsatzung von den 17 Mitglieder der Stadtvertretung, damit also 12 Mitglieder diesen monatlichen Sockelbetrag von 50,00 € (7x die Fraktion der Wählergemeinschaft CWG – Crivitz und 5x die Faktion der CDU-Crivitz und Umland Fraktion) und die 5 Funktionsträger (2x die Linke/Heine und 3x die CWG) erhalten diesen nicht.
Ein Stadtvertreter, der nicht als Funktionsträger fungiert und in der Regel in zwei Ausschüssen vertreten ist und auch keinen Vorsitz in diesen hat, erhält folgende Entschädigung: Bei ⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen + 10 ⌀ Ausschusssitzungen Nr.1+ 10⌀Ausschusssitzungen – Nr.2 pro Jahr (p. a.) = ca. 600 € Sockelbetrag + 280 € Fraktionssitzungen +400 € Ausschusssitzung Nr.1+ 400 € Ausschusssitzung Nr.2= Gesamt: ca. 1.680 € (p. a.) das betrifft: Thomas Bardenhagen, Eike Glasemann, Matthias Güßmann, Wilfried Holl, Lisa Klünder-Fittke, Kurt Pekrul, Karin Pyrek, Jens Raulin, Jens Reinke, Karina Reinke, Beate Werner, Jörg Wurlich. In Zukunft werden es jedoch nur noch gesamt: 1.080 € jährlich bei Besuch/ Anwesenheit in den Sitzungen sein, ohne den Sockelbetrag.
Funktionsträger sind von dieser Kürzung des Sockelbetrages völlig ausgeschlossen und genießen einen Sonderstatus aufgrund ihrer umfassenden verantwortungsvollen Funktion und ihrer wirkungsvollen Tätigkeit. Zusätzlich zu den Funktionsbezügen erhalten sie bei der Anwesenheit der durchschnittlichen Sitzungen im Jahr der Ausschüsse folgende Entschädigungen: Abgabenfrei!
1.BÜ Herr Michael Renker – Fraktion Wählergemeinschaft CWG
Entschädigungen als 2. Bürgermeister und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung sowie als Mitglied im Bauausschuss [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen pro Jahr (p. a.)] Entschädigung: 6.000 €+1000 €= Gesamt: ca. 7.000 € (p. a.)
2.BÜ Herr Hans-Jürgen Heine – Fraktion die LINKE/Heine
Entschädigungen als 1. Bürgermeister und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung sowie als Vors. des Ausschusses [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen pro Jahr (p. a.)]. Entschädigung: 3.000 €+1.220 €= Gesamt: ca. 4.220 € (p. a.)
Bürgermeisterin-Frau Britta Brusch-Gamm – Fraktion Wählergemeinschaft CWG
Entschädigungen als Bürgermeisterin sowie Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + Fraktion sowie Besuch bei Ausschüssen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen pro Jahr (p. a.). Entschädigung: 30.000 € + 1.000 € + Fahrkosten 1.440 € = ca. 32.440 € (p. a.) +Vorsitzende des Amtsausschusses =7.200 € (p. a.) + 6⌀ Sitzungen Amtsausschusses + 6⌀ Hauptausschuss=480 € (p. a.)—Gesamt: ca. 40.120 (p. a.)
Fraktionsvorsitzender die LINKE/Heine, Herr Alexander Gamm (Fraktion die LINKE/Heine:
Erhält: Entschädigungen als Fraktionsvorsitzender und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + mindestens in zwei Ausschüssen bzw. als Vors. des Ausschusses+ Fraktionssitzungen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen Vors.-Bauausschuss +⌀7 Sitzungen Hauptausschuss p. a.] Entschädigung: 1.440 € Fraktionsvorsitzender+280 € Stadtvertretersitzung +660 € Vors. Bauausschuss+ 280 € Hauptausschuss+ 280 € Fraktionssitzungen = Gesamt: ca. 2.940 € (p. a.)
Fraktionsvorsitzender der Crivitzer Wählergemeinschaft (CWG – Crivitz) Herr Andreas Rüß:
Erhält: Entschädigungen als Fraktionsvorsitzender und Sitzungsgeld in der Stadtvertretung + mindestens in zwei Ausschüssen+ Fraktionssitzungen [Bei⌀7 Sitzungen Stadtvertretung+⌀7 Fraktionssitzungen+11⌀Ausschusssitzungen Umweltausschuss + ⌀7 Sitzungen Hauptausschuss p. a.] Entschädigung: 1.440 € Fraktionsvorsitzender+280 € Stadtvertretersitzung+440 € Umweltausschuss+ 280 € Hauptausschuss+ 280 € Fraktionssitzungen) = Gesamt: ca. 2.720 €(p. a.)
Keine Funktionsträger in der CDU-Fraktion!
Die CDU-Fraktion vom Gemeindeverband Crivitz und Umland hatte bis zum 04/2022 einen Fraktionsvorsitz in der Stadtvertretung.Eigentlich sollte der Fraktionsvorsitz ab dem 05/2022 von drei Personen wahrgenommen werden. So wurde es auf jeden Fall in der Stadtvertretersitzung am 23.06.2023 öffentlich verkündet durch die Bürgermeisterin, mit der Randbemerkung „Mal sehen, wie das gehen soll und wie lange das hält“.
Es war ihr sicherlich schon damals bewusst, dass es gemäß Kommunalverfassung unzulässig ist, drei Fraktionsvorsitzende in einer Fraktion (bei einer Gruppe von fünf Stadtvertretern) die Funktionszulagen zu gewähren. Laut Berichten aus vertrauenswürdigen Quellen, die üblicherweise gut informiert sind, wurde berichtet, dass angeblich dieser dreiköpfige Fraktionsvorsitz in einen dreiköpfigen Vorstand umgewandelt oder gedeutet worden ist. Folglich ist es nicht erkennbar, wer und ob hier jemand in der CDU-Fraktion Crivitz seit dem April 2021 diese oder eine Funktionszulage erhält. Somit ist eine Bewertung eines Funktionsträgers nicht möglich und auch nicht öffentlich bekannt. Die CDU-Fraktion hält sich wie schon in der Vergangenheit auch in der Gegenwart zu solchen heiklen Angelegenheiten äußerst bedeckt. Eine öffentliche Stellungnahme der CDU-Fraktion Gemeindeverband Crivitz und Umland (welche vermutlich auch nicht öffentlich war) wurde nicht veröffentlicht, wohl um den Ruf der Partei in der Öffentlichkeit zu schützen!
Jeder Bürger der Stadt Crivitz hat sich bereits lange über die desolate Situation in der Stadt Crivitz ein eigenes Bild gemacht, sodass es zu diesem Thema keinen weiteren Kommentar mehr bedarf.
Die Kosten für die Entschädigungen der Funktionsträger und Abgeordneten betrugen ca. 47.700 €. Die Kosten für die Sitzungen der Abgeordneten, der sachkundigen Einwohner und der OTV-Mitglieder beliefen sich auf etwa 30.000 €. Insgesamt wurden 77.700 € dafür ausgegeben.
Kommentar/Resümee

„Der einzige Weg, um das Verhalten der Politiker zu ändern, ist, ihnen das Geld wegzunehmen.“ Milton Friedman-Nobelpreisträger
Pure Makulatur!
Es wird von einigen Beobachtern angenommen, dass das ganze Ereignis und die Aufregung um den Sockelbetrag eine Provokation von der Wählergemeinschaft der CWG-Crivitz und der Fraktion der LINKE/Heine darstellen.
Einerseits sollte verdeutlicht werden, wie man eine mögliche Genehmigungspflicht für den Crivitzer Haushalt 2024 durch den Landkreis LUP umgehen kann, indem man mit einem anschaulichen Beispiel vorankommt und die Ausgaben verringert. Um eine Darstellung zu erzeugen, dass man auch in Zukunft die Ausgaben noch annäherungsweise beherrschen kann. Dazu müsste man aber hunderttausende Euro sparen und nicht diese kleine Summe von ca. 7.200 €, also doch nur eine „Show“.
Aber auch andererseits könnte es eine Trotzreaktion der Mehrheitsfraktionen auf die jüngste Ankündigung der ehrenamtlichen Feuerwehr und ihre Forderungen zu neuen Entschädigungen (aufgrund deiner neuen Überarbeitung der Entschädigungsverordnung vom Land) sein. Die CDU-Fraktion ist diesbezüglich besonders engagiert, da sowohl Mandatsträger als auch Funktionäre in Vereinen aktiv sind und somit Ämter ausüben.
Bereits während der Hauptausschusssitzung zeigte sich diese Lage, als der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Herr Alexander Gamm, sich merklich errötete und eine vergleichsweise Statistik von anderen Feuerwehren verlangte, da ihm offensichtlich die Forderungen zu hoch erschienen. Die Einsparung des Sockelbetrages von 7.200 € soll wahrscheinlich die Kosten für die Erhöhung der Entschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute decken.
Es lässt sich zusammenfassen, dass Kürzungen stets willkommen sind, jedoch sind diese kleinen Beträge nur eine Randerscheinung, da sie lediglich eine politische Leinwand oder einen neuen Imagefilm für die CWG + die Linke darstellen.
Aber warum verwehren sich eigentlich die eigenen Funktionsträger der Mehrheitsfraktionen von CWG und DIE LINKE etwas Geld abzugeben? Im Jahr 2015 wurde noch groß verkündet, dass man auf 50,00 € bis 100 € im Monat verzichten will, solange man sich in einem Haushaltssicherungskonzept aufgrund der schlechten Haushaltslage befindet. Das Ganze hat nur 10 Monate gehalten. Danach wurden alle Beträge wieder voll ausgezahlt.
Es ist bedauerlich, dass alle Funktionsträger der Fraktion DIE LINKE/Heine + CWG von den Streichungen ausgeschlossen werden und bei diesen keinerlei Bemühungen bestehen bei ihren eigenen Entschädigungszahlungen, die doch ausreichend bemessen sind, Kürzungen zu akzeptieren.
Im Jahr 2019 hatte man überhaupt nicht diskutiert und gleich beim Sockelbetrag voll zugegriffen, der nun 2023 wieder abgeschafft werden soll, weil etwa die Wiederwahlaussichten doch nicht so rosig sind?
So kann man in Crivitz nicht ein neues Image aufbauen und solidarisch ist das auch nicht!