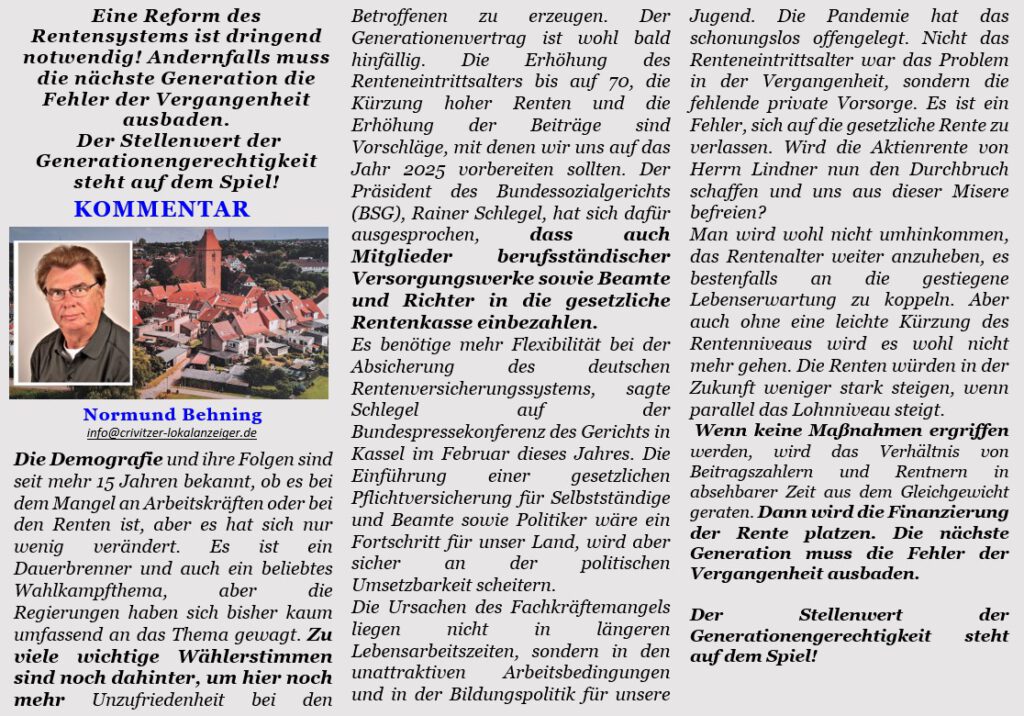02.Juli-2023/P-headli.-cont.-red./294[163(38-22)]/CLA-131/72-2023
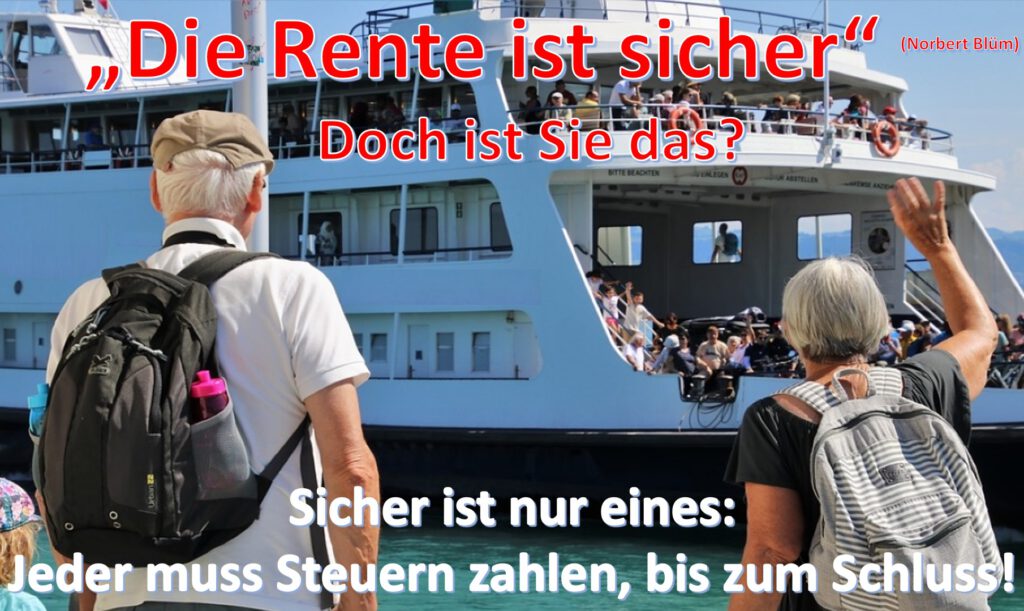
Nach fast 33 Jahren seit der Wiedervereinigung hat sich das Niveau der Renten in Ost- und Westdeutschland endlich angeglichen. Die Menschen im östlichen Teil des Landes waren immer vorher identifizierbar als Ostdeutsche aufgrund ihrer Rentennachweise. Die erfreuliche Lohnentwicklung ermöglicht es, die Rentenwerte bereits im Jahr 2023 an die Ost-West-Angleichung anzupassen. Damit beträgt ab 1. Juli 2023 der aktuelle Rentenwert in Ost- und Westdeutschland einheitlich 37,60 €. Dies ist gut, aber bei Weitem nicht ausreichend für die Zukunft. Allerdings bestehen auch weiterhin Unterschiede zwischen den Generationen, wie bei der Mütterrente, die für heutige und künftige Rentner im Osten die Lage schwieriger machen. Eltern, die Kinder haben, die vor 1992 geboren sind, können sich so bis zu 2,5 Jahre der Kindererziehung anrechnen lassen und wenn diese nach 1992 geboren sind, können Sie für die Rentenversicherung sogar bis zu drei Rentenpunkte geltend machen. Bei dieser Festlegung sind die Unterschiede deutlich zu erkennen.
Das deutsche Rentensystem ist kompliziert. Die Basis des Systems besteht aus drei Säulen. Säule eins umfasst die Pflichtsysteme: Für Angestellte ist das z. B. die gesetzliche Betriebsrente. Für Beamte die Beamtenversorgung oder für Ärzte die Ärzteversorgung. Eine weitere Säule ist die private Zusatzvorsorge, also Versicherungen wie die „Riester-Rente“ oder ähnliche Produkte. Und die dritte Säule ist die betriebliche Altersversorgung. Hier ist zu unterscheiden zwischen Pensionskassen und Direktversicherungen. Die meisten Firmen bieten ihren Angestellten heute eine betriebliche Altersvorsorge über eine Direktversicherung an. Vor allem große Unternehmen betrieben früher mehr als heute selbst Pensionskassen für die Betriebsrente ihrer Mitarbeiter. Und auch der Staat für seine Angestellten im öffentlichen Dienst, das Versorgungsamt des Bundes und der Länder (VBL).
In den ausgehandelten Tarifabschlüssen in diesem Jahr (VERDI) würden theoretisch auch die ehemaligen Angestellten des öffentlichen Dienstes profitieren, also die Betriebsrentenempfänger. Aber es war die Gewerkschaft, die Anfang der 2000er-Jahre mit ausgehandelt hat, dass der besagte Absatz im Paragraf 16 (Betriebsrentengesetzes) nicht auf ehemalige Angestellte angewendet wird. Vor allem Frauen sind häufiger als Männer betroffen, da sie in der Regel länger leben. Im Gegensatz zu den ehemaligen Beamten, die in den vergangenen Jahrzehnten deutlich mehr Pensionserhöhungen erhalten haben.
Wir befinden uns mitten im demografischen Wandel, so wird der Anteil der Menschen an der Gesamtbevölkerung, die 60 Jahre und älter sind, immer größer und der Anteil der jungen Menschen bis 30 Jahre weiter schrumpfen. Diese vorrangige Entwicklung wird sich in Zukunft bis 2030 noch weiter verstärken, da die Babyboom-Generation in Rente gehen wird. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge der Zeit von 1955 bis 1965, die das Wirtschaftswunder ansteigenden Geburtenraten hervorbrachten. Diese Wirtschaftswunder benötigen wir auch wieder im Jahr 2023, um die Geburtenraten wesentlich zu steigern, verbunden mit einer sozialen Stabilität und Sicherheit, eben die ausgeprägte soziale Marktwirtschaft. Doch angesichts der Krisen und Kriege wird es wohl nur ein Wunsch bleiben, dass es nicht so schnell Wirklichkeit wird.
Im Jahr 1962 hätten noch 6 Erwerbstätige einen Rentner finanziert. Im Jahr 2030 werde diese Zahl auf 1,5 Erwerbstätige sinken und bis 2050 sogar auf 1,3. Durch die jährlichen Renteneintritte der Babyboomer bis 2030 werden wir jedes Jahr ca. 380.000 bis 400.000 qualifizierte Arbeitskräfte verlieren, die dann fehlen werden. Aufgrund der entstehenden Finanzierungslücke zahlt der Staat bereits jetzt jährlich einen Zuschuss von rund 112 Milliarden Euro in die Rentenkasse.
Eins ist bereits jetzt klar: Wenn das derzeitige Rentensystem beibehalten werden soll, muss es mehr Einwanderung geben, um die Produktivität zu steigern. Nur mit einer gezielten und qualifizierten Ausbildung von Fachkräften, die sich in verschiedenen Asylsstufen befinden, könnte es gelingen. Aber die Einwanderung allein reicht nicht aus, um das Ganze zu kompensieren. Natürlich nicht.
Die CDU schlägt hierzu vor, eine sogenannte Arbeitspflicht und eine Aktivrente zu vereinbaren. Einerseits die Abschaffung der jetzigen Form des Bürgergeldes und andererseits die Möglichkeit, dass jeder Rentner weiterarbeiten kann. Die Einkünfte sollten sozialabgabenpflichtig bleiben, aber steuerfrei sein.
Die FDP schlägt eine sogenannte Aktienrente vor. Mit der Idee, dass der Staat Geld am Kapitalmarkt anlegt, also Aktien und Anleihen kauft, und der Gewinn soll den Bürgern als Zuschuss für ihre Rentenfinanzierung zur Verfügung gestellt werden. Bis die entsprechenden Größenordnungen erreicht werden, dauert es Jahrzehnte. Jeder Steuerzahler ist automatisch Aktionär geworden.
Die Linke will eine allgemeine Rentenerhöhung und eine Rentenversicherung für alle, die auch Beamte, Politiker und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
Die SPD will die gesetzliche Rente zukunftssicher machen und steigt in die Aktienrente ein. Wobei man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen darf, dass die SPD mit dafür gesorgt hat, dass ab 2025 der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor (in der Rentenformel) eingeführt wurde. Dieser eingefügte Faktor, sorgt automatisch dafür, dass die Renten nicht mehr so stark steigen werden wie die Löhne. Dies führt zu einer Rentenkürzung. Auch im kommenden Jahr 2024 werden die Rentner noch einmal ein Plus von mindestens 5,5 bis 6 Prozent bekommen, meinen Sozialexperten. Bevor dann der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor im Jahre 2025 wirkt.
Und dann stehen auch schon wieder die Bundestagswahlen 2025 an. Aus einer neuen Reform ist wieder nur eine Flickschusterei geworden. Die wirklich neue Reform macht dann vielleicht eine andere Regierung.
Aber die Zeit zum Handeln drängt und läuft uns davon!
Es fehlt hier das Gefühl der Unaufschiebbarkeit, das Rentensystem zu retten!

Eine Reform des Rentensystems ist dringend notwendig. Andernfalls muss die nächste Generation die Fehler der Vergangenheit ausbaden. Der Stellenwert der Generationengerechtigkeit steht auf dem Spiel!
Die Demografie und ihre Folgen sind seit mehr 15 Jahren bekannt, ob es bei dem Mangel an Arbeitskräften oder bei den Renten ist, aber es hat sich nur wenig verändert. Es ist ein Dauerbrenner und auch ein beliebtes Wahlkampfthema, aber die Regierungen haben sich bisher kaum umfassend an das Thema gewagt. Zu viele wichtige Wählerstimmen sind noch dahinter, um hier noch mehr Unzufriedenheit bei den Betroffenen zu erzeugen. Der Generationenvertrag ist wohl bald hinfällig. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters bis auf 70, die Kürzung hoher Renten und die Erhöhung der Beiträge sind Vorschläge, mit denen wir uns auf das Jahr 2025 vorbereiten sollten. Der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Rainer Schlegel, hat sich dafür ausgesprochen, dass auch Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke sowie Beamte und Richter in die gesetzliche Rentenkasse einbezahlen. Es benötige mehr Flexibilität bei der Absicherung des deutschen Rentenversicherungssystems, sagte Schlegel auf der Bundespressekonferenz des Gerichts in Kassel im Februar dieses Jahres. Die Einführung einer gesetzlichen Pflichtversicherung für Selbstständige und Beamte sowie Politiker wäre ein Fortschritt für unser Land, wird aber sicher an der politischen Umsetzbarkeit scheitern.
Die Ursachen des Fachkräftemangels liegen nicht in längeren Lebensarbeitszeiten, sondern in den unattraktiven Arbeitsbedingungen und in der Bildungspolitik für unsere Jugend. Die Pandemie hat das schonungslos offengelegt. Nicht das Renteneintrittsalter war das Problem in der Vergangenheit, sondern die fehlende private Vorsorge. Es ist ein Fehler, sich auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Wird die Aktienrente von Herrn Lindner nun den Durchbruch schaffen und uns aus dieser Misere befreien?
Man wird wohl nicht umhinkommen, das Rentenalter weiter anzuheben, es bestenfalls an die gestiegene Lebenserwartung zu koppeln. Aber auch ohne eine leichte Kürzung des Rentenniveaus wird es wohl nicht mehr gehen. Die Renten würden in der Zukunft weniger stark steigen, wenn parallel das Lohnniveau steigt. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern in absehbarer Zeit aus dem Gleichgewicht geraten. Dann wird die Finanzierung der Rente platzen.
Die nächste Generation muss die Fehler der Vergangenheit ausbaden. Der Stellenwert der Generationengerechtigkeit steht auf dem Spiel!